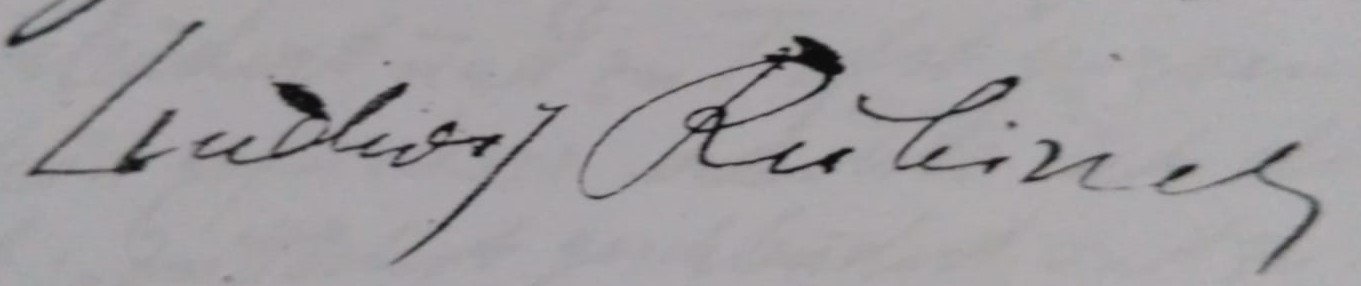Die indischen Opale
Die indischen Opale - Kriminal-Roman von Ernst Ludwig Grombeck
I. Im Haus ist Lärm
Berlin! - Ein Summen, Klirren und Stampfen steigt in die Nacht auf, und das schillernde Netz der Lichter spannt sich über das tönende Dunkel. Licht und Lärm sind untrennbar vereint in dieser gewaltigen Stadt der Arbeit und der Lust; und wenn die Massen dur ch die geraden Straßen der jungen Großstadt hasten, weiß man nie, ob es zur Arbeit geht oder zu irgendeiner hastigen, schnell beschlossenen, schnell genossenen und schnell erledigten Vergnügung. In einem verwirrenden Bilde rauscht alles vorüber, und alles Leben schöpft seine Nahrung aus jener bizarren Mischung von hundertjährigem preußischen Soldatengeist und der plötzlich wildanstürmenden Wucht der modernen Industriespekulation. Und wie die Stadt, so ist auch die Seele ihrer Menschen aus denselben Gegensätzen geformt. In diesen Menschen der jüngsten Weltstadt wohnen Kraft und Krankhaftigkeit dicht beieinander, und in ihren Häusern, in den Arbeiterquartieren des Nordens und Ostens und in den stillen, glatten, frischgewaschenen Straßen des Westens gehen unheimlich eng miteinander Glück und Unheil, Frieden und Verbrechen.
Am Rande des Tiergartens gibt es ein paar ruhige Straßen mit villenartigen, soliden Häusern hinter Bäumen und Vorgärten, die gebaut zu sein scheinen, um einen ruhenden Punkt für beschauliche Leute in dem wüsten Strudel der Großstadtgegensätze zu bilden. Eine riesige, alte Platane mit einer kleinen Umzäunung aus Stein und rostigem Eisen steht inmitten einer Straßenkreuzung. Von hier aus sieht man das Ende der Margaretenstraße, und da scheint die Welt wirklich mit Brettern vernagelt. Ein großer, alter, brauner Zaun schließt die Straße ab. Und wenn man an der Straßenkreuzung steht, hat man den merkwürdigen Eindruck, dass hier in dieser vornehmen Straße ein Duft von Park und Landleben, ein Hauch der Abgeschlossenheit vom Getriebe sich vereinen mit dem Rauschen der Weltstadt, deren hastige Massen sich wenige Schritte weiter über die Potsdamer Brücke vorbeiwälzen.
Eine trübe, heiße Sommermorgendämmerung rang mit der langsam unterliegenden Nacht. Das Orchester der Großstadt verstummte allmählich immer mehr. Berlin hörte auf zu dröhnen, und nur ein letzter, ungewisser Akkord summte über allem im halben Morgenschimmer, ein Akkord, der vielleicht schon wieder in dem erwachenden Leben der Stadt neu zu tönen und zu wachsen begann. Die Straßenlaternen waren längst erloschen, und über ihnen standen die Fenster, hinter denen die wohlhabenden Bürger der Margaretenstraße ruhig schliefen, weit der eindringenden warmen Nachtluft geöffnet. An dem alten Baume inmitten der Straßenkreuzung blinkte ab und zu der Helm des Schutzmanns ein wenig auf, der hier Nachtdienst hatte. Gelangweilt stand er da, ein bißchen verärgert, denn sein Nachtdienst war ganz überflüssig. Hier, in dieser vornehmen, stillen Gegend, kam doch nichts vor!
Plötzlich klirrte ganz hinten, wo die Straße sackgassenförmig abschloß, ein Gitter. Ein Herr war auf die Straße getreten. Einen Augenblick blieb er stehen, ein Streichholz flammte auf – eine Zigarette wurde angezündet. Dann ging er, langsam schlendernd, ein paar Schritte; jetzt schien er sich aufzuraffen, sein Gang wurde straff, er schritt schnell vorwärts. Als er näher kam, sah der Schutzmann, dass der Spaziergänger ein junger Mann im Gesellschaftsanzug war. Bleich, nervös mit der Hand am blonden Schnurrbart zupfend, ging er schnell vorbei, ohne den Schutzmann zu beachten. Einen Moment strich er mit den Händen an sich herunter, um die eingedrückte Hemdbrust in Ordnung zu bringen, streifte mit verlorenem Blick die blinkende Helmspitze des Schutzmanns und verschwand dann in einer Seitenstraße. Mechanisch zog der Schutzmann die Uhr: es war fünf Minuten über vier. Er drehte sich um und sah mit Amtsmiene nach dem Hause, das der Spaziergänger verlassen hatte. Er zählte die Hausnummer ab: das Haus musste die Nummer 25 haben. Nummer 25 – da wohnte ja wohl der reiche Brandorff! – Doch plötzlich gab er sich einen Ruck: „Was geht mich das an, wenn hier jemand das Haus verläßt? Die Geheimnisse der Reichen kümmern mich nicht. Ich habe meinen Posten, um die Straße vor Lärm oder vor Schlägereien zu bewahren. Aber hier kommt ja doch nichts vor.“ Und er wendete sich wieder nach der anderen Seite und erwartete ungeduldig die Morgenablösung.
Der ehemalige Bankier Brandorff war in Berlin als ein sorfältiger Sammler reicher Kunstschätze bekannt, doch schon seit Jahren kaum mehr als dem Namen nach. Er besuchte niemand, empfing auch keine Besuche, und trotzdem seine Tochter Cecily seit einiger Zeit aus ihrer englischen Pension zurückgekehrt war, gab Brandorff auch keine Gesellschaften. Seit einigen Jahren verließ er sogar nicht einmal mehr zu Spaziergängen das Haus. In dieser Wohnung in der Margaretenstraße galt nur ein Gesetz: die verwöhnten Nerven des alten Raritätenliebhabers zu schonen. Alles ging mit peinlichster Regelmäßigkeit und äußerster Stille vor sich. Da man die schmale Gestalt des weißhaarigen Herrn stets im Hause wußte, hörte man nie ein lautes Wort, und die Dienerschaft war zur äußersten Geräuschlosigkeit angewiesen; selbst bei Cecilys jugendlicher Lebensfreudigkeit und Lebhaftigkeit geriet das Haus nur in eine momentane, ganz leise Erregung, dann war alles still wie zuvor.
Der helle, heiße Morgen, der der Nacht folgte, erfüllte die Atmosphäre Berlins mit bedrückendem Dunst. In der Portierloge von Brandorffs Hause erhob man sich heute später als gewöhnlich. Eine seltsame Schlaftrunkenheit lag über den beiden alten Leuten, die das Haus hüteten, und die des Morgens sonst die Ersten zu sein pflegten. Voll Unruhe steckte der alte Lehnert den Kopf aus der kleinen Glastüre: „Hör’ doch mal, Lene,“ sagte er zu seiner Frau, „was ist denn da los?“ Ein merkwürdiger, ganz ungewohnter Lärm erfüllte das Haus. Man lief hin und her, Türen wurden geklappt, unterdrückte Rufe wurden laut. Cecily Brandorff hörte plötzlich heftig an ihre Zimmertür klopfen. „Wer ist da?“ fragte sie noch halb im Schlaf. „Bitte, gnädiges Fräulein, machen Sie um Gottes willen auf!“ hörte sie die Stimme des Dienstmädchens jammern.
„Ach, Sie sind es, Martha? Aber es muss ja noch ganz früh sein! Sie wissen doch, ich bin gestern erst spät ins Bett gekommen. – Es ist unerhört!“ Und unwillig wandte sie den von einer goldgewellten Haarflut umgebenen Kopf auf die andere Seite und wollte im künstlich verdunkeltenen Zimmer weiterschlafen. Aber plötzlich schrak sie auf: „Gnädiges Fräulein!“ – kam es von der Tür her in halb unterdrücktem Wimmern. Hastig sprang sie auf, schlüpfte schnell in ein leichtes Negligé und schob den Türriegel zurück. „Was gibt es, Martha, was wollen Sie?“ fragte sie ein wenig verängstigt. „Gnädiges Fräulein – gnädiges Fräulein – – ist der gnädige Herr denn verreist?“
„Wer – mein Vater? Sind Sie verrückt, Martha? – Was ist – was ist geschehen?“ „Gnädiges Fräulein, kommen Sie schnell“ – es klang fast wie Stöhnen – „der gnädige Herr“ – – „Um Gottes willen – mein Vater?“ – Wie zwei ausgejagte Vögel strichen die beiden mit den fliegenden Morgenkleidern durchs Haus. Die Sonne funkelte schon hell und hitzedrohend durch die Zimmer, als Cecily und das alte Dienstmädchen von dem im Parterre gelegenen Damenschlafzimmer über die Haupttreppe hinauf in den ersten Stock liefen. Um in die Zimmer Brandorffs zu kommen, mußten sie erst den langen Gang passieren, in dem Brandorff seine bekannte Bildergalerie untergebracht hatte. Von da ging’s durch das Billardzimmer, und Cecily sah mit Angst, dass ganz ungewohnterweise die grünverhangene elektrische Lampe über dem Billard jetzt, am hellen Morgen, noch brannte. „Was ist das!“ zeigte sie in aller Hast auf die Lampe.
„Ich weiß nicht, gnädiges Fräulein!“ antwortete die alte Martha. „Sie brannte noch, als ich heut morgen ins Zimmer kam; das hat der gnädige Herr nie zugelassen. Ich hab’ gesehen, dass die Schlafzimmertür auf war und niemand im Zimmer. Ich hab’ vorsichtig den Kopf reingesteckt, aber es war niemand da. Da hab’ ich Angst bekommen und bin zu Ihnen gelaufen – vielleicht ist der gnädige Herr heimlich weggereist!“
Cecily merkte, dass hinter den Worten des alten Mädchens etwas Unausgesprochenes lag, das ihr Angst machte. Sie stieß die Schlafzimmertür auf – niemand war im Raum. Das Bett war unberührt, es schien eben frisch aufgeschlagen. Was war denn das nur? Der Vater ging doch kaum aus dem Hause und am allerwenigsten zur Nacht und heimlich. Voll Angst eilte sie ins Billardzimmer zurück und öffnete die Tür zum Bibliothekzimmer. Aber nichts war zu sehen als ein hoher, heller Raum mit Bücherregalen an den geweißten Wänden und einem großen Tisch in der Mitte. Ein wenig zögernd ging sie zur nächsten Tür. Es war die kleine Tür aus getäfeltem Eichenholz, die zum Arbeitszimmer des alten Brandorff führte. Niemand durfte dies Zimmer betreten, selbst Cecily nicht. Brandorff pflegte sogar dies Zimmer selbst aufzuräumen – das war seine Marotte. Nur in früheren Jahren, als er noch von Zeit zu Zeit kleinere Gesellschaften gab, war der Höhepunkt des Abends, wenn er die kleine Tür mit feierlicher Miene öffnete und seine Gäste einlud, jene kostbare Sammlung seltener Edelsteine zu besichtigen, die er sorgsam in Glaskasten geordnet hatte. Aber das war längst vorbei.
Cecily zögerte vor der Tür, sie wagte nicht, ohne weiteres die Klinke herunterzudrücken. Sie klopfte zaghaft. – Keine Antwort. – Zweimal, dreimal – ohne Erfolg. Entschlossen griff sie nach der Türklinke und drückte sie herunter. Die Tür war geschlossen. Einen Moment standen die beiden Frauen ratlos einander gegenüber. Es zuckte ihnen nervös übers Gesicht. Die alte Martha brach das Schweigen: „Vielleicht soll ich John holen?“ brachte sie mit stockender Stimme hervor. Einen Moment Stille, dann antwortete ein trockenes Schluchzen: „Hole John, Martha!“ Sie kamen auf den Zehen herbeigeschlichen, so wie man in Zimmer kommt, in denen man den Anblick eines schrecklichen und unerwarteten Begebnisses ahnt. Man sah Johns kleiner, sehniger Gestalt den ehemaligen Jockei an, und seine kleinen, fast stechenden, graunblauen Augen erinnerten an den scharf messenden Blick des Hindernisreiters. Er schien schon vor der Tür gewartet zu haben.
„John, mein Vater gibt keine Antwort“, sagte Cecily halblaut. „Die Tür ist zu, wir müssen ins Zimmer!“ Schweigend griff John zur Türklinke. Seine muskulösen Arme strafften sich, sein Gesicht wurde in der Anstrengung rot. Die Tür blieb geschlossen. Mit ein wenig englischem Akzent in der halblauten Stimme sagte er: „O gnädiges Fräulein, das Schloß ist aus festem Stahl, ich kenne es!“ Cecilys große, braune Augen, die so seltsam gegen die goldene Masse ihres blonden Haares abstachen, irrten ratlos umher, verschüchtert, hilfesuchend wie die eines geängstigten Vögelchens, das sich in ein Zimmer voll fremder Menschen verirrt hat. „Was ist denn um Gottes willen nur geschehen, John?“ Und mit einer plötzlichen Eingebung: „Ist mein Cousin noch hier? Ist er über Nacht geblieben?“ „Herr Soltau ist nicht im Gastzimmer, gnädiges Fräulein. Ich habe nachgesehen.“ „Wann ist er weggegangen?“ fragte Cecily halb mechanisch. „Ich weiß es nicht,“ antwortete John. „Ich brachte gestern abend den Herren den Tee ins Billardzimmer, dann gingen der gnädige Herr und Herr Soltau ins Arbeitszimmer. Der gnädige Herr sagte mir, ich solle zu Bett gehen, es wäre nichts mehr nötig.“
Auch hinter dieser Antwort lauerte etwas Unausgesprochenes, so schien es Cecily. Plötzlich sagte John in seiner langsamen Redeweise: „Vielleicht hat Herr Soltau das Haus durch die Tapetentür im Arbeitszimmer verlassen.“ Die Tapetentür – welch ein Einfall! Alle atmeten einen Moment auf. „Schnell“ sagte Cecily, „wir wollen von der anderen Seite ins Zimmer!“ Die drei jagten hinunter ins Erdgeschoß und liefen so hastig durch den Hausflur in den Garten, dass der alte Lehnert in sprachlosem Erstaunen den Kopf aus der Portierloge heraussteckte. Die Vormittagssonne lag hell auf dem gelben Kies des kleinen Vorhofes, der das Haus vom Garten trennte. Das alte, angerostete Gartentor war offen, es machte den Eindruck, als wäre es während Jahre nicht geschlossen worden. Hier im Garten merkte man wenig von der Sonne. Nur ein glitzerndes, grünes Funkeln glitt von Zeit zu Zeit durch die dichten, breiten Laubkronen der alten, hohen Bäume, wie man sie in Berlin nur noch in den alten, vornehm abgeschlossenen Häusern findet, die gebaut wurden, als diese heut vom Großstadtgetriebe umbrandeten Stadtteile fast noch Villenviertel waren.
Die drei liefen zu der hohen, grauen Mauer, deren verwitterten Kalkstein ein dichtes, wildes Getriebe von Efeu hoch und graugrün überspann. Seltsam genug nahm sich in der breiten Mauer die niedrige, schmale Tür aus, die sofort zu einer eng gewundenen, hölzernen Wendeltreppe führte. Die Tür war offen. Hintereinander keuchten sie die Wendeltreppe empor. Droben war ein kleiner Vorplatz auf dem sie, Atem schöpfend, anhielten. Ein ganz kleines, vergittertes Fensterchen, draußen dicht von Efeu verdeckt, ließ spärliches Dämmerlicht auf das kaum sichtbare Türchen fallen, das zu Brandorffs Arbeitszimmer führte. John rüttelte an der Tür. Auch sie war verschlossen. Nun hielt er sich am krachenden Treppengeländer fest und stemmte die Schulter mit unbezwinglichem Vordringen gegen die Tür. Ein Knall von geborstenem Holz – und John hielt keuchend die auffahrende Tür zurück. Cecily raffte heftig ihren Rock empor und schritt mit starrem Blick, tief Atem holend, über die Schwelle. Die Augen gewöhnten sich an das grünliche Dunkel, das die harabgelassene Jalousie ins Zimmer ließ. Drei Augenpaare blickten spähend ins Zimmer. Es war leer.
II. Folgerungen.
Leer – keine Menschenseele zu sehen! Das Arbeitszimmer Brandorffs war ein kleiner Raum mit wenig Möbeln. In der Nähe des Fensters ein Schreibtisch, daneben ein mittelgroßes Regal, vollgedrückt mit hohen Büchern, gegenüber eine Chaiselongue. Vor dem Schreibtisch ein halb zur Seite gedrehter Arbeitsstuhl, dem gegenüber ein Polstersessel. Cecily zog die Jalousie hoch. Das plötzlich einfallende Licht vom Garten zeigte, wie bequem und wohnlich dieses so karg möblierte Zimmer doch war. An den Wänden hingen in schlichten Naturholzrahmen alte Stiche. Auf der anderen Seite der Bibliothektür standen auf langen, schwarz gebeizten Füßen zwei lange, schmale, verschlossene Kästen mit schrägen Glasdecken – ein klein wenig eingestaubt. Es war die Edelsteinsammlung Brandorffs. Man sah, dass ihr Besitzer sich längere Zeit nicht recht um sie gekümmert haben mochte. Staub lag auch auf dem alten Ebenholzrahmen, der die vergilbte Photographie einrahmte, die über den beiden Truhen hing. Davor stand ein Tischchen, auf dem zwei halbgeleerte Teegläser waren. Alles sah aus, als sei der Bewohner des Raumes nur eben einen Augenblick fort. John ging zuerst zur Tür des Bibliothekzimmers und sah sie an, dann zur Tapetentür, die er aufgebrochen hatte.
„O – die Türen sind von innen abgeschlossen – die Schlüssel stecken noch!“ Ratlos und ängstlich sahen Cecily und Martha ihn an. „Aber was soll das nur bedeuten?“ fragte gepreßt Cecily. Und plötzlich brach sie in ein wirres Schluchzen aus und ließ sich matt und ratlos in den Sessel fallen. Johns scharfe Stimme durchdrang den Raum leise: „Befehlen gnädiges Fräulein vielleicht, dass zu Herrn Soltau geschickt wird?“ Wie eine Erlösung ging es über Cecilys Gesicht: „Ja, John, sofort, schicken Sie Lehnert auf der Stelle zu meinem Cousin.“ Fort waren die Tränen. Beinahe strahlend hatte sie die Worte gesprochen. Doch plötzlich kam ihr ein anderer Einfall. Kaum zehn Minuten entfernt wohnte noch ein Freund des Hauses – Rechtsanwalt Sanders. Er stand als juristischer Beirat ihrem Vater zur Seite, kam oft ins Haus und sein Verhalten war das eines klugen, ruhigen Mannes, der mit scharfem Verstand ein feines Gefühl verband. Und da er noch dazu mit Soltau innig befreundet war, hatte sie um so mehr Vertrauen zu ihm. Den Rechtsanwalt Sanders wollte Cecily jetzt rufen. Sie wußte, er würde ihr bestens beistehen.
Sofort begab sie sich ans Telephon: Sanders war da, er antwortete, dass er sogleich kommen werde. Eine bange, schreckliche halbe Stunde verging. Endlich hörte Cecily unten Geräusch. Ein Automobil war vorgefahren. Die Tür ging auf, Rechtsanwalt Sanders trat ein. „Ah, Herr Rechtsanwalt, guten Tag! Ich danke Ihnen außerordentlich, dass Sie kommen!“ Rechtsanwalt Johannes Sanders küßte Cecily die Hand. Sein glattrasiertes, kluges Gesicht sah besorgt aus. „Was gibt es, Fräulein Cecily? Sonst haben doch nie Sie, sondern Ihr Vater mich rufen lassen! Ich hoffe doch – dass nichts“ –
„Herr Sanders, wie schrecklich – denken Sie, mein Vater ist fort.“ Sanders sah sie verständnislos an: „Fort!“ „Ja fort! Und auf so sonderbare Weise – aus seinem abgeschlossenen Zimmer – ich weiß gar nicht, was ich denken soll – o, es ist entsetzlich!“ Sanders stellte sich aufgeregt vor sie: „Was sagen Sie - aus seinem verschlossenen Zimmer? Ich bitte, sprechen Sie deutlich, Fräulein Cecily!“ „Sehen Sie selbst“, sagte Cecily tonlos und wies mit einer Handbewegung auf die offenstehenden Türen des Arbeitszimmers. Es klopfte, John trat herein. „Wann kommt mein Cousin?“ fragte Cecily ihn erregt. John antwortete mit seinem unbeweglichen, englischen Gesicht: „Herr Soltau war nicht zu Hause!“ „Nicht zu Hause?“ rief Cecily. „Aber um diese Zeit ist er doch immer zu Hause!“ „Als ich in die Königgrätzer Sraße kam,“ antwortete John, „sagte mir der Diener, Herr Soltau habe gestern abend, bevor er wegging, befohlen, die Koffer reisefertig zu machen. Heut früh wollte Herr Soltau abreisen. Aber er ist noch nicht wieder nach Hause gekommen!“
In jähem Schreck murmelte Cecily: „Erich will reisen?“ Aber bevor sie ihren ängstlichen Träumen weiter nachgehen konnte, trat mit ruhigen Bewegungen Sanders dazwischen: „Sagen Sie, John“ fragte er, „wann war denn Herr Soltau zuletzt hier?“ „Gestern abend, Herr Rechtsanwalt!“ „Nun“ – und?“ „Die beiden Herren zogen sich ins Arbeitszimmer zurück, nachdem ich den Tee gebracht habe!“ „Ja, mein Vater sagte ihm, er solle zu Bett gehen“, bemerkte Cecily. „Sind Sie da gleich zu Bett gegangen?“ fragte Sanders. „Nein, Herr Rechtsanwalt.“ Cecily sah erstaunt auf. Warum hatte er das verschwiegen? „Was taten Sie dann?“ fragte Sanders ruhig weiter. „Ich machte erst das Gastzimmer zurecht, weil ich dachte, so spät in der Nacht, da bleibt Herr Soltau vielleicht hier. – Er hat es oft getan, als das gnädige Fräulein noch in England war.“
„Und dann?“ „Dann ging ich ins Billardzimmer und wartete, ob der gnädige Herr vielleicht doch noch etwas brauchte.“ „Wurden Sie gerufen?“ „Nein, Herr Rechtsanwalt!“ „Und was haben Sie dann gemacht?“ „Ich ging zu Bett, Herr Rechtsanwalt!“ „Gleich?“ „Ja – gleich!“ Ein unmerkliches Zögern begleitete Johns letzte Antwort. Aber Sanders’ feingeschulten Ohren war es nicht entgangen. Einen Moment besann er sich, dann sah er John ruhig und groß in die Augen: „Haben Sie irgend etwas wahrgenommen?“ „Nein, Herr Rechtsanwalt!“ „Ist Ihnen nichts aufgefallen? – Gar nichts?“ Einen ganz kleinen Augenblick Pause. Dann: „Nein!“ Im selben Moment trat Sanders dicht vor ihn hin und rief ruhig und kalt: „Bitte, sagen Sie mir sofort, was Ihnen aufgefallen ist. Sie haben etwas bemerkt – ich weiß es!“ John hielt seinen Blick aus, dann sah er sekundenlang auf Cecily, die voll erregter Spannung zuhörte. „Wenn Herr Rechtsanwalt es wissen – Herr Soltau schien mir etwas verstört. Und später, als ich im Billardzimmer wartete – hörte ich durch die Türen – aber ich kann mich auch täuschen – ich glaube, einen erregten Wortwechsel zwischen dem gnädigen Herrn und Herrn Soltau.“
Hastig sprang Cecily auf, in höchster Erregung: „John, wie können Sie es wagen, so etwas zu sagen! Das ist eine unglaubliche Frechheit!“ Sanders trat dazwischen: “Ich bitte Sie, liebes Fräulein Cecily, Sie dürfen sich nicht aufregen! Warum sollte Johns Bericht nicht der Wahrheit entsprechen?“ John war sofort in sich zurückgekrochen: „Ich habe mich wohl getäuscht. Zwischen dem Billard- und dem Arbeitszimmer liegt ja die Bibliothek. Man kann sich leicht irren in den Geräuschen.“ Sanders sagte kalt: “Es ist gut, John. Sie können gehen!“ Cecily ging in höchstem Entsetzen im Zimmer auf und ab. Sie rang krampfhaft die Hände: „Sanders, Sanders - ich bitte Sie – was soll das nur sein! Erich hat doch nie ein heftiges Wort gesagt. Und mein Vater war so ruhig und überlegt. - Mein Vater – wo ist mein Vater? Und Erich will reisen und ist nicht nach Hause gekommen! – O Gott, was geht nur hier vor? Warum muss das alles gerade auf mich eindringen?“ Und in tiefster Verwirrung laut und angstvoll schluchzend, brach sie zusammen. Sanders schellte nach Martha. Er gab dem Mädchen rasch und leise die nötigen Anordnungen, wie sie die Stöhnende beruhigen konnte, dann ging er ohne Zeitverlust hinunter in die Loge des Portiers.
„Hören Sie mal, Lehnert,“ sagte er zu dem aufgeregten Alten, dem tausend ratlose Fragen auf der Zunge schwebten, „wann haben Sie eigentlich heut nacht Herrn Soltau weggehen sehen?“ „Ich habe ihn gar nicht weggehen sehen, Herr Rechtsanwalt. Herr Soltau hat schon seit langem den Hausschlüssel und ist vom gnädigen Herrn oft erst in später Nacht weggegangen, wenn alles schon schlief. Die haben dann oben zusammengesessen über den gelehrten Büchern – aber davon versteh’ ich nichts, Herr Rechtsanwalt! Die Martha hat mir oft gesagt: „Nein, so etwas, wie der gnädige Herr und der Herr Soltau nur immer in der tiefen Nacht lesen können!“ Unsereins wird schon manchmal froh sein, wenn man die ganze Zeitung durch hat. Aber dahinten, die kleinen Annoncen – mit meinen alten Augen ist das schon ein bißchen schwer, Herr Rechtsanwalt! Der Herr Rechtsanwalt können sich ja denken“- „Sagen Sie, Lehnert,“ unterbrach Sanders kurz den Redefluß des Alten im braunen, gestrickten Wolljackett, „ist gestern abend irgend sonst jemand hier gewesen?“ „Nein, Herr Rechtsanwalt – da ist kein Fremder gekommen – das müßte ich ja sonst wissen! Wenn man so in seiner Loge sitzt“. „Wann ist Herr Soltau gesten abend gekommen?“ rief Sanders dazwischen. „Herr Soltau? So um neun Uhr!“ „Hm – danke. Haben Sie hier in der Loge Telephon, Lehnert?“ „Jawohl, Herr Rechtsanwalt.“ „So – na, ich werde jetzt nach dem Polizeirevier telephonieren.“ „Nach dem Revier, Herr Rechtsanwalt? Nach dem Revier? O Gott, o Gott – solang’ ich hier sitze, ist uns keine Polizei ins Haus gekommen! Und nun geht alles drunter und drüber, Herr Rechtsanwalt, Polizei – muss das sein? Ich alter Mann!“ Aber Sanders ging an ihm vorüber zum Telephon und konnte sich nicht um den Jammern verwirrter Herzen kümmern.
„Unangenehm, höchst unangenehm!“ sagte der Kriminalkommissar von Redberg. „Sehen Sie nur, Herr Sanders, wieviel Personen schon im Zimmer gewesen sind! Man hat so alle Spuren verwischt!“ Aber er stellte zwei Kriminalbeamte ins Haus und trug dafür Sorge, dass das Arbeitszimmer nicht mehr betreten wurde. Sanders kannte die Wohnung bis ins kleinste Eckchen. Er hatte schon als Zwanzigjähriger den alten Brandorff, den langjährigen Freund seines verstorbenen Vaters, oft und gern aufgesucht. Als er dem Kriminalkommissar zur Hand gehen wollte, lehnte dieser nicht gerade unfreundlich ab. „Danke verbindlichst, Herr Rechtsanwalt. Ich werde vielleicht Ihren Rat noch brauchen können, aber vorläufig muss ich sehen, wie ich mich allein zurechtfinde. Wirklich, die Sache ist höchst mysteriös. Der alte Herr geht sonst nie aus dem Haus, neigt, wie Sie sagen, auch zu keinerlei Extravaganzen, und nun ist er plötzlich verschwunden – und noch dazu aus dem innen abgeschlossenen Zimmer! Mysteriös – höchst mysteriös!“ Er beklopfte die Wände, ging zum Fenster, ließ die Jalousie herab und zog sie wieder hoch. Dann sah er aus dem Fenster hinunter: „Nein, hier kann er nicht heraus! – Wie alt, sagen Sie, ist Brandorff? So zweiundsechzig – nein, es ist unmöglich! Er hätte sich unfehlbar die Knochen gebrochen. Da, vor dem Fenster steht freilich ein Baum – aber doch mindestens vier Meter entfernt, man müßte glänzend springen können. Nein, dieser Gedanke ist lächerlich – und außerdem sind die Äste unverletzt. Nein, hier konnte er nicht heraus! Aber, sagen Sie, Herr Sanders, Sie kennen die Wohnung ganz genau – wirklich ganz genau? Und Sie sind überzeugt, dass außer dieser offenen Tapetentür hier sich nirgends im Zimmer etwa eine Geheimtür oder so etwas Ähnliches befindet? Ich bitte Sie, in so einem alten Haus!“
Aber vielleicht nicht so sehr die Tatsache, dass Sanders eine solche Möglichkeit absolut verneinte, als die eigene sorgfältige Untersuchung der Wände überzeugten den Kommissar von der Aussichtslosigkeit dieses Gedankens. Auch nicht eine einzige Stelle klang beim Anschlagen hohl und es gab kein Fleckchen im Zimmer, das nicht abgeklopft wurde. Herr von Redberg machte sich daran, mit Hilfe von Sanders festzustellen, ob vielleicht irgend etwas in der Wohnung fehle, das sonst da war. Irgendeine Entwendung etwa, ein Diebstahl vielleicht war vorgekommen oder gar im Zusammenhang damit eine Gewalttat. Man untesuchte die Gemäldegalerie. Im Regal des Arbeitszimmers stand der Katalog der Sammlung, den Brandorff sorgfältig bis zu den Erwerbungen der jüngsten Zeit, eine Woche vor seinem plötzlichen Verschwinden, fortgeführt hatte. Auch das allerkleinste Bildchen holländischer Maler hing an seinem Platze. Etwas nervös gespannt gingen die Herren dann zur Besichtigung der Edelsteine. Die Schlüssel zu den beiden Glaskästen waren nicht da. Aber man konnte durch das Glas mit Hilfe des Katalogs feststellen, dass kein Finger an die ganze leuchtende Pracht gerührt hatte. „Wissen Sie,“ sagte Herr von Redberg vertraulich zu Sanders, „von Bildern verstehe ich den Deubel was. – Aber Geschmeide – à la bonne heure – ehemaliger Vortänzer bei Hofe, man hat so seinen Blick. So was an Seltenheit ist mir bei einem Privatmann überhaupt noch nicht vorgekommen! Sehen Sie nur, diese gefaßten Perlen hätte selbst die alte Dame Kleopatra – oder Antonius – oder wer’s gerade war von den alten Völkern – nicht in Essig gelegt und gefressen! Nein, und sehen Sie nur – diese beiden Opale – das ist ja das Fabelhafteste, was ich je gesehen habe. Die kleinen Opale sind ja gewöhnlich nicht so wertvoll. Aber diese hier – diese Größe, diese riesige Größe! Fabelhaft, höchst fabelhaft! Sind gar nicht mit Geld zu bezahlen. – Und Sie meinen – unter uns, ganz vertraulich – alles echt? Aber selbstverständlich, selbstverständlich; alter, vornehmer Herr, wird sich doch keine unechten Sachen unter Glas legen!“
Doch Sanders nickte nur langsam und traurig. Kaum hörte er Redbergs letzte Worte. Er dachte an seinen Freund Soltau. Es war toll dies verrückte Zusammentreffen von Zufällen. Denn es waren doch wohl nur Zufälle! Oder etwa – nein, unerhörter Gedanke – weg damit! Aber hier gab er sich plötzlich einen Ruck: wie, er, der Rechtsanwalt Sanders, wollte versuchen, aus Gefühlsduselei gegen den Freund einen Tatbestand zu verschleiern? Er, der kühle, klare Vierzigjährige! Es blieb nichts zu folgern mehr übrig: Soltau hatte seinem Diener den Auftrag gegeben, die Koffer zur Reise zu packen. Er hatte mit Brandorff am Abend einen heftigen Wortwechsel gehabt. In der Nacht war der alte Herr verschwunden – Soltau am anderen Morgen auch. Das „Wie“, die mysteriöse Art, mit der das Verschwinden bewerkstelligt war, interessierte ihn gar nicht. Das mochte vielleicht dem Kriminalkommissar imponieren, aber für ihn, Sanders, kam es gar nicht in Frage. Ihn interessierte nur das „Was“, die Tatsache, dass Soltau bei einem so unerhörten Vorgange offenbar beteiligt war. Und nun fiel ihm ein – hatte er nicht in den letzten Wochen, wenn er Soltau im Klub oder bei Brandorff sah, ihn jedesmal bleich, nachdenklich, einsilbig, verstört und nervös angetroffen? So wie man etwa Menschen findet, die von langer Hand irgendeinen wagnisreichen Plan vorbereiten! Trüb grübelnd verließ er still das Haus, gab Martha noch Anweisungen für Cecilys Wohlergehen; ohne sich von Cecily selbst zu verabschieden, ohne unten im Hausflur den alten Lehnert zu beachten, der sich noch immer über das Eindringen der Polizei entsetzte, stieg er ins Automobil, um in seine Wohnung in der Potsdamer Straße zu fahren. Er wollte nur einen Moment dort verweilen. Gleich mußte er wieder an die Arbeit im Fall Brandorff gehen. Aber das Wichtigste – das Schlimmste: Nachricht von Soltau! Wie sollte man sie bekommen? Gerade der, der alles wissen mußte, der vielleicht Brandorff ... nein, es war nicht auszudenken! Gerade Soltau saß vielleicht jetzt schon in einem behaglichen Eisenbahn-Coupé, irgendeinem fernen Ziele zufahrend!
Und hatte er, Sanders, der Rechtsanwalt in Ehren und Würden, sich nicht einer Verschleierung des Tatbestandes schuldig gemacht, als er dem Kriminalkommissar seine Gedanken über Soltau verschwieg? Aber das Ende war unaufhaltsam, in ganz kurzer Zeit mußte auch die Polizei auf Soltaus Fährte sein! Mit dem schweren, müden Schritt des düster Nachdenklichen stieg er die Treppen zu seiner Wohnung empor. Er schloß auf und durchschritt das leere Bureau, um in seine Wohnung zu kommen. Es war Mittagszeit. Die Angestellten waren zu Tisch gegangen, nur ein seit kurzem engagierter Schreiber machte sich zu schaffen. „Was vorgefallen? „Nein, Herr Rechtsanwalt! Bloß ein Herr ist da, der Sie sprechen will.“ „Sie wissen doch, dass jetzt keine Bureaustunde ist, er soll zur Zeit wiederkommen!“ „Das habe ich ihm auch gesagt, Herr Rechtsanwalt! Aber er ging nicht weg, er sagte, es wäre dringend!“ Ärgerlich riß Sanders die Tür zu seinem Schreibzimmer auf. Aber das Wort blieb ihm in der trockenen Kehle stecken: In seinem Schreibsessel saß, bleich, mit wirrem Haar, zusammengefallen, schlafend – Erich Soltau.
III. Unter Freunden.
Johannes Sanders stand da und sah den Schläfer an. Er stand und wartete. Unwillkürlich griff er mit beiden Händen nach dem Kragen, um sich Luft zu machen, als er Soltau betrachtete. Soltau, den man seit seiner Jünglingszeit nur als tadellos soignierten Kavalier, als überaus peinlichen Menschen kannte, Soltau, der im Korps lange der Renommierfechter gewesen war, der an die Leistungsfähigkeit seines Körpers stets die höchsten Anforderungen gestellt hatte, er saß im Schlafe nun da, eingesunken, mit verfallenem, schmutzigem Gesicht, den flachkrempigen Modehut eingebeult und fleckig in die Stirn zurückgeschoben, das Haar wirr und schlaff im Gesicht, das Hemd zerknüllt und gelb. Sanders mußte sich setzen, die aufregende Spannung hatte ihn erschöpft. Er konnte keinen Blick von dem Schlafenden wenden. Aber der Schläfer wurde bald unruhig; auf einmal schlug er die Augen auf, begegnete Sanders Blick und bewegte die Lippen. Er blieb in der verfallenen Haltung teilnahmlos sitzen und sagte mit einer müden, gleichgültigen, glanzlosen Stimme nur: „Sanders!“ Sanders, der erst nichts sehnlicher gewünscht hatte, als Soltau aufzufinden, ihn mit tausend Fragen zu bestürmen, fühlte sich jetzt, wo er dem unglücklichen Freunde gegenübersaß, nicht imstande, auch nur eine Silbe zu fragen. Er wartete ab. Soltau blieb in seiner Haltung eines gehetzten Tieres sitzen. Stille.
Plötzlich fühlte sich Sanders von einer unendlichen Trauer übernommen. Er empfand – irgendwie mußte er dem Freunde helfen. Leise stand er auf, ging zur Waschtoilette und tauchte ein Hadtuch ins Wasser. Dann nahm er Soltau sacht den Hut vom Kopf, strich ihm die Haare aus der Stirn und wusch ihm leise, vorsichtig, behutsam das Gesicht, wie eine Mutter ihrem Kind. Soltau ließ alles mit sich geschehen. Sanders ging zur Kredenz, schenkte einen Kognak ein und reichte das Glas Soltau. Soltau griff danach und goß den Kognak gierig hinunter. Es war die erste selbständige Bewegung, die er machte. Sanders ergriff seine Hand: „Du hast bei mir nicht zu fürchten, Erich!“ Soltau nickte mechanisch. Auf einmal raffte er sich zusammen. Sein Körper straffte sich, die alte Festigkeit schien wieder auf einen Moment bei ihm zu sein. Aber ebenso plötzlich sank er wieder in sich hinein. Er rang nach Worten. Dann kam es tonlos aus seinem Munde: „Ich kann nicht sprechen, Sanders!“ Sanders saß, ihm mit milder, beruhigender Miene gegenüber. Er gab kein Zeichen von Ungeduld, nur Güte schien jetzt in den Antlitz des sonst so energischen, kurz angebundenen Mannes zu liegen. Er wartete ab. Soltau brachte mit trockener Zunge hervor: „Ich wollte abreisen! – Ich bekam’s nicht fertig!“ Still dachte Sanders: „Es zieht ihn nach dem Tatort zurück – ich kenne das.“ Und er schwieg.
Soltau stand auf und ging matt im Zimmer umher, den Kopf nach der Seite wiegend, wie jemand, der unter einem fürchterlichen Schickalsschlag schweigsam mit sich selbst ringen muss. „Sanders“, sagte er endlich, „du bist so gut!“ Sanders wurde es weich ums Herz. Die Dankbarkeit Soltaus rührte ihn. Doch plötzlich erstarrte in ihm das Gefühl. Dieser Mann, der vor ihm stand, bot das Bild eines Zusammenbruchs nach einer schweren Tat. Sicher hatte er sie begangen, sicher ... sicher ... Und der Gedanke, dass Soltau schuldig sei, wurde plötzlich so fest in Sanders, dass er sich zu einer Überzeugung verdichtete. Er mußte die Wahrheit an den Tag bringen. „Erich“, sprach er und seine Stimme hatte den alten metallischen Klang, „bitte, laß das! Sag’mir, was du weißt!“ Soltau ging im Zimmer auf und ab. „Wozu darüber reden? Ich kann jetzt doch nicht sprechen!“ Sanders fühlte sich ganz kalt werden. „Ich bitte dich,“ entgegnete er hart, „sage mir nicht das! Auf deine Worte kommt alles an!“ Soltau ging mit mattem Trotz umher. „Du mußt doch merken, dass ich jetzt auch nicht im geringsten die Stimmung habe!“ Sanders fühlte eine kalte Wut in sich aufsteigen. Wie wenig, merkte er, hatte er doch Soltau gekannt! War das der anständige Mensch, mit dem er befreundet war? Dieser da beging wahrscheinlich die tollste Verruchtheit – Gott weiß, was er aus Brandorff gemacht hatte und aus welchem Grunde – und sprach jetzt schlapp von Stimmung!
„Soltau,“ sprach er drohend, „das ist unerhört! Wie kannst du mir mit einer so läppischen Entschuldigung kommen!“ Soltau wand sich : “Es ist nicht nötig – nein – wozu soll ich noch reden!“ „Wozu?“ donnerte Sanders. „Zum Teufel ist es nötig! Kurz und schnell: was weißt du von Brandorff – was hast du gemacht?“ Ein maßloses Erstaunen glitt über Soltaus Züge, und erregt trat er einen Schritt vor: „Brandorff? Was meinst du? Jetzt verstehe ich dich nicht!“ Und als er das hartknäckige Gesicht von Sanders sah, fast flehend: „Ich verstehe dich wirklich nicht – mein Ehrenwort!“ Sanders stahlhart: „Deine Ehre!“ „Johannes!“ schrie Soltau. „Du, der letzte, zu dem ich mich flüchte – du bist der erste, der mich beschimpft.“ Sofort betreute Sanders seine ihm sonst so ungewöhnte Handlungsweise. Er setzte sich mit abweisender Miene. „Bitte,“ sagte er trocken, „sprich offen zu mir! Wie konnte ein Mann von deiner Lebensstellung ein so raffiniertes Verbrechen begehen?“ „Aber ich bin doch kein Verbrecher, „ stöhnte Soltau, „ich bin nur ein Unglücklicher!“ „Soltau, werde nicht sentimental! Das tun alle Leute in deiner Lage!“ Soltau stand einen Moment starr da. Plötzlich griff er nach seinem Hut auf dem Tisch. Seine Stimme war kühl: „Ich danke dir außerordentlich für deine überraschende Freundlichkeit gegen mich. Du gestattest, dass ich jetzt gehe!“ „Nein,“ rief Sanders, „ich gestatte nicht, dass du jetzt gehst!“ Er stellte sich breit und unüberwindlich mit dem Rücken an die Tür: „Du wirst nicht eine Sekunde eher gehen, als bis du mir gesagt hast, was du mit Brandorff gemacht hast!“
Soltau mit wütendem und völlig ratlosem Gesicht: „Zum Donnerwetter, geh’ von der Tür weg, ich weiß nicht, was du von mir willst! Niemand hat mit Brandorff etwas gemacht!“ Sanders: „Lügner!“ „Geh’ weg, oder ich fahre dir an die Kehle!“ schrie Soltau. „Das glaube ich – das ist ja das einzige, was du kannst“, rief Sanders. Da brach Soltau völlig zusammen. Die geballten Fäuste fielen schlaff herab, das wutverzerrte Gesicht sank in tiefe Falten. „Ich verstehe nicht,“ stotterte er – „ich weiß nicht, was du willst! Ich weiß absolut nichts mehr!“ „Gut!“ sagte Sanders jetzt ganz ruhig. „Erlaube mir, einige Fragen zu stellen.“ „Mache mit mir, was du willst!“ stöhnte Soltau, ganz und gar erschöpft. „Bitte, nimm ruhig wieder Platz!“ forderte Sanders in geschäftsmäßigem Ton auf. „Und nun gib mir Auskunft: Du warst gestern abend um ein halb neun bei Brandorff. Stimmt das? Ihr gingt zuerst ins Billardzimmer. Später habt ihr euch ins Arbeitszimmer zurückgezogen. Ist das richtig? – Gut! Der Diener hat den Tee gebracht, einer von euch hat sein Glas halb, der andere ganz ausgetrunken! Richtig? Nun, ich sehe an deinem erstaunten Gesicht, dass du dich besinnt. Dann habt ihr beide im Arbeitszimmer ein sehr aufgeregtes und heftiges Gespräch miteinander.“
„Das geht dich nichts an!“ schrie Soltau aufspringend. „Das geht mich sehr viel an“, sagte Sanders ruhig und drückte Soltau in den Sessel zurück. „Nach dieser heftigen Auseinandersetzung hast du Brandorff aus irgendeinem mir unbekannten Grunde beseitigt!“ Soltau reckte sich im Sessel hoch. Einen Moment Stille, einen Moment nur. Aber dieser Moment schien Sanders ein ganzes Leben lang zu dauern. Er hörte sein Blut in den Ohren rauschen. Da sagte Soltau mit einer Stimme, als käme er aus einem kalten Bade: „Sanders – du bist verrückt! Ich habe nicht geglaubt, dass ich heute noch lachen werde, wahrhaftig nicht!“ Beide schienen jetzt einander völlig ruhig gegenüberzusitzen. „Ich bitte dich, Sanders,“ sprach Soltau, „sage mir, warum fragst du mich – nein – sage mir, was redest du da von Brandorff?“ „Vielleicht dürfte dir nicht ganz unbekannt sein,“ entgegnete Sanders, „dass Brandorff verschwunden ist – sieh’mich nicht so groß an! – aus seinem Zimmer verschwunden – und das Zimmer war von innen abgeschlossen! – Bitte,“ unterbrach er Soltau mit einer Handbewegung, als dieser sprechen wollte, „du weißt ebensogut wie ich, dass Brandorff sein Haus nie verlassen hat – und am wenigsten in der Nacht. Es ist ein Verbrechen geschehen – ein ganz raffiniertes, verruchtes Verbrechen.“
Soltau lehnte sich mit weit aufgerissenen Augen in seinen Stuhl zurück. Mit der unsicheren Stimme dessen, dem etwas ganz Überraschendes, Verwirrendes begegnet, und der sich zu fassen sucht, sagte er: „ Das ist unglaublich! Ein Verbrechen an Brandorff! Du sagst mir, Brandorff ist verschwunden? – Laß mich nachdenken, Sanders!“ Der Gedanke durchzuckte Sanders: Sollte der da doch unschuldig sein? Sollte er wirklich gar nichts von dem Rätsel wissen? Konnte das maßlose Straunen Soltaus Verstellung sein? Gab es denn einen solchen Lebenskomödianten auf der Welt, dass ihn selbst das durch Jahre geschärfte Auge des Freundes nicht durchschauen konnte? Und mit einer gewissen Erleichterung und in plötzlich herzlichem Tone sagte er: „Aber Soltau, es ist ja ganz einfach: Wenn du gar nichts vom Verschwinden Brandorffs weißt, so sage mir doch klipp und klar, um was sich eure Auseinandersetzung gedreht hat. Du bist ja dann sofort entlastet – und die ganze Geschichte ist für dich erledigt. Geh’, sei nicht böse, ich bitte dich um Entschuldigung, dass ich auf einen so unwürdigen Verdacht auch nur entfernt gekommen bin!“ Soltaus Gesicht wurde auf einmal ganz bleich. Er beugte sich im Sessel vor, dass er fast zusammenzuknicken schien. Seine Finger griffen aneinander und krampften sich gewaltsam zusammen. Mit verzerrtem Anlitz, heiserer Stimme sprach er:
„Sanders, ich kann es nicht sagen! Sanders, ich gebe dir mein heiligstes Ehrenwort, was ich auch sonst für ein Lump gewesen sein mag, von Brandorffs Verschwinden weiß ich nichts! – Es wäre lächerlich, zu schwören, aber ich weiß es jetzt nicht anders: Ich schwöre dir, ich weiß von Brandorff nichts!“ Sanders, mit gütiger Stimme, wie wenn er ihn streichelte: „Soltau, sag’es mir, deinem alten Freunde! Denk’ doch, du bist dann auch für die andern ganz entlastet! Bitte, sage mir euer Gespräch!“ Soltau stand auf. „Sanders, dein Verhör, denn anders kann ich es ja nicht nennen, hat mich vollständig zerstört. Ich bitte dich, laß mich jetzt gehen. – Ich bin unschuldig! – Über das Gespräch mit Brandorff wird niemand auf der Welt eine Auskunft von mir bekommen!“ „Niemand?“ „Niemand!“ „Geh’!“ sagte Sanders und öffnete ihm die Tür. Sanders blieb allein zurück, wie zerschlagen von der Ergebnislosigkeit des aufregenden Zwiegesprächs. Er wußte, es war ganz erfolglos, in Soltau dringen zu wollen, wenn dieser Widerstand entgegensetzte. Er kannte den Eigensinn und die Hartnäckigkeit Soltaus zu gut, um nicht zu wissen, dass dieser sich von einmal gefaßten Vorsätzen nicht abbringen ließ. Nein, von Soltau war nichts zu erfahren. Aber er mußte doch wieder in die Margaretenstraße. Herrgott, wie konnte er das nur vergessen: Brandorff! Um den handelte es sich ja eigentlich! Hatte er sich wirklich durch die Spannung, in die ihn der Wortwechsel mit Soltau versetzt hatte, vom eigentlichen Ziel abbringen lassen können? „Ziel“, das war doch überhaupt kein passendes Wort! Es handelte sich doch hier nicht um die interessante Auflösung eines Rätsels, wie vielleicht in einem der jetzt so modernen Kriminalromane! Es handelte sich doch um die allerwichtigste, allerursprünglichste Menschenpflicht. Er mußte doch unter allen Umständen Cecily beistehen! Voller Angst sah er vor seinem geistigen Auge die Gestalt des alten Brandorff aufwachsen, sah ihn plötzlich von fürchterlichen, undeutlichen Gestalten umgeben – Mörder- Mörder! Plötzlich verschwanden die Gestalten, und der schmächtige Körper Brandorffs lag am Boden, in einer roten, dicken Blutlache – aus der riesigen Wunde am weißen, bleichen Schädel quoll ein wilder, unaufhaltsamer Blutstrom, der allmählich die verkrümmte Leiche umfloß, immer höher und höher stieg. Das trübrote Blut überschwemmte die verzerrten Glieder, schon versank der Leichnam immer mehr und mehr darin, nur die letzten Spuren ragten noch aus dem rotschäumenden Blutmeer, jetzt – halt, halt, nur nicht das! Aufhören, aufhören mit diesen fürchterlichen Phantasien!
Sanders goß hastig ein Glas Wasser hinunter. Wie diese Vorgänge doch die Nerven schwächten! Er wusch sich lange in kaltem Wasser. Dann machte er sich schnell fertig, um in die Margaretenstraße zu fahren. Eben setzte sich im lebhaften Sommernachmittagsgewühl der Potsdamer Straße das Automobil ratternd und knallend in Bewegung, als er vom Trottoir seinen Namen rufen hörte. Er sah auf, es war Herr von Mohl, der mit ihm und Soltau im Westen-Klub war. Sanders war nicht übermäßig erfreut, dass ihm der elegante Plauderer, mit dem man wohl zu anderen Zeiten angenehme Abende gern verbrachte, gerade jetzt in den Weg lief. Aber Herr von Mohl winkte ihm so dringend zu, dass Sanders das Automobil wieder halten ließ, austieg und Mohl die Hand schüttelte. „Hören Sie mal, lieber Sanders, „ sagte Herr von Mohl, „was machen Sie denn nur? Sie lassen sich ja gar nicht blicken! Sie haben uns nun schon einen geschlagenen Monat gröblich vernachlässigt!“ Dabei faßte er Sanders so herzlich und vertraulich unter den Arm, dass dieser merkte, so bald werde er hier nicht loskommen. Er sagte ein paar Worte von „entsetzlich zu tun“ und „Geschäften“. Aber Herr von Mohl entgegnete ihm eindringlich: „Nein, mein Lieber, so kommen Sie nicht los! Sie haben uns doch auch Ihren Freund Soltau entführt! Der kommt nun auch schon seit einer Woche nicht mehr in den Klub! Wenn das so weitergeht, dann werde ich bald meine Abende allein verbringen müssen!“ Sanders war befremdet: „Wie meinen Sie, Soltau war schon seit einer Woche nicht mehr im Klub? Er ist doch sonst ganz regelmäßig abends hingegangen, auch wenn ich nicht da war!“
„Nun, nun, verstellen Sie sich nur nicht, „ scherzte Mohl, „ Sie waren doch sonst unzertrennlich!“ „Nein,“ verteidigte sich Sanders , „diesmal weiß ich wirklich von nichts!“ „So,“ versetzte Mohl, „ich dachte bestimmt, Sie wüßten, wo Soltau bleibt. Kommt er heute abend? Ich soll ihm nämlich Revanche geben!“ „Ah, wieder gespielt?“ fragte Sanders leichthin. „Ja,“ nickte Mohl, „ich warte schon seit einer Woche auf ihn. Wissen Sie, ganz unter uns,“ setzte er leise und in vertraulicher Freundschaft hinzu, „er hat ja auch noch seine Schulden von neulich bei mir. Na, bei unserm Soltau hat das nichts zu bedeuten!“ Sanders hemmte seinen Schritt plötzlich, mit einem Ruck. Er fühlte es kalt über seinen Rücken laufen. Hastig riß er seinen Arm aus dem Mohls, ließ den stehen, wo er stand, rannte mitten über die flimmernd belebte Straße. Über einen großen Hund, der ihm wie eine gelbe Kugel durch die Beine schoß, fiel er beinahe, raffte sich wieder auf, sprang in sein Automobil und konnte dem Chauffeur nur noch zukeuchen: „Margaretenstraße!“ Dann saß er atemlos und schweißtriefend im dahinflitzenden Wagen, der Wind strich durch sein flatterndes Haar. Und er murmelte: „Spielschulden? – Er ist es doch – er ist es doch! Dieser Verbrecher!“
IV. Die Polizei spricht.
Sanders langte in Brandorffs Hause an, voll Ungewißheit, voll Angst, voller verwickelter Empfindungen im Herzen, die sich unablässig aufs neue kreuzten. Zögernd schritt er die Treppe hinauf, bei jeder Stufe verlangsamte er den Schritt ein wenig mehr. Was würde er jetzt im Hause finden? Welche neue Überraschung harrte seiner? Hatte man Spuren von Brandorff, hatte man Spuren von Soltau gefunden? Soltau, der Freund! Aber war nicht der alte Brandorff auch sein Freund gewesen? Und bestimmt, es ließ sich nicht mehr leugnen: Soltau hatte mit dem Verschwinden des Alten zu tun! Hier stand Freund gegen Freund! Wie sollte man sich retten vor dem Kampf gegen den Freund? Durfte man es überhaupt? Nein – hier galt es, kalt und klar zu denken, nicht zu trauern! Aber wenn nun Soltau doch unschuldig war? – Unmöglich, es lag ja offen: Man nehme einmal an, es handle sich nicht um die beiden Freunde Brandorff und Soltau, sondern um zwei wildfremde Personen A und B. A ist plötzlich spurlos verschwunden. Es stellt sich heraus, dass zuletzt B längere Zeit mit ihm zusammen war. B hat, ohne gesehen zu werden, A’s Haus verlassen. Man weiß, dass B mit A ein lautes, erregtes Gespräch hatte. B weigert sich, über den Inhalt des Gesprächs etwas mitzuteilen, es stellt sich aber heraus, dass er heimlich Spielschulden hat. Leuchtet es nicht ohne weiteres ein, dass B von A Geld haben wollte und A sich geweigert? Plötzlich verließ Sanders diese Rechnung mit mathematischen Größen. Er stellte sich die Szene im Kabinett vor, wie Soltau heftig erregt auf den Alten einsprach, Geldforderungen stellte, wie der alte Brandorff, der an peinlich sorgsame Lebensverhältnisse gewöhnt war, sich weigerte, wie das Gespräch immer erhitzer wurde. Soltau will mit Gewalt etwas haben, der Alte verweigert es mit Gewalt. Soltau nimmt es, was es nun auch war, Geld oder eine geldwerte Kostbarkeit; der Alte will es verhindern: Gewalt gegen Gewalt, aber die Körperkraft des Jüngeren muss schließlich siegen. Soltau schlägt den Alten nieder, und - - nein, nein, es war nicht auszudenken! Warum kam er aber zu ihm, zu Sanders? Was geschah mit Brandorffs Leiche? Oder aber – ein fürchterlicher Gedanke – sollte etwa dieses Verbrechen vorbereitet sein? War Soltau etwa bewußt zu Werke gegangen? Hatte er alles darauf angelegt, den Alten verschwinden zu lassen?
„Ah, Herr Rechtsanwalt Sanders!“ rief ihm plötzlich eine Männerstimme zu. Er sah auf: Es war der Kriminalkommissar von Redberg. Ein Schreck durchzuckte ihn – waren diese Leute etwa auch schon auf Soltaus Spuren? Er bezwang mit Gewalt seine Erregung. „Nun, haben Sie etwas gefunden, Herr von Redberg?“ fragte er scheinbar ruhig. Herr von Redberg machte eine verschlossene Miene: „Ja, ich darf eigentlich nichts sagen, Sie wissen, Amtsgeheimnis!“ „Bitte sehr!“ entgegnete scheinbar gleichgültig Sanders. Aber der Kommissar konnte doch vor dem Gleichmute des Rechtsanwalts nicht ganz an sich halten. „Hören Sie,“ sagte er, „hören Sie, Herr Rechtsanwalt, Sie sind ja eine amtliche Person – wir sind also sozusagen Kollegen ... sozusagen!“ Sanders’ ruhige Miene fragte deutlich: „Nun, und?“ „O Pardon!“ rief plötzlich der Kriminalkommissar. „Ich habe ja ganz vergessen, dass auch Sie uns bei der Affäre behilflich sein wollen! Ja, interessanter Fall, die Affäre da!“ Es berührte Sanders unangenehm, die Angelegenheit, die ihm so zu Herzen ging, als „Affäre“ und „interssanten Fall“ bezeichnet zu sehen. Aber er verhielt sich ruhig und fragte höflich: „Sagen Sie, Herr Kommissar, haben Sie schon Spuren des Mörders?“ „Spuren des Mörders?“ entgegnete Redberg schleppend, während er den blonden Schnurrbart zwirbelte. „Mörder? – Hm, Mörder? – Wissen Sie, Herr Rechtsanwalt, ich glaube, hier git es gar keinen Mörder!“ „Was?“ fuhr Sanders auf. „Nun, Herr Rechtsanwalt,“ meinte Redberg lächelnd, „ich will Ihnen mal was sagen: Soviel ich sehe, ist hier überhaupt kein Verbrechen geschehen!“ „So haben Sie Brandorff gefunden?“ rief Sanders erregt.
„Brandorff?“ erwiderte der Kommissar. „Brandorff? – Hm, sehr geschickt – sehr geschickt!“ „Ja, was meinen Sie denn?“ rief Sanders, der sich gar nicht mehr halten konnte. „Was ich meine? – Was ich meine? – Nun, ich meine, die ganze Sache ist ein famoser Schwindel! Aber interssant, sehr interessant!“ „Schwindel?“ fragte Sanders ganz fassungslos. „Schwindel!“ bestätigte der andere. „Erlauben Sie, das verstehe ich nicht“, sagte nach einer kurzen Pause Sanders. „Meiner Ansicht nach muss hier ein Verbrechen geschehen sein!“ „O, ich weiß Ihre Ansichten vor Gericht zu schätzen, Herr Rechtsanwalt,“ entgegnete höflich Redberg, „aber in der Untersuchung, was die Untersuchung von Spuren betrifft, da sind Sie – bitte um Verzeihung – doch wohl nicht Fachmann!“ „Aber so erklären Sie mir nur!“ rief Sanders. „Gern“, sagte Redberg verbindlich. „Sehen Sie, ich habe mich mal zuerst nach Brandorff genau erkundigt. Aber bitte, kommen Sie doch hinein, wir können unmöglich auf dem Treppenflur verhandeln.“ Sie gingen in die Bibliothek. Redberg setzte sich ruhig an den großen Tisch inmitten des kahlen Zimmers und zwirbelte selbstbewußt am Schnurrbart. Sanders ging in Erregung und voll sich jagender Gedanken auf und ab. „Na, und also, Herr Rechtsanwalt,“ sagte der Kommissar beinahe gemütlich, „da habe ich erfahren, dass der alte Herr gar kein so ruhiger Mann war, wie Sie zu glauben scheinen.“ „Aber erlauben Sie,“ warf Sanders dazwischen, „ich selbst weiß ganz genau, dass er seit Jahren kaum einen Schritt aus dem Hause gemacht hat. Jedenfalls nie in der Nacht!“
„Ja, ja, das mag wohl sein,“ erwiderte der Kommissar, „dagegen habe ich auch gar nichts gesagt. Übrigens, was vor allem gegen ein Verbrechen spricht: es fehlt nichts, in der ganzen Wohnung nichts! Es ist nicht die geringste Kleinigkeit abhanden gekommen. Ich habe das mit Fräulein Brendorff und den beiden Dienstleuten genau festgestellt!“ „Aber vielleicht hat Brandorff etwas bei sich getragen, größere Summen in der Tasche gehabt?“ entgegnete Sanders. „Natürlich habe ich mich auch danach erkundigt“, sagte Redberg. „Nein, das war gar nie seine Gewohnheit. Er hatte auch keinen Grund dazu, weil er eben so selten fortging. Alles, was er an barem Gelde oder an Papieren im Hause hatte, befand sich immer im Geldschrack, der im Schlafzimmer steht. Das Schlafzimmer war ja unberührt. Ich habe also den Geldschrank untersucht – auch nicht die geringste Spur von einer fremden Hand hat sich daran gezeigt. Wir haben zu Arnheim geschickt und jemand kommen lassen, der den Geldschrank öffnen sollte. Der Geldschrank ist ein altes Modell und bot gar keine Schwierigkeiten. An der Tür hing innen eine Liste des im Schrank vorhandenen Bestandes: Es fehlte nicht ein Papierschnitzelchen. Aber etwas ganz anderes habe ich gefunden, was mir zu zeigen scheint, dass der alte Herr doch ein sehr unruhiger Kopf ist, dem man eigentlich alles zutrauen kann. Bitte, sehen Sie selbst!“ Er griff in die schwarze Aktenmappe, die er vor sich auf dem Tisch liegen hatte, und holte ein in braunes, biegsames Saffianleder gebundenes Buch hervor, das mit einer silbernen Schnalle verschlossen war. Sanders nahm es in die Hand, und ohne die Schnalle zu öffnen, sah er Redberg zweifelhaft an: „Ich begreife noch nicht recht, was das hier mit dem Verschwinden Brandorffs zu tun haben soll.“
„Bitte,“ erwiderte Redberg, „lesen Sie nur darin; Sie werden dann ebenso wie ich zur Überzeugung kommen, dass Brandorff ein ganz phantastisch angelegter Mensch war, der allen Einfällen seines Hirns ohne weiteres nachzugeben pflegte. – Im Hause fehlt nichts, ein Raub liegt also nicht vor. Spuren, die auf Gewaltsamkeiten hindeuten, sind auch nicht da. – Ich habe nun zwar den Diener John verhört, und der hat mir von einem angeblichen Streit erzählt, den Brandorff noch gestern abend mit seinem Neffen gehabt haben soll – wie heißt er doch gleich? Warten Sie, mein Notizbuch – ah, richtig: Soltau. Aber das scheint mir bedeutungslos. Nein, der alte Brandorff war, nach diesem Buch zu urteilen, ein sehr schlauer und recht phantasiebegabter Herr. Meine Überzeugung ist: er hat sich ganz allein davongemacht – weiß der Teufel wie! Aber das geht mich nichts an. Ich habe also gar keinen Grund, mich amtlich weiter um die Sache zu kümmern. In die Privatangelegenheiten des Herrn Brandorff darf ich mich nicht hineinmischen. Ich habe hier im Hause gar nichts mehr zu suchen.“ „Wissen Sie,“ fuhr Redberg fort, „die Sache ist ja sehr interessant! Glänzendes Schwindeltalent hat der Alte – unter uns, natürlich ganz unter uns! So was – sich herauszumachen aus einem Zimmer, das von innen zweimal verschlossen ist! Ich muss Ihnen ja offen sagen: es reizt mich direkt, der Sache auf den Grund zu gehen – aber ich darf nicht. Ich darf doch nicht! Mein Amt ist hier zu Ende! Und wenn ich Sie bitten darf, lieber Herr Rechtsanwalt, behalten Sie alles, was ich Ihnen im Vertrauen gesagt habe, bei sich. Nur meine amtliche Erkärung gilt hier, dass ich die weitere Untersuchung des Falles von Staats wegen ablehnen muss, weil es sich hier offenbar um private Familienvorfälle handelt. Und die gehen uns nichts an! Adieu – ich empfehle mich!“
Sanders saß allein in der Bibliothek, das braune Buch in der Hand, nachdenklich und verwirrt. Dieses Buch sollte also die Lösung des Rätsels enthalten – oder sie doch wenigstens nahelegen? Und Soltau war wirklich unschuldig, ganz unschuldig? Aber warum verheimlichte er dann die Gründe des Streites mit Brandorff, und was hatte diese ganze tolle Aufregung und Verwirrung Soltaus dann zu bedeuten, die schlaflose Nacht und – o, vor allem, vor allem – dass er daran noch nicht gedacht hatte! – er schlug sich vor dem Kopf – die reisefertigen Koffer! Nein, nein, die Unschuld Soltaus lag doch nicht so klar zutage! Und die Ansicht des Kriminalkommissars, dass das rätselhafte Verschwinden Brandorffs nur ein von diesem selbst in Szene gesetzter Schwindel war, diese Ansicht schien doch sehr oberflächlich. Noch dazu, wie sollte dieses alte Saffianbuch, das doch mindestens dreißig bis vierzig Jahre in sich hatte, Auskunft über das gestrige Verschwinden Brandorffs geben! Nein, das war sinnwidrig. Und doch, ganz sinnlos konnte dieser im Amt erfahrene Mann ja nicht sprechen. Sollte das Buch vielleicht irgendeinen Anhalt geben – auch nur den geringsten? Langsam schob er von dem biegsam matten Einband die Silberschnalle zurück. Das Buch öffnete sich. Als der Deckel zu beiden Seiten auseinanderfiel, sah man, dass es gar kein richtiges Buch war. Viele vergilbte Blätter, unregelmäßig im Format, raschelten aneinander, jedes mit einem grauen Seidenfaden an dem Rücken des Deckels lose angeheftet. Hinter dem letzten Blatt war noch ein wenig Raum vorhanden, als wäre der Platz zur Aufnahme neuer Blätter freigelassen. Eben schickte Sanders sich an, sich in das Buch zu versenken, als Cecily ins Zimmer trat. Sie schien nicht so niedergeschlagen wie am Vormittag.
„Nun, Herr Rechtsanwalt, hat die Polizei etwas gefunden?“ fragte sie. „Wenig, sehr wenig, Fräulein Cecily,“ sagte Sanders zögernd, „oder richtiger gesagt, gar nichts.“ „Gar nichts? Nichts?“ „Nein, nichts“, erwiderte Sanders. „Ich weiß nicht ... der Kommissar kommt zu höchst eigenartigen Schlüssen, die ich durchaus nicht zu den meinigen machen kann, er meint ... ich kann es Ihnen nicht so sagen“. „Ach bitte! Also der Kriminalkommissar ist der Meinung“ ... „Zunächst, dass kein Verbrechen vorliegt und – und“ „Bitte“ „Kurz und gut, er meint, dass Ihr Papa sich vielleicht selbst und ganz freiwillig aus dem Hause entfernt hat.“ „Aber das ist doch purer Unsinn!“ „Ich denke dasselbe. Doch, was soll man machen?“ „Ja, dann müssen wir selber suchen!“ rief Cecily mit größter Entschiedenheit. „Ja,“ sagte Sanders wie zu sich selbst, „wir müssen selber suchen, Sia haben recht.“ Er erhob sich mit einer Bewegung, als wollte er sein Werk sofort beginnen. Doch plötzlich besann er sich. „Der Kommissar übergab mir da ein Buch,“ sagte er, „das anscheinend Ausschlüsse über das Leben Ihres Vaters gibt. Er meint, die Aufzeichnungen seien so absonderlich und so exzentrisch, dass er geneigt ist, sie mit dem Verschwinden Ihres Vaters in Zusammenhang zu bringen. Wissen Sie etwas von diesem Buche?“ Cecily warf einen flüchtigen Blick auf die vergilbten Blätter. „Ach, das alte Tagebuch! Ja, ich kenne es. Viel wird er allerdings daraus nicht entnommen haben. Haben Sie es schon durchgesehen?“„Ich? Nein.“ „Dann lesen Sie es. Meine Hoffnungen sind gering. Ich glaube nicht, dass die Schlüsse der Polizei richtig sind.“ Sanders legte das Buch vor sich hin, und seine Augen begannen die Zeilen zu überfliegen.
V. Vergilbte Blätter.
Auf dem gelblich angehauchten Velinpapier, das auf die Innenseite des Deckels geklebt war, stand mit großen, energischen Buchstaben, deren Tinte von der Zeit schon fast braun war:
Paris, den 9. Juni 1876.
Mit mir, meiner Kraft und allen Teufeln. Heute fange ich an!
Sanders hob vorsichtig die gehefteten Blätter heraus und legte sie vor sich auf den Tisch, ungeduldig vor Erwartung, während Cecily mit kühler Ruhe ihm zusah. Sanders las jetzt laut und langsam die Blätter hintereinander:
Paris, den 10. Juni.
Er scheint nicht zu wollen. Ich habe ihn bei seinem Ehrgeiz zu fassen gesucht. Hatte wenig Glück damit. Seine Zurückhaltung ärgert mich. Abends. Verdammt schlauer Hund, habe ihn unterschätzt. Meine zukünftige Existenz steht in Frage. Muss ihn anders nehmen, aber wie?
Paris, 11. Juni.
Schlaflose Nacht gehabt. Zu keinem Resultat gekommen. Er ist so schlau, entschlüpft mir immer wieder. Mache jetzt noch einen Versuch. Abends. Glänzend geglückt. Habe ihn kurz entschlossen bei seiner Habgier gepackt. Er hätte mich ebensogut hinauswerfen können. Nahm meinen Vorschlag, die Sache zu teilen, mit gröter Ruhe auf. War von diesem Augenblick an seiner sicher.
Paris, 20. Juni.
Vorläufig alles ins Wasser gefallen. Sein Amt steckt ihm noch zu sehr in den Knochen. Im entscheidenden Moment weigerte er sich. Behauptet, unheilvolle politische Verwicklungen dadurch hervorrufen zu können. Habe augenblicklich kein Geld mehr. Heute mit ihm bei Brébant gegessen. Morgen werde ich meinen letzten Frank sorgsam einteilen müssen. Darf ihn natürlich nichts merken lassen. Oder habe ich ihm vielleicht noch zu wenig geboten? Nachts. Ich kann nicht schlafen. Sollte alles zu Ende sein? Man muss es durchführen. Ich habe mir nun einmal in den Kopf gesetzt, ein reicher Mann zu werden, dadurch, dass wir beide jene Bewegung unterstützen. Ich werde morgen doch noch einen Versuch mit M. machen. Die Leute vom Miz. müssen mir für morgen etwas geben. Ich werde M. in ein Ballokal am Montmartre führen. Vielleicht kann ich ihn da bestimmen.
Paris, 22. Juni.
Großartig! Im „Moulin“ habe ich ihn herumbekommen. Mein Auftraggeber war auf meinen Wink gleich in der Nähe, aber M. sagte noch, als Attaché dürfe er nicht. Es ist sehr heiß. M. tanzt mit einer Menge Mädchen. Ich gieße ihm Sekt ein und stelle ihm den Orientalen vor, beinahe, ohne dass er es merkt. Er ist sogar sehr vergnügt und klopft ihn auf die Schulter, geht auch mit mir und dem Orientalen in dessen wunderbar und phantastisch mit Teppichen ausgeschmückte Wohnung. Unser Wirt gibt M. Zigaretten, und M. wird in seiner Hand wie ein kleines Kind. Welch eine Macht hat doch dieser Mann! Aber seine Zigaretten zu rauchen hüte ich mich: ich will meinen klaren Kopf behalten. M. verspricht alles und gibt sein Ehrenwort. Eine schwere Last fällt mir vom Herzen. Ich habe es also erreicht! Endlich!
Paris, 9. Juli.
Wieder ein Monat um. Früher hätte ich die Sekunden der Tage gezählt. Jetzt ist mir dieser Monat, seitdem ich meine neue Karriere vor mir habe, vergangen wie im Fluge. Ich sehe mit Bewunderung aus meinen Aufzeichnungen, dass gerade vor vier Wochen die Affäre begann. Ich kann ganz zufrieden sein; es macht sich. M. war in den ersten Tagen nach seiner Zusage sehr verstört und schweigsam. Ich erlaubte mir, ihn sacht an sein Ehrenwort zu mahnen. Er fuhr wild auf: daran brauche ihn niemand zu erinnern. Seitdem gehört er mit Leib und Seele zu den Leuten vom Miz. Er ist ihr tägliches Mitglied. Mich sieht er seit jenem Tage mißtrauisch und feindselig an, wenn er meint, dass ich ihn nicht beobachte. Ich glaube, er wird es mir innerlich nie vezeihen, dass ich ihn an jenem Abend verleitet habe, ohne eigene Initiative Versprechungen zu geben, die er nüchtern nicht geben wollte. Äußerlich verkehren wir aber natürlich immer weiter in demselben scheinbar herzlichen Ton.“
Sanders hob den Kopf von den Blättern. Er sagte zu Cecily, die mit einer merkwürdig kühlen Ruhe dasaß: „Und Sie, Cecily, was halten Sie davon?“ Sanft, aber energisch erwiderte Cecily: „Wenig – fast nichts! Ich sagte Ihnen schon, Sanders, dass ich diese Aufzeichnungen kenne. Wenige Tage vor dem Verschwinden meines Vaters war ich bei ihm, als er dies alte Tagebuch aus seinem Schreibtisch in den Schrank legen wollte. Der Einband gefiel mir. Ich bat ihn, es mir zu zeigen, und er gewährte mir schweigend. Ich durchblätterte das Buch und durchflog die Seiten. Aber es ist nichts in meinem Gedächtnis haften geblieben, von dem ich glauben könnte, es habe Bezug auf das Verschwinden meines Vaters. Soviel ich mich erinnere, reichen doch diese unbestimmten Aufzeichnungen Jahre zurück. Wissen Sie, Sanders, mit solchen Dingen wird eine Frau nie etwas anfangen können. Das sind zu tote, abstrakte Hirngespinste. Ich bin überzeugt, wenn ich der Spur meines Vaters folgen werde, so wird es durch meinen Instinkt geschehen. Irgend etwas Lebendiges, ein Mensch wird dahinterstecken!“ Aber Sanders war nicht einverstanden. „Es ist merkwürdig,“ sagte er, „wie drei Menschen, Sie, der Kriminalkommissar und ich, über dieselbe Sache verschiedener Meinung sein können! Sie halten gar nichts von der Bedeutung des Tagebuchs. Der Kriminalkommissar sagt, es zeige Ihren Vater von einem Chrakter, dass er sehr wohl selbst sein Verschwinden bewerkstelligt haben könnte. Und ich, der ich das letztere nicht glaube, ich bin von der Wichtigkeit des Tagebuchs überzeugt. Sehen Sie, ich, als Rechtsanwalt, bin gewohnt zu denken, dass nichts in dem Leben eines Menschen außer Beziehung zu seinem Charakter steht und dass die Kenntnis seines Charakters nötig ist zur Beurteilung aller seiner Handlungen. Und ich meine, dass in einem so ungewöhnlichen Fall wie diesem auch die geringste Kenntnis seiner früheren Handlungen von Nutzen ist. Wer weiß, wie das, was vor dreißig Jahren geschehen ist, mit den Begebnissen des heutigen Tages zusammenhängt.“ Sanders schwieg und sann eine Weile nach. Dann las er weiter:
"Marseille, 15. Juli.
Ich habe es durchgesetzt, dass M. Urlaub nimmt. Er sagt, er mache eine Erholungsreise. In Wirklichkeit ist es mir klar geworden, dass, wenn bei der Sache etwas herausschauen soll, wir beide persönlich herumfahren müssen. Ich habe ihn bewogen, sich von den Miz Geld für uns beide geben zu lassen. Die „Montjoye“, ein Mittelmeerdoppelschraubendampfer, fährt übermorgen herunter. Wir stehen schon auf der Passagierliste. Angeblich Vergnügungsfahrt ins Mittelmeer. M. ist jetzt ganz bei der Sache.
An Bord der „Montjoye“ 17. Juli.
Abends. Wir sind in unseren Kojen. Das Schiff hat sich langsam in Bewegung gesetzt. M. stand lange mit mir an Deck, und wir schauten hinüber zu den Lichtern des langsam in die Nacht entgleitenden Marseille. Jetzt endlich sind wir auf dem Wege, der nicht mehr unbeschritten gemacht werden kann. Jede Umdrehung der Schiffsschraube bringt uns unserm Ziel und unserm erhofften Besitz näher. M. ist offenbar ganz heiter. Nur scheint er gegen mich ein wenig mißtrauisch zu sein. Morgen müssen wir doch endgültig den Plan bis ins kleinste ausarbeiten.
An Bord, 19. Juli.
Das Meer trägt uns noch zwei Tage. Es ist spiegelglatt und von einer schimmernden Durchsichtigkeit. M. und ich reden wenig miteinander, jeder ist zu sehr mit sich beschäftigt. Wir verkehren fast gar nicht mit den Passagieren. Es gibt deren übrigens nicht sehr viele. Die meisten sind Franzosen und Italiener, auch einige Griechen. Nachts. Eben hatte ich ein seltsames Erlebnis. Nach dem Abendessen suchte ich M. auf, und wir gingen in der warmen, sternklaren Nacht an Bord. Wir setzten uns auf zwei Stühle in der Nähe der Reling und begannen leise unseren Plan zu besprechen, als plötzlich M. warnend den Finger an den Mund legte und mir flüsternd hastig zurief: „Brandorff, sehen Sie hinter mich in die Dunkelheit – ich habe das Gefühl, als würden wir beobachtet!“ Ich sah angestrengt hinter ihn – es brannte an unserer Seite keine Laterne – plötzlich glaubte ich zwei funkelnde Augen in der Dunkelheit zu entdecken. Ich stieß M. leise mit dem Fuß an, er verstand das Zeichen. Wir erhoben uns beide geräuschlos, und ich stürzte auf die Stelle zu, wo ich den Lauscher vermutete, M. mir nach. Wir kamen zu spät. Niemand war da. Sofort eilten wir hinunter in den Salon, um uns zu überzeugen, wer von den Passagieren fehlte oder eben erst gekommen war. Aber es war absolut nichts Auffälliges zu bemerken. Alle saßen in einer Haltung da, als hätte sie die Ewigkeit so hingesetzt. Wir knüpften mit dem Schiffs-Steward ein Gespräch an und fragten ihn unauffällig, wer von den Passagieren denn schon in den Kabinen sei. Aber es stellte sich heraus, dass nur drei Damen, eine Französin und zwei Italienerinnen, nicht in dem Salon waren. Wir verständigten uns durch einen Blick: Eine Frau konnte es nicht gewesen sein, man hätte sonst das Rauschen von Frauenröcken gehört. Immerhin, es war kein behagliches Gefühl, beobachtet zu werden. Wir beschlossen, äußerste Vorsicht walten zu lassen.
An Bord, 20. Juli.
Ich habe das Erlebnis überschlafen. Am hellen Tage, im Lichte der blendenden Sonne überm Meer sieht es natürlich nicht halb so unheimlich aus wie in der Nacht. Aber es ist klar: wir werden überwacht. Doch von wem? Traut man uns im eigenen Lager nicht, oder hat man bei der Gegenpartei Wind von unserm Unternehmen bekommen? Beides ist gleich unangenehm. Wir müssen auf der Hut sein. Zuerst ist es nötig, herauszubekommen, wer eigentlich der Spion war. Nun, wir haben unseren Plan schon gemacht. Warten wir den Abend ab.
An Bord, 20. Juli nachts.
Wir haben ihn; es ging glänzend. Eine wundervolle, sanfte Nacht begünstigte uns. M. und ich gingen zur selben Zeit wie gestern nach unserer Verabredung an die Reling und plauderten, etwas lauter als gestern Abend. Auf einen Wink von mir dämpfte M. seine Stimme plötzlich zum Flüstern. Wir neigten unsere Köpfe zueinander und taten so, als ob wir in eifriger, wichtiger Geheimunterhaltung wären. Plötzlich hörten wir hinter uns Geräusch. Sofort zog M. seinen bereitgehaltenen Revolver aus der Tasche, richtete ihn auf die verdächtige Gegend und rief mit gedämpfter, aber energischer Stimme: „Halt, oder ich schieße!“ Im selben Moment hatte ich hinter der vorgehaltenen Hand ein Streichhölzchen angezündet. Wenige Schritte vor uns sahen wir das ungeheuer verblüffte Gesicht eines jungen Matrosen. M. ging auf ihn mit vorgehaltenem Revolver los und packte ihn am Arm. Der Matrose war so verwirrt, dass er’s willenlos geschehen ließ. „Von wo kommst du?“ herrschte ihn M. leise an. Der Matrose machte schweigend eine Bewegung mit zwei Fingern der linken Hand, die nur uns und wenigen von unserer Partei bekannt sein konnte. „Es ist gut“ sagte M. und ließ ihn los. „Aber sage deinen Vorgesetzten, dass es nicht nötig ist, uns überwachen zu lassen. Wir halten unser Wort!“ Und ich setzte hinzu: „Laß dir nicht einfallen, noch einmal während der Fahrt etwas Ähnliches zu versuchen, wir würden dich unweigerlich dem Kapitän melden. Du kannst gehen!“ Der Matrose neigt kurz den Kopf und verschwand. Diese Orientalen sind doch zu mißtrauische Leute, unsereins kann sich gar keinen Begriff davon machen.
An Bord, 22. Juli.
Gestern passierten wir Sizilien. Der Dampfer nahm in Messina Kohlen ein. Schon waren wir im Begriff weiterzufahren. Es war Abend, und der Nachtwind trug die Düfte der sizilianischen Orangenhaine herüber. Plötzlich ruderte aus dem Hafen her ein kleines Boot auf und zu, dessen Führer uns durch laute Schreie zum Halten veranlassen wollte. Der Kapitän gab sein Signal. Der Dampfer stoppte und legte bei. Eine Strickleiter wurde herabgelassen, und aus dem Boot stieg ein verspäteter Passagier. M. und ich waren viel zu sehr in die Besprechung unserer Pläne vertieft, um uns nach dem neuen Eindringling umzusehen. Dieser Italiener interessierte uns nicht. Beobachtet werden wir nicht mehr.
An Bord, 23 Juli.
Heute vormittag kam M. freudestrahlend zu mir gelaufen. „Hören Sie, Brandorff, eine große Neuigkeit! Haben Sie den neuen Passagier schon gesehen?“ Ich hatte ihn noch nicht zu Gesicht bekommen. „Wissen Sie,“ fragte er weiter, „wer es ist?“ „Nun?“ sprach ich sehr gespannt, denn ich dachte natürlich, es handle sich um ein hohes Mitglied unserer Partei, das der Beschleunigung unseres Unternehmens förderlich sein könne. „Eine Dame, Brandorff,“ lachte er, „ein wundervolles Weib!“ „Haben Sie schon mit ihr gesprochen?“ fragte ich sehr enttäuscht und gleichgültig. „Nein!“ erwiderte er. „Ich hab sie jetzt nur zufällig, als sie ihre Kabine auf ein paar Minuten verließ. Sie ist tief verschleiert, aber sie hat eine herrliche Figur. Ein alter Kerl ist in ihrer Umgebung, der sie offenbar eifersüchtig bewacht. Aber ich glaube, mein Gefühl täuscht mich nicht, wenn ich sage: Ich hoffe, dass mir mein Glück hold ist!“ M. ist doch unverbesserlich. Mitten in unsere ernstesten Unternehmungen kommt er mit einem Liebesabenteuer. Wenn nur alles gut ausgeht – ich habe unangenehme Gedanken, jetzt, wo wir uns täglich unserm Ziel nähern!
An Bord, 24. Juli.
Griechenland schimmert von fern in seiner weißen Felsenpracht übers Meeer. Die griechischen Inseln bilden eine schier undurchdringliche Kette. Gott sei Dank, endlich nähern wir uns dem „Goldenen Horn“! Heute habe ich unsern neuen Passagier gesehen. Die Dame ist immer noch tief verschleiert, und auch an der gemeinsamen Mittagstafel nimmt sie nicht teil. Sie ist sicher keine Italienerin, davon bin ich überzeugt, sie hat etwas Internationales an sich. Der häßliche Alte, der stets bei ihr ist, hat eine Kabine neben der ihrigen. Ich habe eigentlich nicht den Eindruck, als ob es ihr Mann sei, trotzdem alle es behaupten. Als ich mich unauffällig aus der Passagierliste nach dem Namen erkundigte, zeigte man mir die Eintragung: Herr Signotani und Frau. Aber ich glaube es nicht. Eher habe ich den Eindruck, der Alte sei eine Schutzwache, die das schöne, junge Weib sicher an ihren Bestimmungsort geleiten soll. Am Abend. M. kam erregt zu mir und erzählte mir, es sei ihm gelungen, durch Blicke ein Einverständnis mit Frau Signotani herbeizuführen. Sie habe den dichten Schleier ein wenig gelüftet, als er an ihr vorbeiging, und ihn mit ein Paar wundervollen schwarzen Augen angeblitzt. Er sinnt darauf, irgendwie mit ihr eine Verbindung herzustellen. Wenn das nur gut ausläuft! Ich bin doch auch noch jung, aber für mich gilt der Satz: Der Mann darf sich nicht teilen. Entweder sein Werk oder die Liebe. Gerade jetzt heißt es doch bei uns alle Fasern anstrengen, wenn uns das Unternehmen glücken soll!“
Sanders machte hier beim Umblättern eine Pause. „Glauben Sie nicht auch, Fräulein Cecily,“ fragte er, „dass wir schon viel gewonnen hätten, wenn wir überhaupt wüßten, um was für ein Unternehmen es sich eigentlich gehandelt hat?“ „Schwerlich“, erwiderte Cecily. „Wie soll irgendeine Reise, irgendein Geschäft, das mein Vater vor dreißig Jahren mit dem mysteriösen Herrn M. gemeinsam gemacht hat, in Verbindung mit seinem jetzigen Verschwinden stehen? Ich meine vielmehr, durch so eine vorgefaßte Meinung verlieren wir nur die Zeit an die Lektüre eines toten Buches, während meine praktische Frauenvernunft mir doch sagt, dass wir sie viel besser auf die Spuren eines Lebenden verwenden könnten. Denn ich bin überzeugt, dass mein Vater noch lebt!“ „Erlauben Sie,“ antwortete Sanders, „hier bin ich doch nicht ganz Ihrer Meinung. Sehen Sie, ich finde dieses Buch gar nicht „tot“, wie Sie es nennen. Ich finde, es enthält höchst merkwürdige Aufzeichnungen. Wenn es nicht die engste Beziehung zu Ihres Vaters Leben hätte, glauben Sie, er würde es durch alle Jahre so sorgsam aufbewahrt haben? Ich bin überzeugt, wenn wir ale rätselhaften Punkte in dem Vorleben ihres Vaters geklärt haben, dann haben wir vielleicht auch die Lösung zu seinem Verschwinden.“ Cecily stand auf: „Sanders, ich kann Ihnen bei der Lektüre doch nichts nützen, das haben Sie jetzt gesehen. Ich bin übermüdet. Darf ich Sie mit dem Buch allein lassen und zu Bett gehen? Lesen Sie nur ruhig allein weiter, und gebe Gott, Sie fänden etwas!“ Er küßte ihr respektvoll die Hand. Cecily ging hinaus und ließ Sanders im großen, kahlen Bibliothekzimmer allein mit den Blättern des Tagebuches zurück. Er blätterte die Seiten um. Pera hieß die Überschrift.
„26. Juli.
Endlich sind wir so weit, ich habe schon gar nicht mehr gedacht, dass wir dies Ziel je erreichen werden. Mußten wir auch diesen Vergnügungsdampfer, der blindlings nach schönen Aussichtspunkten im Mittelmeer kreuzt, benutzen! Aber freilich, so waren wir unauffälliger. Doch nun liegt Pera vor uns. Freilich, wir haben den Hafen noch nicht betreten, noch sind wir an Bord. Noch glänzt weit, weit von uns die schimmernde, gewölbte Bucht des Goldenen Horns. Aber schon morgen vormittag werden wir in Stambul an Land steigen! Mich verstimmt nur eins: das Abenteuer M’s mit dem schönen Weib. Wer ist sie eigentlich? Ich vermute, sie ist die neue Frau eines vornehmen Türken. Sicher ist sie gar keine Orientalin. Ich halte sie für eine Südfranzösin. Der Alte ist natürlich nicht ihr Mann, wie ich mir gleich gedacht hatte. Heut kam sie aus ihrer Kabine und ging, um die Seeluft noch die letzten Stunden zu genießen, an Deck. Sie war allein. M. sah sie und schritt entschlossen auf sie zu. Sie hatte den Schleier hochgeschlagen, und man konnte ihr reizendes, pikantes Gesicht sehen, das von einer dichten, schwarzen Haarflut umrahmt war. Als sie M. kommen sah, errötete sie tief und lächelte. M. sprach sie Französisch an. Schon schien sie antworten zu wollen. Plötzlich stand wie aus der Erde gewachsen der häßliche Alte hinter uns, ergriff sie beim Arm und führte sie mit wutverzerrter Miene, doch ohne eine Silbe zu reden, hinunter. Sie war ganz bleich geworden und warf M. einen tieftraurigen, beredten Blick zu. „Sahen Sie diesen Blick, Brandorff?“ fragte mich erregt M. „War er nicht hilfeflehend? Gewiß führt sie dieser alte Kerl dem Harem irgendeines dieser verdammten Orientalen zu, und sie kann sich nicht wehren!“ „Wahren Sie um Gottes willen Ihre Zunge!“ rief ich ihm warnend zu. „Denken Sie, wie nahe wir dem Innenhafen sind, und da ist türkisches Gebiet!“ In der Tat, mich machte dieses Abenteuer besorgt. Ich wußte nur zu gut, wie streng man in der Türkei die Frauen hütet. Ein Europäer, dem die geheime Verbindung mit der Gemahlin eines Türken nachgewiesen werden kann, hat nach türkischen Recht sein Leben verwirft. Der leichtherzige Flattersinn M.s könnte um eines schönen Weibes willen alle sorgsam geschmiedeten Pläne zunichte machen, ja uns sogar durch Unvorsichtigkeit in die größte Lebensgefahr bringen! Ich muss doch scharf auf ihn achtgeben.
Pera, den 27. Juli.
Endlich fuhren wir heute in den Hafen ein. Unter dem Gewimmel der kleinen, mit schreienden Händlern besetzten Boote kamen wir an Land. Es waren doch merkwürdige Augenblicke, als wir die Behörden passieren mußten. Die Kontrolle ist scharf. Einen Moment stand uns wohl das Herz still. Wir tauschten einen Blick miteinander, und beide erinnerten wir uns gleichzeitig an den Matrosen, der uns an Bord überwacht hatte. Wie, wenn uns jemand von der Gegenpartei verfolgt und schon verraten hätte? Aber nichts Auffälliges geschah. Wir passierten ungehindert als Vergnügungsreisende. Beim Verlassen des Schiffes suchte M. noch einen Blick von seiner Dame zu erhaschen. Aber es stellte sich heraus, dass eine reichverzierte Barkasse, die uns schon vorher durch ihren kostbaren Goldschmuck und ihre sechs Mann am Ruder aufgefallen war, anlegte und den Alten mit der dichtverschleierten Dame abholte. Unsere Vermutung hatte uns wohl nicht getäuscht. Alle diese waren mit dem Alten wohl nur Abgesandte des wirklichen Gemahls, eines vornehmen Türken. Nun, in diesem Fall war wohl ein Wiedersehen mit M. für immer ausgeschlossen. Frauen, die erst einmal in den Harem eines vornehmen Türken kommen, werden von keinem Europäerauge mehr erblickt. Als die Barkasse im Gewühl verschwand, bemächtigte sich meiner doch ein Gefühl der Erleichterung. Es waren keine bösen Verwicklungen mehr von dieser Seite zu fürchten. M. war sehr niedergeschlagen. Aber ich redete ihm zu und brachte ihm bei, dass der Zweck unseres Hierseins doch nicht Abenteuer mit Todesgefahr seien, sondern die Ausführung unserer Pläne, wozu wir all unsere Kraft und all unseren Geist brauchten.
Stambul, den 29. Juli.
Zwei Tage sind seit meiner letzten Eintragung vergangen. Meine Absicht war, hier in meinem Buche einige Eindrücke von Stambul wiederzugeben, zu reden von den Minaretts der Moscheen, den langgezogen seltsamen Gebetsrufen der Muezzins, von den vielen herrenlosen Hunden, die sich auf den schmutzigen, engen Straßen herumtreiben, von dem Viertel, in dem die Armen elende, baufällige, übelriechende Hütten haben. Ich wollte erzählen von den geheimnisvoll vergitterten Fenstern an den Häusern der Reichen, hinter denen ab und zu ein dichtverschleierter Frauenkopf auftaucht, und die wohl die Geheimnisse der Harems verstecken. Doch ich unterbreche mich im Schreiben, denn ich höre den schnellen Schritt meines Gefährten auf der Hoteltreppe. Abends. Dieser Hund, der M.! Er hat doch wirklich durch seinen Leichtsinn beinahe alles verdorben! Als er mich heut im Schreiben unterbrach und mit verstörtem Gesicht zu mir ins Zimmer trat, da ahnte ich gleich, dass etwas Böses vorlag. Kurz und gut: er hat, ohne es mir zu sagen, auf dem Schiff einen Matrosen bestochen, der die Spur der schönen Haremsdame verfolgen sollte. An Land gelingt es ihm wirklich, das Haus in der Stadt zu finden. Es gelingt ihm, ihre Aufmerksamkeit des Abends am Fenster zu erregen. Sie wirft ihm einen Zettel zu. Aber man bemrkt ihn, hat Verdacht, dass er Absichten auf den Harem hat, und will ihn verhaften. Er entgeht den Verfolgern und entflieht wirklich. Da saß er nun verstört im Hotel. Wie wenn man ihn noch ausfindig machte? Wenn man sich um uns näher kümmerte? Wenn man feststellte, was wir eigentlich wollten? Ist erst die Aufmerksamkeit auf uns gelenkt, so gibt es Spione genug, die unsere Spur zurück bis nach Paris verfolgen können. Und dann ist alles zu Ende. M. muss sich in den nächsten Tagen im Hotel verborgen halten, damit er nicht erkannt wird, alles muss beschleunigt werden. Morgen muss ich zu unseren Leuten. Vorsicht, Vorsicht – es droht Gefahr!“
Die Seite war zu Ende. Sanders drehte sie um, aber ein leeres Blatt gähnte ihm entgegen. Alle noch folgenden Blätter des Buches waren leer. Offenbar war die Erzählung Brandorffs in der Mitte abgebrochen worden. Plötzlich fand Sanders beim langsamen Blättern auf der drittletzten Seite des Buches groß und deutlich an den oberen Rand ein Wort hingeschrieben. Da stand, wie wenn es hätte eine Überschrift sein sollen: „Die Opale“.
Sanders stutzte. Er blätterte um – es kam nichts mehr. Woran erinnerte ihn nur dieses Wort „Opale“? Irgend etwas war in den letzten Tagen vorgefallen, das mit diesem Wort Beziehung hatte. – Ah, jetzt entsann er sich! Die Opale aus der Juwelensammlung des alten Brandorff fielen ihm ein. Sollten diese etwa mit der Entfernung des Rentiers etwas zu schaffen haben? - Aber wenn es dem Urheber des Verbrechers auf die Steine angekommen wäre, dann hätte er doch wohl diese geraubt, anstatt deren Besitzer spurlos verschwinden zu lassen. Die Opale aber waren da, unangetastet lagen sie in ihrem Kästchen. Sanders hatte sich ja mit eigenen Augen von ihrem Vorhandensein überzeugt. – Vergebens grübelte der Rechtsanwalt über die Bedeutung des Schlußworts aus dem Tagebuch des alten Brandorff nach – er konnte zu keiner befriedigenden Lösung kommen. Überhaupt dieses Tagebuch war sehr, sehr merkwürdig. Was waren das für Pläne, die die beiden Gefährten schmiedeten? Wer war dieser M.? Was waren das für Parteien und Gegenparteien? Warum brach die Erzählung plötzlich ab? Warum kam mitten in die leeren Blätter des Buches hinein die seltsame Überschrift: „Die Opale“? Durch bloßes Grübeln waren diese Geheimnisse, das erkannte Sanders, nicht zu lösen. Wenn nicht etwas Außergewöhnliches hinzukam, so blieb der geheime Sinn des Tagebuches für immer verborgen. Cecily hatte ganz recht. So war den Spuren des verschwundenen Brandorff nicht beizukommen. Doch wie anders?
Es war Nacht, und Sanders saß noch immer in dem fremden Hause grübelnd, den Kopf in der Hand, beim hellen Schein der Lampe. Er stand auf, um in das Fremdenzimmer zu gehen, das ihm Cecily nach einer Verabredung hatte herrichten lassen, damit das Haus nicht ohne männlichen Schutz von Freundesseite bleibe. Er reckte und streckte seine Glieder und war eben im Begriff, sich schlagen zu legen, als ihm einfiel: Was ist denn mit dem Tagebuchlesen groß geleistet? Er war doch nicht hier, um auszuruhen, sondern um tatkräftig Spuren Brandorffs aufzufinden ... Aber was sollte er jetzt bei Nacht beginnen? Er konnte doch nicht um diese Zeit im Hause herumsuchen und die Schlafenden beunruhigen? Ratlos stellte er sich ans Fenster und sah hinaus in das dichte Laub der dicken, hohen Bäume vor ihm, das in grünlichem Silber unter dem Mondlicht spielte. Plötzlich kam ihm eine Gedanke: Der Garten! – Noch niemand hatte da gesucht!
VI. Nächtliches Abenteuer.
Ein stiller Sommerabend hatte sich an diesem Tage über Berlin gelagert. Rotgoldene Wolkenbällchen zogen über den mattblauen Himmel in zarter Bewegung, wie wenn sie jeden Moment matt zur Erde sinken wollten. Die Häuser der Margaretenstraße öffneten ihre Tore, Equipagen und Kabriolette flogen lautlos über den Asphalt. Jetzt erst schien die sonst so ruhige Straße ihre Bewohner sehen zu lassen. Unter der großen Platane an der Straßenkreuzung standen im letzten Aufglimmen der Abendröte zwei Männer. „Also, Matuschke,“ sagte der eine, „machen Sie Ihre Sache gut! Ich werde jetzt hinter Ihnen hergehen, Sie klingeln am Hause, und wenn der Portier öffnet, dann gehen Sie in die Portierloge hinein; hören Sie: hinein. Da legen Sie dem alten Lehnert und seiner Frau das Protokoll vor, währenddessen gehe ich schnell ins Haus. Nachts über bleibe ich im Hause, Sie müssen also morgen früh um neun Uhr noch einmal kommen und die Portiersleute so lange aufhalten, bis ich wieder hinaus bin. Kein Mensch darf eine Ahnung davon haben, dass ich im Hause bin. Also morgen früh Punkt neun Uhr! So – und nun geben Sie mir meine Sachen!“ Der Kriminalkommissar von Redberg nahm dem Zivilschutzmann das kleine Handtäschen ab und ging vorsichtig ein paar Schritte hinter der breiten Unteroffiziersgestalt mit den schweren, breiten Stiefeln her. Niemand, der den eleganten Redberg am Vormittag gesehen hatte, hätte in dem unscheinbaren Herrn im dunkelgrauen Anzuge, der mit leisem, elastischem Schritt durchs Abenddunkel ging, den Kriminalkommissar vermutet.
Matuschke blieb vor dem Hause Nr. 25 stehen und klingelte. Das kleine Fenster zu ebener Erde wurde aufgerissen, und der alte Lehnert steckte mürrisch seinen Kopf durch den Vorhang: „Was wollen Sie?“ „Sind Sie der Portier Lehnert?“ Auf diese mit militärischem Ton gegeben Gegenfrage wurde die Stimme Lehnerts plötzlich weich. Er ahnte nichts Gutes. „Ja, der bin ich.“ „Ich komme vom Revier, ist Ihre Frau da?“ „Ja, um Gottes willen,“ kreischte die Portiersfrau, „was ist denn bloß los? Ich habe doch um Himmels willen nichts getan und weiß doch auch nicht, wo der alte Herr geblieben ist!“ „Darum handelt sich’s auch gar nicht, Frau Lehnert“, sagte der Kriminalschutzmann in gebeugter Haltung zu dem kleinen Fensterchen hinunter. „Ich muss nur ein Protokoll aufnehmen!“ Das Fensterchen klappte zu, und Matuschke, der sich überzeugte, dass niemand ihn beobachtete, ließ geräuschlos ein Stückchen schwarzen Gummischlauch fallen, das er in der Hand gehalten hatte. Als die Tür sich öffnete, schob er es schnell mit dem Fuß an den feststehenden Flügel, so dass die Tür sich nicht wieder ganz schließen konnte. Als er im Hausflur war, kam ihm schon Lehnert an der offenen Tür der Portiersloge entgegen. Matuschke holte den blauen Aktendeckel unter der Arm hervor. „Kommen Sie doch rein, Herr Wachtmeister!“ bat Lehnert mit zitternder Stimme. Kaum hatte sich das Türchen hinter den beiden geschlossen, als vorsichtig das Haustor aufgedrückt wurde und blitzschnell, geräuschlos wie ein Windhund, Redberg über den Flur schlüpfte. Es war zum hinteren Tore, dass auf den Vorhof führte. Es war geschlossen. Als er sich umsah, entdeckte er im Dunkel noch ein Seitenpförtchen und faßte sorgsam nach der Klinke. Diese Tür war offen. Er glitt hindurch. Auf dem Vorhof hielt er sich vorsichtig an der Mauer, und erst, als er sich genau davon überzeugt hatte, dass niemand sich um diesen Teil des Hauses kümmere, hatte er mit wenigen lautlosen Sprüngen den Garten erreicht.
Wer dem ganzen Beginnen Redbergs zugesehen hätte, wäre sehr verwundert gewesen über die plötzliche Umwandlung, die mit einem Menschen innerhalb weniger Stunden vor sich gehen konnte. Die ganze offizielle Steifheit, die er heute vor Sanders und den Dienstboten an den Tag gelegt hatte, war verschwunden. Geschmeidig wand er sich durch die dunklen Gebüsche des dämmerigen Gartens und musterte mit scharfem Blick seine Umgebung. Sollte das Benehmen, das er vor den beobachtenden Blicken der Hausbewohner an den Tag gelegt hatte, nur Maske gewesen sein? War am Ende seine Äußerung, er halte die rätselhafte Angelegenheit für erledigt, nur Verstellung? In der Tat: unter dem äußeren Schein des seichten Salonmenschen steckte ein sehr tüchtiger Polizeimann. Seine besten Erfolge im Amt hatte Redberg durch die scheinbare Gleichgültigkeit und durch den Plauderton gewonnen, die er vor Fremden an den Tag legte. Nichts hatte ihn in seiner langen Amtstätigkeit so interessiert wie das Verschwinden Brandorffs. Er fühlte sich aufs äußerste von dem Fall gefesselt. Aber hier, wo so erschwerende Umstände vorlagen, mußte er, das sah er sofort, mit der größten Vorsicht zu Werke gehen. Er durfte hier, noch weniger als sonst, jemand auch nur das geringste merken lassen. Alles, was er heute vormittag in der Wohnung Brandorffs getan und angeordnet hatte, verfolgte nur zur Hälfte den Zweck, etwas zu entdecken. Das wichtigere war für ihn, die Anwesenden über seine Absichten zu täuschen, so dass er, ohne dass jemand eine Ahnung davon hatte, das ganze Haus beobachten konnte – alles, alle. Aber seine Gewohnheit war stets, allein zu untersuchen. Das Sprengen des Geldschranks hatte er halb und halb für zwecklos gehalten. Immerhin, so etwas tut man, um kein Mittel unversucht zu lassen, das den Sachbestand etwas erhellen könnte, und um sich selbst keinen Vorwurf der Vernachlässigung machen zu müssen. Das Tagebuch hatte er nur flüchtig durchgesehen. Er hielt nicht viel davon, dennoch schien es ihm charakteristisch genug, dass der alte Brandorff schon in höchst merkwürdigen und geheimnisvollen Situationen gewesen war. Niemand konnte wissen, wie viel Fäden sich hier zu einem seltsamen Knäuel verwickelten.
Doch eins schien ihm vor allem wichtig: Brandorff war aus seinem Zimmer verschwunden – das Zimmer war von innen, also offenbar von Brandorff selbst abgeschlossen worden. Wenn dieser Tatbestand richtig war – und bis jetzt hatte ich kein Grund gefunden, der dies bezweifeln ließ – so mußten irgendwo in der Wohnung und Umgebung des Verschwundenen Spuren zu finden sein, wie man sie doch hinterlassen muss, wenn man auf so seltsame Art das Weite sucht. Er hatte natürlich, als Praktiker, keine vorgefaßte Idee, was eigentlich geschehen sein könne. Er wollte und durfte sich nur von dem leiten lassen, was ihn der Augenschein lehrte. Und so konnte dieses spurlose Verschwinden des alten Brandorff unter Umständen sich in seinen Augen als ein zu irgendeinem Zweck ins Werk gesetzter Schwindel, wie, unter Umständen, als ein Verbrechen von höchster Tragik entpuppen. Dennoch hatte er schon heute vormittag die Gewißheit gewonnen, dass ein Betrug von seiten des verschwundenen Brandorff – und darauf hätte ja eventuell die Polizei auch gefaßt sein müssen – kaum vorlag. Alles, was Redberg über diesen Punkt andeutete, wurde nur gesagt, um die andern über seine Tätigkeit zu täuschen. Denn hätte der alte Brandorff sein Verschwinden selbst in Szene gesetzt mit der Absicht, dass man dahinter ein an ihm begangenes Verbrechen vermuten sollte, so hätte er sicherlich sein Zimmer vorher in größte Unordnung gebracht, Kassetten erbrochen, Gefäße zertrümmert, um einen Raub als Motiv vorzutäuschen Aber es war ja merkwürdigerweise alles in bester Ordnung gewesen.
Es blieb also nur die Folgerung, dass Brandorffs Verschwinden wider seinen Willen ausgeführt worden war. Und was da nun eigentlich geschehen war, das konnte erst die strengste Untersuchung lehren. Man muss sagen, Herr von Redberg war objektiv in seinen Folgerungen und Schlüssen. Er war so objektiv, dass, wenn es darauf ankam, irgend jemand der Teilnahme an dem Verschwinden Brandorffs zu verdächtigen, er eigentlich jeden Menschen aus der Umgebung Brandorffs im Verdacht hatte. Die Umgebung zunächst. Denn das Zunächstliegende gestattet bei der Untersuchung immer die logischsten Schlüsse; von da kommt man erst zu fernerliegenden Dingen und Menschen. So also wollte er zuerst die Umgebung kennen lernen, heimlich, damit niemand ihm absichtlich oder unabsichtlich irgendein Merkmal verwischen könnte. Zunächst also mußte er sich über seinen Standort informieren. Er stellte fest, dass der Garten, der gegen den Vorhof durch das eiserne Tor abgeschlossen war, das er schon vorher passiert hatte, sich in eine beträchtliche Tiefe erstreckte. Tief hinten war der Garten durch eine lange, steinerne Mauer abgeschlossen, die auf der einen Seite an ein Nachbargrundstück anstieß, auf der andern Seite aber plötzlich in einem rechten Winkel umknickte, um einen Teil des Hauses herumlief und plötzlich haltmachte vor einem großen, sehr hohen Zaun, der zwar nicht die Welt, wohl aber die Margaretenstraße mit Brettern vernagelte.
Hinten an der Mauer, ungefähr in der Mitte ihrer Länge, stand eine kleine Laube. Redberg schlich geräuschlos zwischen den hohen, alten Linden hin, wobei er sorgfältig die knirschenden Kieswege vermied, und setzte sich in die Laube, um die Nacht vollends abzuwarten. Erst wenn er alles schlafend wußte, wollte er sich an das Haus heranpirschen und, wie der Jäger nach dem Schweiß des Wildes, nach den Spuren der Täter suchen. Den Revolver hatte er zwar schußbereit bei sich, aber er glaubte ihn kaum zu gebrauchen. Er ließ ihn im Gürtel stecken. Was Redberg wichtiger schien, das war die Handtasche, mit der er sich ins Haus eingeschlichen hatte. Er stellte sie auf den kleinen Tisch der Laube, öffnete sie und entnahm ihr allerlei seltsame Werkzeuge, die er vorsichtig auf dem Tisch ausbreitete, indem er jedes Geräusch vermied. Zuletzt entnahm er der Tasche eine kleine elektrische Lampe, die er entzündete und so stellte, dass sie nur diejenigen Gegenstände in einem kleinen, hellen und scharf begrenzten Kreis erleuchtete, die er eben untesuchte. Im Scheine des elektrischen Lichtes lag da in der kleinen Laube im Dunkel der Nacht das Handwerkzeug des modernen Indianers, des modernen Pfadfinders und Spurensuchers.
Rechtsanwalt Sanders hatte, getrieben von einem unwiderstehlichen Tätigkeitsdrange, plötzlich den Entschluß gefaßt, sich so schnell wie möglich Ausschluß über die Art, wie der alte Brandorff verschwunden war, zu holen. Seine Folgerung war: Wußte man erst, wie es geschehen war, so wußte man auch, wer es getan hatte. Und wußte man erst, wer der Täter war, so wußte man auch, wo der alte Brandorff zu suchen war. Die Lektüre des Tagebuchs hatte ihn fast verzweifeln lassen. Bis plötzlich das Funkeln des Mondlichtes auf den Blättern der Linde vor dem Bibliotheksfenster ihn an den Garten erinnert hatte. Er war entschlossen, ohne alle Skrupel und Zweifel, ohne alles Grübeln einmal ganz seinem Instinkt zu folgen. Und er sagte sich: „In diesem Hause gibt es keine Handbreit Boden, die wir nicht untersucht haben. Nur der Garten ist noch da. Aber der ist ja so riesig, dass eine Untersuchung ganz erfolglos bleiben würde.“ Doch hier schnellte plötzlich seine Tatkraft hoch. War der Garten wirklich so groß? Noch größer war doch wohl das Verbrechen! Aber wenn nun der Erfolg ausbleiben würde? Schön, er, Rechtsanwalt Sanders würde den Erfolg zwingen. Gerade, weil jetzt im Hause alles schlief, war es am sichersten fürs Suchen. Nun, da er unbeobachet war, konnte er auch, unbeeinflußt von Meinungen, Winken oder auch nur Blicken der Menschen, sich ganz auf sein Vorhaben konzentrieren. Mehrmals durchmaß er leise das Bibliothekszimmer und ließ seinen Blick spähend umhergleiten, um vorher den besten Plan zu finden, mit dem er auf der Suche im Garten vorgehen wollte.
Da hatte er’s. Das nächstliegende war doch, wenn man schon im Garten irgend etwas zu finden hoffte, denselben Weg einzuschlagen, den der Jemand eingeschlagen haben mußte, der möglicherweise irgendeine Spur im Garten hinterlassen hatte. Und das war der Weg durch Brandorffs Arbeitszimmer. Sanders drückte die Klinke an der Tür des Arbeitszimmer herunter. Die Tür war unverschlossen. Er ging hinein in den kleinen, dunklen Raum. Ein paar Minuten blieb er stehen, um seine Augen an das Dunkel zu gewöhnen. Das Fenster war noch offen, das Mondlicht spielte durch die Zweige der mächtigen Linde, die in einiger Entfernung vor dem Fenster ihre Zweige ausbreitete. In dem ungewissen Schein konnte er erkennen, dass im Zimmer noch alles so lag wie am Morgen. Mitten im Zimmer blieb er einige Augenblicke still stehen, um sich zu überzeugen, ob er durch nichts gestört würde. Doch nichts rührte sich. Er drückte die Klinke der Tapetentür herab und trat auf den kleinen Vorflur hinaus, dann tastete er sich die Wendeltreppe hinab. Unten im Garten, hoffte er, würde die Helligkeit des Vollmondlichtes fürs erste schon genügen. Als er von der Wendeltreppe aus in den Garten trat, blieb er vorsichtig in der kleinen Holztür stehen und blickte um sich. Keine Menschenseele war weit und breit zu sehen, wie er es erwartet hatte. Nur die riesigen, alten Bäume des Gartens schwankten in dem bleich zitternden Licht gespenstisch hin und her, fast schien es, als streckten sie drohend in die Nacht Arme aus zum furchtbaren Zeugnis eines Verbrechens, das sie mit angesehen hatten. Ein wenig bangte dem Rechtsanwalt jetzt, in der Stille der Nacht, doch vor seiner Aufgabe. Aber er ließ sich nicht entmutigen.
Spähend trat er aus seinem Versteck hinaus. Als er hinter sich blickte, fiel ihm die große, dichtbewachsene Mauer ins Auge, in der das Pförtchen der Wendeltreppe mündete. Ein Gedanke kam ihm. Wie wär’s, wenn er zuerst einmal seine Forschung dicht an der Mauer aufnahm und erst allmählich immer weiter und weiter in die Umgebung vorrückte? Langsam schlich er an der Mauer entlang, das Auge fest auf der Erde. Doch er sah nichts Verdächtiges, nicht die leiseste Fußspur. Auf einmal, ehe er sich’s versah, war die Hausmauer zu Ende. Ein Hindernis hielt ihn auf. Hier konnte er nicht weiter. Wo das Haus eine vorspringende Ecke bildete, war ein Holzschuppen angebaut, der allerlei Gartengerätschaften und altes Gerümpel barg. Wenn man auf die andere Seite des Hauses herum wollte, die parallel mit dem Bretterzaum lag, der die Margaretenstraße schloß, so mußte man in einem großen Bogen um den Schuppen herum auf den hellen Kieswegen gehen. Und das wollte Sanders um jeden Preis vermeiden, da konnte er gesehen werden, wenn im Hause irgend jemand zufällig aufwachte und ans Fenster trat. Einen Moment fand er sich also aufgehalten. Dann aber kam ihm eine Idee. War er nicht ein sehr guter Turner? Nun, es war wirklich keine solche Schwierigkeit, unter dem Schutze des dunklen Laubes über den Schuppen herüberzukommen. Es war gar nicht schwer. Er schwang sich, indem er sich mit den Füßen auf den Rahmen eines kleinen, zerbrochenen Fensters stützte, aufs Dach, kletterte hinüber und ließ sich auf der anderen Seite wieder hinab. Eine kleine Weile blieb er still stehen, um sich zu überzeugen, dass seine Kletterpartie kein Aufsehen erregt hätte. Plötzlich hörte er in der Nähe ein leises Geräusch im Gebüsch. Erregt blieb er stehen. Was war das? Doch das Geräusch wiederholte sich nicht – es war wohl nur der Wind gewesen, der durch die Zweige fuhr.
Er kroch weiter an der Mauer entlang. Jetzt war er unter der Linde angekommen, die vor Brandorffs Arbeitszimmer stand. Hier war es vollkommen dunkel. Nur ein dünner Mondstrahl fiel durch das dichte Blättergewirr hindurch. Erschöpft richtete sich Sanders auf, um, an den Stamm gelehnt, sich einen Moment auszuruhen. Als er sich wieder bückte, um seine Untersuchung fortzusetzen, blitzte ihm an der Erde, gerade in dem dünnen Schein, den die Zweige vom Mondlicht durchließen, etwas Weißes entgegen. Er griff danach und betrachtete es, war ein kleines, seidenes Band, mit Metallbeschlägen und einem Silbermonogramm. Augenblicklich erkannte er es als das Abzeichen, das die Mitglieder des Westen-Klubs anzustecken pflegten. Mit einer fast ärgerlichen Bewegung steckte er es in die Westentasche. Offenbar war es ihm eben herausgefallen; zu dumm, dass auch gerade jetzt seine Gedanken ablenken mußte. Er wollte die Hand aus der Tasche ziehen – plötzlich fühlte er in unaussprechlichem Schreck, wie sich jemand über ihn warf. Eine Hand schob sich vor seinen Mund, und eine harte Stimme flüsterte: „Keinen Laut, oder ich shieße.“ Der Kerl lag in der Dunkelheit ganz auf ihn, drückte ihn platt auf die Erde und riß ihm beide Arme nach rückwärts. Ein Klirren, ein Einschnappen von Metall war hörbar, und Sanders fühlte plötzlich – das Herz stand ihm fast still – seine Handgelenke auf den Rücken gefesselt. Die Stimme des Kerls flüsterte energisch in sein Ohr: „Stehen Sie auf, und rühren Sie sich nicht!“ Sanders gehorchte, er fühlte sich an der Brust gepackt und aufgehoben. Der Schein einer elektrischen Taschenlampe blitzte auf, und er stand seinem Angreifer jetzt von Angesicht zu Angesicht gegenüber. Es war der Kriminalkommissar von Redberg.
Auch Redberg hatte Sanders erkannt. In maßlosem Staunen standen sich die beiden gegenüber. Redberg brach zuerst das Schweigen: „Was, Sie sind es, Herr Rechtsanwalt? Erlauben Sie, ich war ein wenig energisch! Aber sagen Sie, was haben Sie hier nachts um das Haus zu schleichen?“ Noch konnte Sanders sich nicht fassen. Der gänzlich unerwartete Überfall im Dunkeln hatte ihn völlig verwirrt. „Kommen Sie, Herr Sanders, „ sagte Redberg, „ich will Ihnen die unangenehmen Dinger da hinten wieder abnehmen. Aber das kann ich Ihnen sagen, ich hätte nie erwartet, Ihre Bekanntschaft auf so wunderbare Weise erneuern zu dürfen!“ Und nun erklärte ihm Sanders schnell im Flüsterton, was ihn hergetrieben hatte. „Ich sah Sie schon längst herumkriechen,“ sagte Redberg, „hatte aber natürlich in der Dunkelheit keine Ahnung, dass Sie es sind! Hm, das hätte leicht unangenehm werden können!“ „Auf der andern Seite der Mauer hörte ich im Gebüsch ein Geräusch, „ fragte Sanders, „waren Sie das?“ „Freilich,“ lachte Redberg leise, „aber haben Sie etwas gefunden?“ „Nein“, antwortete Sanders. „Nun, ich sah Sie doch eben etwas aufheben!“ drängte der Kommissar.
„Ja, das war ein Band, das ich eben selbst verloren hatte!“ war die Antwort. Sanders griff in seine Westentasche, um das kleine Klubband hervorzuholen. Im Licht der Taschenlampe löste er seine Faust, um das Band zu glätten. Plötzlich gewahrte er zu seiner ungeheuren Überraschung, dass er – zwei Klubzeichen in der Hand hielt. „Was ist das?“ fragte Redberg. „Das ist doch vom Westen-Klub? – Aber wieviel solcher Abzeichen besitzen Sie?“ „Nur eins!“ erwiderte Sanders, und er fühlte, wie ihm der Schweiß auf der Stirn stand. „Aber das hier sind doch zwei!“ sagte Redberg. Sanders antwortete mit ausgetrockneter Kehle: „Ich habe mich geirrt – ich habe nicht mein Band verloren, wie ich vorher dachte, sondern dieses hier jetzt erst gefunden – ich hab’s mechanisch in die Westentasche gesteckt!“ „Also, muss es jemand verloren haben!“ bemerkte ruhig der Kriminalkommissar. „Aber kommen Sie, wir wollen hier nicht stehen bleiben. Wir werden uns in die Laube am Ende des Gartens setzen und ruhig diesen merkwürdigen Fund besprechen. Ich sehe doch, dass ich ein paar Fragen an Sie zu richten habe!“
„Hören Sie mal, Herr Sanders,“ fuhr Redberg fort, als sie in der Laube saßen, „ich sage Ihnen offen, dass Sie der einzige Mensch hier aus der Umgebung sind, auf den ich keinen Verdacht habe. Sie brauchen sich nicht geschmeichelt zu fühlen,“ unterbrach er sich, „Höflichkeiten gibt es im Amt nicht. Ich habe mich indessen genau erkundigt, kenne Ihre Beschäftigungen, weiß wo Sie gewesen sind, kurz, ich habe Ihr Alibi bis zum heutigen Morgen in Händen. ... Vielleicht aber kennen Sie einen jungen Mann, der, wie Sie, Angehöriger des Westen-Klubs ist und der sich gestern nacht lange hier im Hause aufgehalten hat, der vorher mit dem alten Brandorff einen heftigen Streit hatte! Kennen Sie einen solchen Herrn vielleicht?“ „Soltau!“ stöhnte der Rechtsanwalt tonlos. „Ja, Soltau!“ lächelte Redberg kalt. „Hören Sie, Herr Rechtsanwalt,“ fuhr er fort, „ich vermute, Sie bleiben heute nacht hier im Fremdenzimmer des Hauses. Gut – tun Sie das, bitte, wirklich. Und wenn ich Ihnen einen Rat geben darf: Ich weiß, Sie sind mit Soltau befreundet – versuchen Sie nicht, ihm einen Wink zu geben. Ich werde doch schneller sein als Sie – und es könnte für Sie Unannehmlichkeiten haben!“ Ruhelos lag Sanders kurze Zeit später auf dem Bett des Fremdenzimmers, das er geräuschlos wieder aufgesucht hatte. Er konnte keinen Schlaf finden, und seine erregte Phantasie ließ ihn Soltau erblicken, mit Handschellen gefesselt, so wie er es selbst noch vor kurzer Zeit gewesen war. Aber der Kriminalkommissar war nicht müßig. Er strich am Hause lautlos umher, beugte sich zur Erde, maß mit einem kleinen Zollstock, sprang hierhin, dorthin und machte sich beim Lichte der Taschenlampe eifrig Notizen. Am Morgen erschien der Kriminalschutzmann Matuschke von neuem bei den Portiersleuten. Redberg verschwand ungesehen aus dem Hause. Alles hatte aufs beste geklappt. Und wenn Sanders nicht die noch schmerzenden Stellen an seinen Handgelenken gespürt hätte, so hätte er glauben können, das nächtliche Erlebnis sei nur ein wirerr Spuk gewesen.
VII. Gefangen.
Die Mittagssonne brillete über Berlin. Aber die Weltstadt lag nicht träge da. Durch die Friedrichstraße wälzte sich der bunte Strom des Großstadtlebens, mitten über den Asphalt sausten die Equipagen, rasten die Automobile. An den Seiten schob sich die Menge der Fußgänger vorwärts, kreuzte den Fahrdamm, verschwand in den Geschäftsläden oder flutete aus ihnen heraus, so dass jemand, der Muße gefunden hätte, stillzustehen und sich die ungestüm weiterdrängende Menge anzusehen, Angst um das Leben jedes einzelnen bekommen hätte. Aber hier, mitten im Herzen dieses Strudels, hatte niemand so viel Muße. Selbst die eleganten Nichtstuer, die vornehmen Flaneurs, die lässig die Straße passierten, schienen von der gleichen Unruhe erfaßt, wie sie die ganze Menge gepackt hatte. Sie wanderten die Straße auf und ab, immer zwischen Leipziger Straße und den Linden hin und her, und wenn sie einige Sekunden an einem Schaufenster stehen blieben, so trieb ihre nervöse Unruhe sie bald weiter. Heimlich seufzend wußten sie, dass etwa um zwei Uhr mittags ihr Tagewerk wieder einmal vollbracht war. Um so mehr fiel in dieser wild hastenden Menge der junge Mann auf, der eben langsam um die Kranzlerecke bog. Seine elegante Kleidung war beschmutzt und hing ihm schlaff am Leib. Seine Wäsche war schmutzig, ebenso sein Modehut. Der Schlips saß schief und ließ den Kragenknopf sehen. Seinem Gesicht sah man die Vornehmheit zwar an, aber es war unrasiert, hatte tiefe Leidensfalten, und das Haar und der blonde Schnurrbart waren ungepflegt und vernachlässigt. Es war Soltau.
Soltau machte einen fast verkommenen Eindruck, schon von ferne sah man ihm an, dass er vielleicht seit Tagen aus den Kleidern nicht herausgekommen sein konnte. Langsam – es war gar kein Gehen zu nennen – schob er sich die Straße herab. Mechanisch ließ er sich von der vorwärtseilenden Menge weiterdrängen. Kam er einmal an einen Punkt, wo das Gedränge weniger stark war, so blieb er stehen und starrte lange und stier in die Luft. Die Leute sahen ihn an, er gewahrte nichts. Man stieß ihn an, er merkte nichts. An einer Straßenkreuzung blieb er wieder stehen, gerade vor einem Zeitungshändler. Der Mann bot seine Blätter laut brüllend an. Soltau hörte nicht, er sah in die Luft vor sich hin. Erst bei einem neuen Puff, den ihm ein Junge versetzte, schrak Soltau plötzlich zusammen. Er schien sich einen Moment zu besinnen, ballte kramphaft die Fäuste und ging mit sichtlicher Aufbietung der letzten Willenskraft in das Café hinein, vor dessen Eingang er gerade stand. Aber sofort kam der Oberkellner auf ihn zu: „Es tut mir leid, mein Herr, ich darf Ihnen nichts verabfolgen!“ Soltau wendete sich langsam um. Im selben Moment legte sich eine Hand auf seine Schulter: „Pardon, Herr Soltau – nicht wahr?“ Und jetzt fuhr Soltau mit einem Ruck zusammen. Nun, wo er seinen eigenen Namen hörte, kam er momentan zur Besinnung. „So ist mein Name!“ sagte er mechanisch in Erinnerung alter Formeln. „Darf ich Sie einen Moment bitten?“ sagte der elegante Herr vor ihm und winkte eine Droschke herbei. Soltau ließ sich ohne Widerstand in das Gefährt schieben, im Wagen aber sagte de Herr zu Soltau: „Herr Solatu, im Namen des Gesetzes, Sie sind verhaftet!“ Der Weg vom Polizeipräsidium zum Untersuchungsgefängnis dünkt manchem wohl wie eine Ewigkeit. Doch Soltau ertrug alles stumpf und gleichgültig. Er machte keine Bewegung des Ekels, als er zusammen mit Verbrechern und Dirnen transportiert wurde. Nur schien es, als grüben sich die Leidensfalten noch tiefer um den Mund. ...
Als die Tür der dämmerigen Zelle, in der er stundenlang teilnahmlos saß, klirrend geöffnet wurde, folgte er dem Wärter auf seinen Wink schweigend durch graue, unfreundliche Gänge, auf denen jeder Schritt im vielfachen Echo widerhallte. Endlich machten sie vor einer Tür halt. Der Wärter öffnete die Tür und schob Soltau in einen kleinen, hellen Raum mit kahlen, geweißten Wänden. Es war das Zimmer des Untersuchungsrichters. Der Untersuchungsrichter blickte in die Akten. ... „Sie sind der Fabrikdirektor Erich Soltau?“ fragte er dann. „Ja“, erwiderte Soltau gleichgültig. „Lesen Sie die Personalakten vor!“ sagte der Richter zu dem Schreiber, der an einem Tisch am Fenster saß. Der Schreiber las mit lauter, eintöniger Stimme. „Stimmt das?“ fragte der Richter. „Ja“, antwortete Soltau teilnahmlos. „Sie wissen, warum Sie verhaftet sind?“ fragte der Richter. „Nein!“ antwortete Soltau. Er hob zum ersten Male den Kopf und sah den Untersuchungsrichter an. Es war ein älterer Mann mit kahlem Kopf und nicht unfreundlichen Gesichtszügen. Die goldene Brille, die er trug, verhinderte, dass man allzusehr in seinen Augen lesen konnte. „Hm, Sie wissen also nicht, weswegen Sie hier sind,“ sagte der Untersuchungsrichter, „wissen nicht, wessen man Sie beschuldigt?“ „Nein!“ sagte still Soltau.
„Gut,“ sprach der Richter hinter seinem Pult, „so will ich es Ihnen sagen. Sie stehen in Verdacht, vorgestern nacht Herrn Brandorff aus seiner Wohnung mit Gewalt beseitigt zu haben!“ Soltau schwieg. „Was haben Sie dazu zu bemerken?“ fragte der Mann hinterm Pult. „Nichts!“ erwiderte Soltau. „Sie geben es also zu?“ „Nein!“ „Was soll das?“ Soltau zuckte die Achseln, er machte einen durchaus gleichgültigen Eindruck. „Behaupten Sie, vom Verschwinden des Herrn Brandorff nichts zu wissen?“ „Nein!“ „Sie wissen also etwas davon?“ „Ja.“ „Was wissen Sie?“ „Nichts!“ „Warum sagen Sie erst, Sie wüßten etwas von dem Verschwinden Brandorffs, und gleich darauf leugnen Sie es wieder ab!“ „Ich weiß eben nur die Tatsache des Verschwindens.“ „Seit wann wissen Sie darum?“ „Seit gestern vormittag!“ „Woher?“ „Von Rechtsanwalt Sanders.“
Der Untersuchungsrichter blätterte in den Akten, fand offenbar eine Stelle, die er gesucht hatte, und nickte mit dem Kopf. „Brandorff war Ihr Onkel?“ fragte der Untersuchungsrichter, „Ja.“ Dem scharfen Blick des Richters entging es nicht, dass die Stimme Soltaus hier nicht so teilnahmlos klang wie vordem; er fand im stillen, dass sie sogar einen trotzigen Ton hatte. Hier wollte er einsetzen. „Sie standen nicht sehr gut mit Ihrem Onkel?“ fuhr er fort. „Wer sagt da?“ Es war die erste energische Antwort aus Soltaus Munde. „Einwandsfreie Zeugen haben es bestätigt“, sagte der Richter. „Das geht niemand etwas an!“ erwiderte Soltau. „Doch – das Gericht geht es etwas an!“ sagte der Richter ruhig, Und er fuhr fort: „Sie haben vorgestern abend einen Streit mit Ihrem Onkel gehabt?“
„Das ist eine Lüge!“ fuhr Soltau erregt auf. „Doch,“ sagte der Richter sehr ruhig und suchte eine bestimmte Stelle in den Akten, „es ist so! Der Diener John hat es bezeugt.“ Soltau senkte seinen Kopf. „Der Diener John Barker behauptet, vorgestern abend habe Ihr Onkel bei seinem Zusammensein mit Ihnen befohlen, den Tee ins Billardzimmer zu bringen. Bei Ausführung dieses Auftrages sei er gerade ins Zimmer gekommen, als Sie und Ihr Onkel mitten in einem heftigen Wortwechsel standen. Beim Eintritt des Dieners hätten Sie beide plötzlich geschwiegen. Ist dies so?“ „Ja“, antwortete resigniert Soltau. „Sie hatten also mit Ihrem Onkel Streit gehabt?“ Soltau schwieg. „Bitte, geben Sie mir den Inhalt des Wortwechsels an. Um was handelte es sich eigentlich?“ Die Stimme des Untersuchungsrichters war schon ganz freundlich geworden, offenbar tat ihm die Hilflosigkeit Soltaus leid. Aber Soltau richtete sich energisch auf: „Ich verweigere die Auskunft!“ Unangenehm überrascht sah ihn der Untersuchungsrichter an. „Das ist Ihr gutes Recht. Aber ich mache Sie darauf aufmerksam, dass Sie die Folgen tragen müssen!“ Doch es schien, als prallte diese Ermahnung wirkungslos an Solatu ab. Er schwieg: eine kleine Pause entstand, während der der Untersuchungsrichter auf eine Antwort wartete. Man hörte nur die kritzelnde Feder des Schreibers.
„Sie haben also erst mit Ihrem Onkel Streit gehabt“, nahm der Richter den Faden wieder auf. „Die Leute im Hause sind zu Bett gegangen. Zu einer bestimmten Zeit haben Sie dann das Haus verlassen. Wann?“ Soltau gab keine Antwort. „Sie sprechen nicht? Gut, das wird Ihnen noch unangenehm werden. Sagen Sie mir, was ist denn geschehen, als John das Zimmer verlassen hatte?“ Soltau schwieg. „Hm. Ging Brandorff dann in sein Arbeitszimmer?“ Schweigen. „Wie lange ungefähr dauerte Ihr Streit?“ Schweigen. „Haben Sie Brandorff in sein Arbeitszimmer begleitet?“ „Nein!“ „Was taten Sie denn?“ „Ich ging weg.“ „Wie konnten Sie denn das? Das Haus war doch verschlossen, und alle schliefen schon!“ „Ich hatte einen Hausschlüssel!“ „Woher hatten Sie den? Sie wohnten doch nicht dort?“ „Das nicht. Aber bevor Fräulein Brandorff aus England zurückkam, bin ich oft zu später Stunde zu meinem Onkel gekommen“, entgegnete Soltau mit müder Stimme. „Er hat mir den Hausschlüssel gegeben, weil wir oft nachts zusammen in der Bibliothek arbeiteten.“ „Sie wissen also nicht, was dann mit Ihrem Onkel geschehen ist?“ „Nein.“
„Wollen Sie mir nicht sagen, wann Sie gingen? Das kann vieles für Sie erleichtern, und wenn Sie wirklich Ihre Hand nicht dabei im Spiele haben, kann es Ihnen von großem Nutzen sein!“ Soltau schwieg. „Mein Gott,“ sagte der Untersuchungsrichter etwas ungeduldig. „Sie schweigen immer, sobald ich eine wichtige Frage an Sie richte. Gut, beharren Sie bei dieser Taktik. Aber Sie werden die Folgen sich selbst zuzuschreiben haben! Antworten Sie mir: Was taten Sie dann?“ Soltau öffnete den Mund zum Sprechen, sah den Untersuchungsrichter starr an und brachte schließlich gequält und mit angetrockneter Zunge hervor: „Ich weiß nicht!“ „Was,“ rief der Richter, „Sie wissen nicht? Hören Sie, junger Mann, in Ihrem eigensten Interesse rate ich Ihnen, lassen Sie sich nicht auf derlei Antworten ein! – Sie wissen nicht? Wollen Sie etwa auch behaupten, Sie wissen nicht, wann Sie das Haus verlassen haben?“ „Ich weiß es nicht!“ „Sie wollen mir also keine Auskunft geben?“ „Ich kann nicht!“ „Warum nicht?“ „Ich wiederhole,“ sprach Soltau mit matter Stimme, „ich weiß nichts!“ Der Untersuchungsrichter machte eine kleine Pause. Auf einmal fragte er: „Sie sind Mitglied des Westen-Klubs?“
„Ja“, sagte Soltau mit erstauntem Blick. Wie kam das hierher? Der Richter blätterte eine Seite in den Akten um. Plötzlich traf er Soltau mit einem blitzenden Blick hinter den Brillengläsern: „Kennen Sie das?“ Und er hielt das kleine, seidene Band mit dem Monogramm des Klubs hoch. Mit ungeheucheltem Erstaunen, aber sichtlich ohne jede Verlegenheit, sah es an: „Ja – es ist das Abzeichen unseres Klubs!“ „Wissen Sie, wo es gefunden wurde?“ Ein fragender Blick Soltaus: „Nein!“ „Unter dem Fenster des Zimmers, aus dem Ihr Onkel verschwunden ist!“ Aber Soltau, anstatt niedergeschmettert zu sein, hatte plötzlich auf einen Moment sein weltmännisches Wesen wieder und fragte höflich: „Bitte – und?“ „Und – und?“ erwiderte erregt der Untersuchungsrichter. „Sie haben es da vorgestern Nacht verloren!“ „Unmöglich!“ entgegnete Soltau bestimmt. „Unmöglich?“ erwiderte erstaunt der Richter, der von seinem Worten eine niederschmetternde Wirkung erwartet hatte. „Warum unmöglich? Wieviel solcher Abzeichen besitzt jedes Klubmitglied?“ „Nur eins!“ „Nun – und? – Haben Sie etwa das Ihrige noch? Fragte gespannt der Richter. „Leider nein!“ gab Soltau verlegen zu.
„Also warum unmöglich?“ fragte der Richter, der sein Indiziengebäude, das ihm eben noch zusammenzustürzen drohte, wieder unversehrt dastehen sah. „Ich habe mein Abzeichen schon vor Monaten auf einer Segelpartie verloren.“ „Ah, Sie haben es auf dem Wasser verloren? Sie verstellen sich gut, das muss ich sagen, aber noch lange nicht gut genug für mich!“ „Ich weiß es nicht anders!“ verteidigte sich Soltau mit brechender Stimme. „Immer: Sie wissen es nicht anders. Sie wollen nicht sagen, worüber Sie mit Brandorff in Wortwechsel gekommen sind; ich nehme an, dass es ein Streit aus unlauteren Motiven war. Sie wissen nicht, wann Sie weggegangen sind; ich nehme an, dass Sie über Tätlichkeiten die Zeit vergessen haben. Sie wissen nicht, was Sie nach Ihrem Fortgang getan haben; ich nehme an, dass Sie mit der Beseitigung Brandorffs zu tun hatten. Sie wissen nicht, wie das Abzeichen des Klubs an jene Stelle kam; ich nehme an, Sie haben es dort verloren. – Erich Soltau, Sie sind verdächtig, Ihren Oheim Brandorff vorgestern ermordet und beseitigt zu“ - - Der Richter sprach seinen Satz nicht aus. Er sprang hinter seinem Pult hervor und fing den Wankenden in seinen Armen auf. Soltau war ohnmächtig geworden.
Die Verhaftung Soltaus traf Cecily wie ein Donnerschlag. Sie eilte sofort zu Sanders ins Bureau. Er führte sie in seine Privatwohnung und sah mit schweigendem Schmerz sie auf demselben Platz sitzen wie am Tage vorher Soltau. „Entschuldigen Sie, lieber Herr Sanders,“ sagte sie mit fliegender Hast, „mein unangemeldetes Kommen. Aber der Anlaß ist furchtbar. Denken Sie, Erich Soltau verhaftet wegen Mordes an meinem Vater – ich kann es kaum glauben. Und obendrein heißt das ja, dass mein Vater tot ist, dass er einen schrecklichen Tod gefunden hat. Oh, es ist entsetzlich!“ Dies war der Augenblick, den Sanders schon lange hatte kommen sehen, und vor dem ihm stets gebangt hatte. Er wollte Cecily in möglichst schonender Weise beibringen, was sich eigentlich abgespielt hatte. Aber Cecily ließ ihn nicht zu Wort kommen. „Nein, nein,“ rief sie, „bitte, sprechen Sie nichts! Ich weiß, Sie wollen mir beweisen, dass ich unrecht habe. Freilich bin ich ja nur ein Weib. Ich weiß, das ist meine Schwäche. Aber ist es nicht auch meine Stärke? Ihr Männer seid so gescheit und gelehrt, und was ihr mit eurem Verstande gefunden habt, darin vergrabt ihr euch dann; das baut ihr aus bis in die letzten Konsequenzen. Wir Frauen dagegen werden blindlings von unserem Instinkt geleitet. Eine innere Stimme ruft uns stets sofort zu: „Das ist so“, oder: „Das ist nicht so!“ Und es stellt sich immer heraus, dass diese innere Stimme recht hat. Und in diesem Fall sagte mir eine innere Stimme sofort: „Erich ist unschuldig!“
Durch Sanders’ Kopf ging blitzschnell die Erinnerung: hatte er nicht einmal einen Augenblick lang dieses schöne, begeisterte Mädchen geliebt? Und hatte er nicht sehr bald dieser Idee als hoffnungslos auf ewig entsagt? Fast unwillkürlich kam es ihm auf die Lippen: „Cecily, Sie lieben Soltau!“ Mit flammendem Gesicht hatte Cecily es gehört. Jetzt sah sie Sanders mutig an: „Und wenn es so ist? Ja, ich sage es Ihnen frei heraus, ich liebe Soltau! Und weil ich ihn liebe, darum bin ich auch fest davon überzeugt, dass er unschuldig ist!“ Seufzend dachte Sanders bei sich: „O Frauenlogik, Frauenlogik!“ Und laut sagte er: „Cecily, gerade weil Sie Soltau lieben, müssen Sie nicht sich, sondern die Welt von seiner Unschuld überzeugen!“ Aber Cecily trat ihm entgegen: „Wie könnte ich die Welt überzeugen, wenn ich nicht selbst überzeugt wäre! Das ist ein schlechter Verteidiger, der nicht zuerst an die Unschuld seines Klienten glaubt. Das wichtigste ist, Schritt für Schritt nachzuweisen, dass Erich an dem Verschwinden meines Vaters vollkommen schuldlos ist!
„Und gerade dieser Nachweis dürfte sehr schwer zu führen sein!“ unterbrach sie seufzend Sanders. „Aber so sagen Sie mir nur, warum!“ drängte Cecily. „Sehen Sie,“ gab Sanders zur Antwort, „meine Stellung ist die allerschwerste dabei. Sie wissen, wie befreundet ich mit Soltau bin. Ich kenne ihn, nun, gerade wie Sie und alle Welt, als frohen, heiteren, offenen Menschen, peinlich und sorgfältig bis ins Äußerste. Und nun denken Sie: man findet diesen Menschen wieder, verwüstet, gleichgültig, vernachlässigt, verbummelt. Das kommt ganz plötzlich, über Nacht. Man fragt: „Was ist los, was ist geschehen?“ Er sagt nur immer: „Fragt mich nicht – ich weiß nichts!“ Und nun denken Sie sich, stellt sich heraus, dass dieser Betreffende am Abend vorher mit seinem Oheim beisammen war; dass er mit diesem Oheim heftigen Streit gehabt hat, und dass der Oheim spurlos verschwunden ist. Der Neffe ist derjenige, der am sichersten über den Aufenthalt des Oheims im Hause reden kann, denn er hat ihn von allen im Hause Befindlichen zuletzt gesehen. Aber er gibt keine Auskunft, die Nacht, in der der Oheim verschwand, hat ihn verwandelt!“ „Hören Sie auf, Sanders,“ bat Cecily händeringend, „Sie töten mich!“ „Liebes Fräulein Cecily,“ entgegnete Sanders, „darf ich erbarmungsvoll sein? – Denken Sie sich weiter, der Betreffende, also der Neffe, ist Mitglied eines Klubs und hat als solches ein Abzeichen des Klubs. Und jetzt nach dem Verbrechen an seinem alten Oheim, wie er jede Fährte verwischen will, wie er auf die kühnste und raffinierteste Weise jede Spur von seinem Oheim beseitigen will, da verliert er an einer gewissen Stelle das Abzeichen.“
„O mein Gott – es kann nicht sein!“ stöhnte Cecily. „Ja, es ist so!“ bekräftigte Sanders mit unheimlichem Ernst. „Der Kriminalkommissar und der Untersuchungsrichter haben Soltau mit einem furchbaren Netz von erdrückendem Indizienmaterial umsponnen. Sehen Sie, Cecily, Soltau sagt immer „Nein“ und „Ich weiß nichts“. Der Untesuchungsrichter sagt sich: „Ich habe Zeit.“ Und er wird ihn so lange im Untersuchungsgefängnis halten, bis er eines Tages mürbe wird, und dann holt man aus ihm die Worte hervor: „Ja“ und „Es ist so!“ „Das darf nie sein!“ rief Cecily mit einem glühenden Rot der Entrüstung auf den Wangen. „Es darf nicht sein, und es kann auch nicht sein, Sanders! Meine tiefste, innerste Überzeugung sagt mir, dass Erich schuldlos ist. Ich liebe ihn, Sanders, ich liebe ihn! – Wissen Sie, was das heißt? Wissen Sie, wie ein liebendes Weib den geliebten Mann heimlich beobachtet, wie genau sie alle Gründe und Abgründe seiner Seele kennt? Wissen Sie, wie sie jedes Wort, das er sagen, jede Handlung, die er tun wird, vorhersagen kann? Sie kennt ihn so genau, fast genauer als er sich selbst. Und sehen Sie, Sanders, so kenne ich Erich Soltau. Und ich weiß, es lag niemals in seinem Charakter, ein Verbrechen zu begehen und noch viel weniger ein so kalt überlegtes, ein so grausam raffiniertes Verbrechen! Ich kenne ihn so genau, dass ich weiß: wenn jemals das Wort eines solchen Geständnisses über seine Lippen kommen sollte, so ist nur die Unmenschlichkeit der Untersuchungshaft daran schuld! „Aber doch,“ bemerkte Sanders zaghaft, „wenn nur keine Zeugen für seinen Streit mit Ihrem Vater da wären!“ „Zeugen?“ fuhr Cecily ganz erstaunt auf. „Zum ersten Male fällt mir dieses Wort ins Ohr. Wer können denn in unserem Hause diese Zeugen sein?“ „Der Diener John!“ betonte Sanders. „Sie waren ja selbst dabei, als er mir gegenüber seine erste Andeutung über diesen Punkt machte.“
„Ja, ich besinne mich jetzt,“ gab Cecily erregt zurück, „aber – großer Gott – ich hielt das bisher nur für ein leeres Gerede. Und John hat gelauscht und hat es dem Gericht gemeldet?“ Ein unheilverkündender Ausdruck trat in ihre Augen. Plötzlich fragte sie: „Hören Sie, Herr Sanders, Sie haben doch ein Telephon – wo ist es? Bitte, führen Sie mich hin!“ Sanders geleitete sie zum Apparat. Sie rief Amt und Nummer an, die Sanders sofort als die des Hauses Brandorff erkannte. Gespannt lauschte er. „Wer ist dort?“ rief eben Cecily durchs Telephon. „Sind Sie es, Lehnert?“ Und zum Portier sprach sie in den Apparat: „ Hören Sie einmal, Lehnert, rufen Sie mir sofort den Diener John an den Apparat.“ Nach einer kleinen Weile fragte sie: „Sind Sie es, John?“ Ihre Stimme hatte dabei etwas Hartes bekommen. Einen Moment Pause. „John, in Abwesenheit meines Vaters teile ich Ihnen mit, dass Sie entlassen sind! – Verlassen Sie sofort unser Haus, ich will Sie bei meiner Rückkunft nicht mehr antreffen. Ihr Lohn bis Ende des Monats wird Ihnen von der alten Martha ausgezahlt werden!“ Sie ließ den Hörer sinken. Sanders hatte, stammend über diesen heftigen Entschluß, zugehört. „Wenn das nur etwas Gutes wird!“ dachte er. Aber Cecily stand jetzt in ihrer ganzen Schönheit vor ihm. Mit blitzenden Augen sprach sie: „Sanders, ich will kein schwaches Weib mehr sein! Ich will sehen, ob ich nicht mit den Männern mitarbeiten kann – und ich kann es, seien Sie überzeugt! Ich werde Erich retten!“
VIII. Ein Weib wagt!
Cecily wollte also kampfbereit, zu allem entschlossen, hinaus ins gefährliche, wildwogende Leben treten, um einem anderen das Leben zu retten. Sie wußte wohl, wie unerfahren sie war, aber sie verließ sich bei ihrem Vorhaben auf den Instinkt des Weibes, des liebenden Weibes, der nie täuscht. Sie wußte, es war keine geringe Aufgabe, die sie sich gestellt hatte. Wie leicht konnte durch einen kleinen Fehler, ein Versehen der Gedanke von der Hauptspur abgelenkt werden! Aber was war wohl die Hauptspur, die wesentliche, wichtigste Fährte, die Sanders und der Kriminalkommissar gefunden hatten? Es war Nachmittag, und Cecily befand sich im Garten. Prüfend durchforschte sie alle die Wege noch einmal, die Sanders und Redberg in der Nacht abgesucht hatten. Sie ging um den Schuppen herum, und als sie auf der andern Seite des Hauses, unter dem Fenster des Arbeitszimmer war, konnte sie sich eines leichten Lächelns nicht erwehren, als sie an die nächtliche, unerwartete Begegnung zwischen Sanders und dem Kriminalkommissar dachte, von der Sanders ihr erzählt hatte. Doch als ihr Blick hinauf zum Arbeitszimmer schweifte, wurde sie plötzlich ernst. Dies war ja der Raum, in dem ihr Vater zum letztenmal geweilt hatte! – Oh, wenn doch ihr Blick die Mauern durchdringen könnte, wenn sie doch in das Geheimnis des kleinen Zimmers eindringen dürfte!
Sie stand in dem wundervollen Gründunkel, das die dichten Äste der alten Linde verbreiteten. Sie schloß im Schatten einen Moment die Augen: Oh, man müßte sich konzentrieren, mit Aufbietung aller Willenskräfte das Wesentliche der Spuren herausfinden können. Und sie irrte mit den Gedanken hin und her! Fast mutlos öffnete sie die Augen, um weiterzugehen. Da fiel ihr Blick auf einen kleinen, hellzitternden Fleck, den ein Sonnenstrahl, der sich durch eine Lücke im Laub stahl, auf der Erde hin und her tanzen ließ. Ihr fiel sofort Sanders’ Erzählung ein, wie er hier, an derselben Stelle, im Mondlicht das seidene Klubabzeichen gefunden hatte. Plötzlich durchschoß es sie wie ein Blitz. Das Klubabzeichen! Das war’s! Das war die Hauptspur. Sie rief sich alles ins Gedächtnis zurück, was Sanders berichtet hatte, wie der Kriminalkommissar daraus seine Schlüsse zog, wie er behauptete, Soltau müsse es hier bei einer Anstrengung, einem Kampf mit ihrem Vater verloren haben, und wie Soltau sein eigenes Klubband nicht zeigen konnte, sondern angab, er habe es vor Monaten schon verloren. Sicher lag hier eine Verkettung von unglückseligen Umständen vor. Sie glaubte Erich Soltau aufs Wort. Aber wenn er unschuldig war – und sie war davon überzeugt – irgend jemand mußte doch das kleine Seidenband verloren haben! Aber wer? – Natürlich ein Mitglied des Klubs. Doch wer konnte das sein? Sanders hatte es nicht verloren, und sonst kannte sie außer Soltau und ihm niemand, der Mitglied des Westen-Klubs war. Also hatte ein Unbekannter das Band verloren! O Gott, welch eine tolle Verwicklung! Sie war überzeugt, derjenige, der das Band hier innerhalb des Grundstücks verloren hatte, der wußte vom Verschwinden ihres Vaters, der war der Täter.
Die Spur führte also zum Klub hin, das war deutlich. Doch da fiel ihr ein: das erste und wichtigste war, diesen Klub kennen zu lernen, Einblick in ihn zu erhalten. Aber wie sollte sie das anfangen? Das einzige, was ihr bekannt war, bildete ein unüberwindliches Hindernis: der Westen-Klub war ein Herrenklub, in dessen Räume noch nie eine Dame Zutritt erlangt hatte. Und sie durfte doch niemand nach dem Klub fragen, das hätte die Leute unsicher und verwirrt gemacht, hätte Verdacht erregt. Dann wieder war es ihr klar, dass sie nur etwas erreichen könne, wenn sie mit eigenen Augen selbst beobachtete, sich Einblick in das Leben und Treiben des Klubs, Kenntnis seiner Mitglieder verschaffte. Schien das nicht unmöglich? In verzweifeltem Sinnen ging sie umher. Und doch gab es etwas, das für die Liebe unmöglich war?
Plötzlich kam ihr ein Gedanke. Ein energischer Zug überflog ihr Gesicht. Hochaufgerichtet ging sie ins Haus - - sie wußte: an die Tat, ans Werk und – mit List - ans Gelingen! Am Abend des folgenden Tages konnte man in einer weitverbreiteten Zeitung folgende Annonce lesen:
„Klubdiener gesucht. Nur Reflektanten, welche in vornehmsten Klubs tätig sind, wollen sich melden. V. 7. Postamt 9.“
Wenn jemand Cecilys Schritte beobachtet hätte, so hätte er sie eines Morgens aus dem Postamt am Potsdamer Platz kommen sehen können, in der Hand eine große Menge großer und kleiner Briefe, die alle die Aufschrift: „V. 7. Postamt 9“ trugen. Sie ging in eine nahegelegene Konditorei und begann die Briefe zu öffnen. Viele, viele teilten ihre Adresse mit, manche schickten Zeugnisabschriften und Photographie, und Cecily konnte sich eines Lächelns nicht erwehren, als sie flüchtig über jene so ungeheuer wichtig und würdig dreinschauenden Gesichter blickte. Einige ganz Leichtsinnige legten sogar ihre Originalzeugnisse und Briefmarken bei. Aber das, was sie suchte, schien nicht darunter zu sein. Mutlos öffnete sie noch eins der kleineren Kuverte, die ihr am wenigsten vertrauenerweckend vorkamen. Eine weiße Karte fiel heraus, nichts weiter. Sie las in dickgedruckten Buchstaben:
„Franz Hölzer, Diener des Westen-Klubs.“
Und darunter stand mit ganz passabler Handschrift:
„Stellt sich zur Verfügung.“
Fast hätte sie einen lauten Jubelschrei ausgestoßen. So hatte also ihre Idee mit dem Zeitungsinserat doch Erfolg gehabt! Sofort schrieb sie an den Mann einen Rohrpostbrief und ließ ihn zu sich kommen. Es war ein junger Mensch von fünfundzwanzig Jahren, der keinen Schnurrbart, sondern die Koteletten eines herrschaftlichen Dieners trug. Cecily hatte schnell ihren Plan gefaßt und teilte ihm mit, er könne durch eine kleine, mühelose Dienstleistung hundert Mark verdienen. Es handle sich um die Wette mit einer Freundin. Ob er es übernehmen wolle, sie an einem Abend in den Westen-Klub hineinzuschmuggeln? Der Mann war verlegen. Es handelte sich doch hier um einen Vertrauensbruch! Sie wisse doch, dass kein weibliches Wesen in die Klubräume eindringen dürfe! Aber Cecily beruhigte ihn sofort. Wie er so etwas nur gleich denken könne, es sei doch nur der Scherz eines jungen Mädchens, der für ihn ganz ungefährlich verlaufen werde. „Aber,“ warf der Mann ein, „wie wollen Sie denn hineinkommen? Nicht einmal zum Staubwischen dürfen Frauen ins Haus; selbst dazu sind Männer engagiert. Auch wenn Sie sich im Klub nicht zeigen würden, könnten Sie als Frau gar nicht hinein; der Kastellan paßt zu scharf auf!“
„Nun,“ rief Cecily lächelnd, „dann ist ja die Sache ganz einfach, ich ziehe mir eben Männerkleidung an!“ Verblüfft sah ihr Hölzer ins Gesicht. Aber Cecily fuhr fort: „Sie müssen mir unbedingt eine Klubdiener-Livree besorgen. Ich werde sie anlegen und am Abend, wenn die Gesichtszüge schwer zu unterscheiden sind, komme ich dann mit Ihnen zusammen ins Haus. Sie müssen wissen: ich will ja gar nicht in den Klub, ich will nur ein Plätzchen haben, von dem aus ich unbeobachtet die Herren sehen kann. Nicht wahr, Sie sehen, dass Sie bei diesem Scherz gar nichts zu fürchten haben?“ Das junge Mädchen sah so vertrauenerweckend aus, und die gebotene Entschädigungssumme war so hoch, dass der Diener nicht länger zögerte, auf ihren Vorschlag einzugehen.
Das vornehme, villenförmige Haus in der Tiergartenstraße, das die Behausung des Westen-Klubs bildete, lag am Tage still da. Kaum, dass dann und wann einmal der Briefträger kam oder ein Geschäftswagen Waren ablieferte. Die Portierstelle des Klubs wäre eine Sinekure gewesen, wenn der Pförtner sein Amt nur am Tage hätte verwalten dürfen. Aber abends wurde dieser Teil der Tiergartenstraße lebendig. Automobile fuhren hupend, mit ihren zwei glänzenden Lichtern vor, vorbei, um die Welte mit lautlos gleitenden Equipagen. Das Haus war hell erleuchtet, nur waren überall die Vorhänge vor die Fenster gezogen – doch der festlich helle Eindruck blieb. Elegante Herren im Gesellschaftsanzug, den Zylinder nachlässig nach hinten geschoben, durchquerten den kleinen Vorgarten, der die Straße vom Hauseingang trennte. Denn soviel Wagen auch vorfuhren: nur Herren entstiegen ihnen, nicht eine einzige Dame. Zwei junge Männer gingen eiligen Schrittes durch die Tiergartenstraße. Sie trugen beide die kleidsame Livree des Westen-Klubs, die nur gutgewaschenen Personen steht. Wo die Mütze die Ohren erreichte, da setzte bei beiden an der Wange ein blondes Kotelettbärtchen ein. Der eine der beiden Diener hatte die Mütze tief ins Gesicht gerückt, hielt den Kopf gesenkt und hatte sich fest in seinen Mantel gewickelt, trotzdem konnte er seinen hübschen Wuchs nicht verbergen, und er erregte die Aufmerksamkeit so mancher Kammerjungfer, die ihre abendlichen Freistündchen zu einem Spaziergang durch den Tiergarten benutzen wollte. Aber der junge Diener ging mit seinem Kollegen achtlos und eilig an den Blicken der bewundernden weiblichen Dienstboten vorbei, und er hob den Kopf erst, als sie vor dem Hause des Westen-Klubs angelangt waren.
Man wird mich doch nicht erkennen?“ flüsterte er leise. „Ausgeschlossen,“ antwortete der andere, „und dazu jetzt, wo es im Hause noch dunkel ist!“ Sie traten ins Haus, ohne dass der Pförtner ihnen Beachtung schenkte: es waren ja Klubdiener. Aber der eine Diener blieb im Hausflur einen Moment stehen und sah sich um, ein wenig länger, als das Diener gewöhnlich zu tun pflegen. Dann ging er langsam die breite Treppe mit dem dunklen, schön geschnitzten Geländer hinauf, musterte die interessanten Bronzefiguren der Treppen-Kandelaber und stellte für sich fest, dass es Kopien nach venezianischen Vorbildern waren. Auch dies war eine Tätigkeit, die Diener gewöhnlich nicht ausüben, und daran dachte der hübsche, junge Mann auch, als er sich plötzlich zusammenriß und seinen Kollegen leise fragte: „Und wo kann ich nun unbemerkt bleiben?“
„Kommen Sie nur mit,“ antwortete jener flüsternd. Sie waren offenbar die ersten im Haus. Unbemerkt stiegen sie die Treppen hinauf und kamen auf einen dunklen, kalten Bodenraum. Durch einige Gänge wanden sie sich an muffig riechenden Bretterverschlägen vorbei, dann hörte der letzte schwache Schimmer von der Treppe draußen auf. Hölzer nahm eine Taschenlampe heraus, und im kleinen Schein des elektrischen Lichtes sah Cecily, dass sie in einem ausgemauerten, viereckigen Raum stand, der nur den Eingang hatte, durch den sie eben gekommen waren, und in dessen schrägem Balkendach eine Öffnung zum Durchzug frischer Luft angebracht war. „Hier, sehen Sie,“ sagte Hölzer und deutete auf den Fußboden, „hier, dieses runde Loch schließt den Hauptventilator im großen Saal ein. Der Ventilator hat zwei große Flügelräder, die beide von verschiedenen Seiten gegeneinander rotieren. Wenn er feststeht, wie jetzt, so können Sie bequem hindurchsehen!“ Cecily beugte sich herab und sah zu ihrem Erstaunen, dass sie eine fast vollständige Übersicht über die Klubräume hatte, die alle kreisförmig mit durchbrochenen Wänden oder Glastüren um den großen kuppelförmigen Speisesaal angeordnet waren.
„Ich muss jetzt meinen Diest antreten,“ sagte Hölzer. „Vorher will ich aber noch den Motor vom Ventilator abkuppeln, damit Ihnen nicht etwa ein Unglück geschieht. Denn Gnade Gott dem Körperteil, der zwischen die beiden scharfen Rotationsflügel kommt.“ Er löste die Verbindung und ging, Cecily im dunklen, zugigen Raum in der ungewohnten Lage des Lauschers zurücklassend. Noch war es früh. Die meisten Mitglieder des Westen-Klubs saßen an den kleinen Tischen des Speisezimmers, das vom Plafond angenehm matt beleuchtet war, während auf den gedeckten Tischen zierliche Leuchtkörper, die sich hinter cremefarbenen Lampenschirmchen verbargen, jenes wundervoll diskrete Licht verbreiteten, das die Verdauungsnerven so ungemein sympathisch berührt. Man hörte hier ab und zu ein leises Wort, sonst war nur das zarte Geklapper von Messer und Gaben vernehmlich. Ein Teil der Mitglieder war im Lesezimmer. Dieses war vom Speisesaal durch eine riesige, hohe, durchsichtige Glastür getrennt, die geräuschlos auf und zu ging. Tiefe, breite, schwere Leder-Klubsessel luden hier geradezu ein, sich hinter Zeitungen und Zeitschriften zu vergraben, und es gab da ausländische Zeitungen von so riesigen Formaten, dass man von den Lesenden nur noch ein Paar Beine sah, die aus dem dunklen Leder der Klubsessel herauswuchsen.
Im Spielzimmer waren jetzt noch am wenigsten Leute. Nur ein paar besonders eifrige Spieler hatten an einem der kleinen, grünen Tischchen in einer Nische zusammengefunden und schienen stundenlang hier sitzen zu wollen, in ihr Spiel vertieft. Aber allmählich füllte sich das Spielzimmer. Je später es wurde, desto lebhafter ging es in den Klubräumen her. Es war ein unaufhörliches Kommen und Gehen. Manche der Herren kamen gerade aus dem Theater. Diskussionen wurden begonnen, andere fortgesetzt, laut schwatzend drängten die Leute ins Spielzimmer. Die Luft wurde allmählich von dem Rauch der schweren Zigarren bläulichgrau. Hinten am Büffet, wo die Eisgetränke standen, scharten sich die Herren mit der blitzenden Hemdbrust, um rasch im Stehen die amerikanischen Cocktails herunterzugießen. Um die grünen Spieltische sammelte man sich immer dichter. Die eigentümlichen Worte des Spielerjargons drangen an Cecilys Ohr, diese merkwürdige Mischung aus englischen Brocken und deutschen Übersetzungen englischer Ausdrücke, von denen sie das meiste gar nicht verstand. Es war ein buntes Gedränge um den Tisch, das Cecily fast in Verwirrung brachte.
Dennoch hörte sie zu ihrem Erstaunen jemand sagen: „Kinder, das ist ja heute gar kein Leben hier! Ihr spielt ja mit einer Schlappheit, als wenn der Westen-Klub ein Kaffeekränzchen wäre!“ Sofort rief ein anderer: „Friesack hat vollkommen recht! Ein so langweiliges Tempo habe ich noch nie erlebt!“ Darauf antwortete eine Stimme: „Das kommt bloß daher, weil Mohl noch nicht da ist. Wir arbeiten uns die Seele aus dem Leibe, und er amüsiert sich irgendwo und läßt seine Freunde sitzen!“ Die Stimmen gingen durcheinender. Plötzlich warf einer der Spieler seine Karten auf den Tisch und rief: „Meine Herren, nehmen Sie es mir nicht übel, aber ich spiele nicht weiter, ich warte bis Mohl kommt. Die Sache ist mir zu öde!“ „Bitte, wer braucht mich?“ rief da plötzlich laut eine etwas näselnde Stimme von der Tür des Speisezimmers her. Herr von Mohl schritt schnell durch den Schwarm der Menschen an den Spieltisch, überall von freudigen Zurufen und Händedrücken begrüßt.
Die übrigen Spieler hatten Cecily gleichgültig gelassen. Aber Herr von Mohl erweckte sogleich bei seinem Eintritt ins Spielzimmer ihr lebhaftestes Mißbehagen. Er war tadellos gekleidet. Im Knopfloch die blasse Orchidee hob noch die Sorgfalt seines Anzugs. Sein Gesicht verriet die vornehme Abkunft, aber etwas in diesem Gesicht, in dem dunkle Ränder unter den Augen von durchwachten Nächten erzählten, eine tiefe Lasterhaftigkeit des Ausdrucks, etwas unangenehm Lauerndes im Auge stießen Cecily außerordentlich ab. Dennoch schien sonst niemand diese unangenehmen Züge an Herrn von Mohl zu bemerken. Im Gegenteil, Cecily konnte sehen, dass er gerade im Klub außerordentlich beliebt war. Man drängte sich zu ihm, plauderte, ließ sich Witze erzählen, kurz: man behandelte ihn als den Löwen der Gesellschaft.
Dabei konnte Cecilys scharfe Beobachtung gewahren, dass Herrn von Mohls Benehmen, gar nicht zu den Zügen paßte, die sie ihm gleich bei seinem Eintritt vom Gesicht abgelesen hatte. Er scherzte, lachte, ging freimütig herum, war redselig, kurz, er benahm sich mit einer Ungezwungenheit, die Cecily nicht für echt hielt. Sie beschloß, jedenfalls: gerade ihn sorgfältig im Auge zu behalten. Aber Herr von Mohl spazierte nicht lange mehr plaudernd im Spielzimmer herum. Als einer der Spieler aufstand und ins Spielzimmer ging, nahm Mohl seinen Platz ein. Bald hatte er die Bank. Als ob sich die Atmosphäre mit einem Male verändert habe, verwandelte sich plötzlich wie durch Zauberschlag das Benehmen der Spieler. Die Karten flogen nur so, und die Marken, die das Geld ersetzten, klirrten hell und metallisch auf dem grünen Tuch. Es wurde weniger gesprochen und das wenige hastig und kurz. Die Erregung wuchs, niemand machte mehr einen Witz oder zeigte Luft, über den eines anderen zu lachen. In dichten Scharen standen die Nichtspielenden um die Spieltische gedrängt und nur manchmal schwoll ein erregtes Gemurmel an, wenn jemand ein großer Bluff gelungen war.
Die Luft hatte sich in eine erhitzt schwingende Atmosphäre gewandelt. Die Ventilatoren an den Fenstern arbeiteten unaufhörlich, aber die wilden und heißen Gelüste der Spieler wurden davon nicht abgekühlt. Mohl hielt die Bank. Gerade über ihm hing ein elektrischer Leuchtkörper von der Decke herab – ein bronzenes Weib, das auf einer Kugel tanzte, und beleuchtete scharf sein bleiches Antlitz. Das Glück wechselte bei ihm beständig. Einamal gewann er sehr viel, ein andermal verlor er sehr hoch. Es war jener für den Spieler so unerträgliche Zustand, in dem Licht- und Schattenseiten sich die Wage halten. Der echte Spieler kann nur eins von beiden leiden: entweder gewinnen oder verlieren, aber beides hoch! Doch Herr von Mohl ließ sich seine Ungeduld nicht anmerken. Nur die Falten um seine Mundwinkel wurden tiefer und die Schatten unter seinen Augen dunkler. Cecily beobachtete ihn mit gespannter Aufmerksamkeit. Sie blickte wie hypnotisiert auf ihn. Irgendein dunkles Gefühl sagte ihr, dass dieser Mann noch zu ganz anderen Dingen fähig war, als am Spieltisch des Klubs wie ein Tollkühner zu hasardieren – zu verruchten und verrückten Dingen. Denn sie, als die einzige Unbeteiligte, die nichts vom Spiel verstand, wandte ihre ganze Aufmerksamkeit auf die Beobachtung Mohls. Und so sah sie in Momenten, in denen er sich unbeobachtet glaubte, tausend kleine, wilde Züge über sein Gesicht huschen, die bezeugten, dass seine leichtsinnige, harmlos erscheinende Naivität nur eine große, kunstvolle Verstellung war.
Mohl verdoppelte die Einsätze. Er verlor. Er verdreifachte, ohne dass sein Benehmen äußerlich Erregung gezeigt hätte, aber die Aufregung der Menschen um ihn wuchs. Er verlor. Wie etwas ganz Selbstverständliches verdoppelte er die verlorene Summe. Er verlor. Ein neues Spiel begann; Mohl setzte sofort zu Anfang das Doppelte der verlorenen Summe. Das Summen um ihn wuchs, alles wartete. Plötzlich sah Cecily Mohl leicht zusammenzucken. Das Geräusch eines vorfahrenden Wagens war unten in der stillen Nacht hörbar geworden. Mohl wurde sichtlich nervös, er spielte nicht aus, sondern sah auf seine Uhr. Einen Moment erhob er sich leicht: „Ich bitte, die letzte Karte anfangen zu dürfen!“ rief er in bestimmtem Ton. Alle bisherige Ruhe und Besonnenheit schien ihn verlassen zu haben. Cecily kam es vor, als griff er blindlings nach einer beliebigen Karte und werfe sie hastig auf den Tisch. „Dame liegt links!“ rief die schrille Stimme des Bankhalters, der den Gewinn rasch einstrich.
„Auch gut!“ rief Mohl. Er sprang auf, warf im Stehen seinen Verlust auf den Tisch und sagte: „Ja, heute haben Sie eben die bessere Hand! – Aber zum Teufel noch mal, ich kann nicht mehr. Hier herrscht eine unerträgliche Hitze. Ich kann es nicht mehr aushalten!“ „Aber die Ventilatoren laufen ja in einem fort, dass uns nur so die Ohren sausen!“ antwortete der Bakhalter. „So?“ sagte nervös Mohl und strich sich hastig mit de Hand über die Stirn. „So? Aber meine Herren, das genügt eben nicht. Wenn Sie nicht den großen Ventilator gehen lassen, werden Sie hier nie eine erträgliche Temperatur haben!“
Ein maßloser Schreck stürzte sich auf Cecily. Das Herz schien ihr einen Moment lang stillzustehen. Mit einem Ruck richteten sich die Augen beinahe aller Anwesenden zur Decke und sahen auf den großen Ventilator, hinter dem sie verborgen war. Ein Diener ging zum Fenster, an dem die Drehkontakte für den Ventilatorbetrieb angebracht waren, und schaltete den Strom ein. Aber der Ventilator rührte sich nicht – Cecily wußte ja nur zu gut, warum. „Sie sehen, meine Herren,“ sagte Mohl schneidend und nervös, „die Sache funktioniert nicht einmal. Entschuldigen Sie mich, bitte, ich halte es nicht länger in der Hitze aus, ich muss weg!“ „Muss repariert werden!“ rief eine Stimme. „Mohl hat recht. Gleich jemand rausschicken, der die Sache in Ordnung bringt!“
Cecily sprang schnell auf. Jetzt war die höchste Gefahr da. Wenn jemand hinaufkam, mußte sie unbedingt entdeckt werden. Instinktiv sah sie noch einmal rasch hinunter. Mohl ging gerade zur Tür hinaus. „Donnerwetter, Unglück im Spiel!“ rief einer hinter ihm her. „Na, wer wo anders Glück hat – ich bitte Sie!“ lachte ein anderer. Cecily schlüpfte in den Mantel. Doch schon kamen Schritte die Treppe herauf. Wo sollte sie hin? Sie drückte sich an die Wand – vielleicht bleib sie da unbemerkt. Doch nein, sie wußte ganz genau, dass das ausgeschlossen war. Hier in diesem engen Bodenraum mußte sie entdeckt werden. Was sollte nun geschehen? Die Schritte kamen schnell näher. Welche Ausrede sollte sie brauchen? Es war gar keine Ausrede möglich, jede war lächerlich. Man hätte sie ins Licht geführt und bei genauer Betrachtung sofort gesehen, dass sie ein Weib war. Da – trat der Mann hinein in den Bodenraum. Schon hatte sie den verzweifelten Gedanken, sich ihm entgegenzuwerfen – sie, das schwache Weib, in der Dunkelheit ihn zu bewältigen – da blitzte plötzlich der Strahl einer elektrischen Taschenlampe auf. Sie stand wie gelähmt – doch in diesem Moment flüsterte ihr eine Stimme zu: „Machen Sie schnell, dass Sie unbemerkt aus dem Hause kommen – der Ventilator ist aufgefallen!“ – Es war der Diener Hölzer.
Cecily atmete tief auf. Alles war noch gut, nichts war verloren. Sofort war ihre Geistesgegenwart wieder da. Schnell schlüpfte sie aus dem Raum, und ohne dass sie besonders auffiel, gelang es ihr, die Treppe hinunterzulaufen. Gerade vor ihr ging Mohl. Leichtfüßig sah sie ihn die Treppe hinabeilen. Und in diesem Moment war ihr plötzlich wieder das Ziel ihres Hierseins, das sie in der Gefahr beinahe hatte vergessen können, klar. Wie von einer geheimen Macht getrieben, folgte sie unauffällig Mohl. Das flackernde Dämmerlicht im Flur des alten Hauses und die Dunkelheit der Straße begünstigten es, dass niemand sie zu beachten schien. Unten hielt ein Coupé, aus dessen geöffneten Wagenschlag Cecily ein dämonisch schönes Weib sich beugen sah. Dichtes, knistrend schwarzes Haar umflocht das bleiche, klassische Profil ihres Kopfes, aus dem zwei schwarze Augen wild, glühend und gebieterisch hervorleuchteten. „Kommst du endlich?“ rief sie Mohl entgegen, als er noch im Flur des Hauses war.
„Verzeih’, dass ich dich warten ließ!“ versetzte er in einem Ton, dem das Befehlshaberische, das er im Klub gehabt hatte, fehlte. Er eilte über den Vorgarten und sprang ins Coupé. Der Wagenschlag klappte zu, der Kutscher schmitzte mit der Peitsche, und die beiden Rappen setzten sich in Bewegung. Jäh durchschoß Cecily der Gedanke: „Folge ihnen!“ – Nur wie? Da fiel ihr ein, wie es die Straßenjungen machen, die sich hinten an den Stangen des Wagens anklammern. Sie sprang schnell durch den Vorgarten und lief hinter den Wagen, um sich heimlich in der Nacht hintaufzusetzen. Aber bevor sie noch den Wagen berührt hatte, sprang aus dem dunklen Schatten der Bäume ein kleiner Kerl hervor, der eine Tuchmütze weit ins Gesicht gezogen und den Rockkragen aufgeklappt hatte. Er stieß einen zweimaligen, gellenden Pfiff aus und umschlang Cecily von hinten mit seinen Armen. Der Wagen sauste davon. Und ehe Cecily sich noch recht besinnen konnte, was eigentlich geschehen, war der Unbekannte schon wieder im Dunkel der Nacht verschwunden. Der Gedanke durchzuckte sie: „Ich bin beobachetet worden!“
Und der Wagen war fort. Sie fühlte sich verzweifeln. In höchster Besorgnis, jemals auch nur die geringste Spur zu finden, ging sie durch die nächtigen Straßen nach Hause zurück. War nun nicht alles aus? Man hatte sie sogar bemerkt! Man entzog sich ihrer Beobachtung! Nein, durchschoß es sie plötzlich, es war nicht alles aus! Wenn jene bemerkt hatten, dass sie beobachtet wurden, war das nicht ein Grund, anzunehmen, diese Beobachtung sei ihnen höchst unangenehm, sie hätten sie zu scheuen? Und auf einmal kam es ihr wie ein Licht: Hier war die Spur, die Hauptspur, das Wesentliche. Und ohne dass sie im Moment auch nur das Kleinste hätte beweisen können, sagte sich ihr dunkler Fraueninstinkt sofort: „Mohl, das unbekannte Weib und der vermummte Komplice – diese Leute haben meinen Vater beseitigt!“ Ich habe sie, ich habe sie! Und sie frohlockte wild: „Hier ist ein Anfang!“
IX. Erinnerungen.
Der Untersuchungsrichter wollte einen neuen Versuch mit Solatus Verhör machen. Der Wärter, der den Gefangenen holen sollte, sah, als er sich an der Zellentür befand, vorsichtig und neugierig durch das Guckloch der Tür. Er sah den Gefangenen in dem trüben Dämmerlicht des kleinen, kahlen Raums apathisch dasitzen, den Kopf in beide Hände gestützt, offenbar ganz in sich versunken. Jetzt sah Soltau auf, er hatte wohl Geräusch gehört. Spähend glitt sein Auge über Wände und Tür der Zelle, erreichte das Guckloch und erblickte dahinter das forschende Auge des Wärters. Aber der Wärter sah zu seinem Erstaunen, dass die Miene des Gefangenen nicht jenen scheu zusammenzuckenden, geduckten Ausdruck annahm, wie es sonst geschieht, wenn Gefangene sich vom Wärter durch das Guckloch beobachtet finden. Soltau blickte ruhig und gleichgültig auf den schmalen Spalt, durch den er einem anderen Menschen ins Auge sah. Gleichgültig war der Hauptausdruck auf Soltaus Zügen. Mit Verwunderung sah es der Wärter. Und da ihm eine feinere Kenntnis der menschlichen Seele fehlte, da er nicht auf den Gedanken kam, dass seelisches Leiden den Menschen ganz abstumpfen kann, so sagte er sich: „Das muss ein ganz Verstockter sein – der hat ja nicht einmal Angst vor mir!“
Die Tür klirrte auf – jedes kleinste Geräusch wurde hier vom Echo zurückgeworfen – und Soltau trat von neuem den Gang über die hallenden, trübseligen Korridore zum Untersuchungsrichter an. Mit gleichgültigem Blick sah er zum zweiten Male das Zimmer mit den weißgestrichenen Wänden, den Schreiber am Fenster und den Untersuchungsrichter mit der goldenen Brille hinter seinem Pult. Der Richter dagegen wollte ihn zur Ungeduld zwingen. In der Erregung machen die meisten Menschen viel leichter die schwerstwiegenden Geständnisse. Doch Soltau blieb teilnahmlos. Der Richter merkte es und ärgerte sich. Der Plan war mißglückt.
Er räusperte sich und begann; „Nun, sind Sie unterdessen schon vernünftig geworden?“ Soltau schrak plötzlich zusammen und blickte den Sprechenden verständnislos an. „Ich meine,“ fügte der Richter hinzu, „haben Sie sich schon eines Besseren besonnen?“ Soltau sah ihn an wie ein Kind einen Prediger. „Hören Sie,“ sagte der Richter mit ein wenig Mißmut in der Stimme, „vestellen Sie sich nicht! Das kann Ihnen nur schaden. Sie sind geistig vollkommen gesund. Oder wollen Sie etwa behaupten, dass dies nicht der Fall ist?“ „Nein, ich bin gesund.“ „Nun also, haben Sie mir nichts mitzuteilen?“ „Nein.“ „Wieder sagen Sie nein! – Sie verschärfen dadurch nur Ihre Lage. – Hören Sie lieber auf mich. Sie sind noch ein junger Mann.- Sie sehen, ich stehe Ihnen wohlwollend gegenüber. Legen Sie ein offenes Geständnis ab, und ich werde veranlassen, dass das strafmildernd in Betracht gezogen wird.“ „Ich habe nichts zu gestehen!“ sagte Soltau mit der Stimme eines sehr müden Menschen. „Sie leugnen also, sich an Brandorff vergangen zu haben?“
„Ich leugne nichts, denn ich habe nichts begangen.“ „Sie haben Brandorff ermordet! Geben Sie das zu?“ „Nein!“ „Sie haben dann den Leichnam fortgeschafft!“ „Nein!“ „Ich verlange von Ihnen nur zu wissen, wie Sie es getan haben!“ Aber Soltau wiederholte nur immer wieder wieder tonlos murmelnd: „Nein, ich habe nichts getan, ich habe nichts getan!“ Der Untersuchungsrichter sah, dass es ihm nicht gelang, den Verhafteten zu überrumpeln. Mit fast resigniertem Ton sagte er: „Ihre Verstocktheit zwingt mich nur, wieder ganz von vorn anzufangen!“ Doch Soltau vor ihm machte ein Gesicht, als wolle er sagen: „Bitte, köpft mich doch gleich – es ist mir ganz egal!“ „Erinnern Sie sich an die Nacht vom 29. zum 30. Juni?“ fragte der Richter. „Ja!“ „Waren Sie damals im Hause Ihres Onkels Brandorff?“
„Ja!“ „Haben Sie mit ihm gesprochen?“ „Ja!“ „Was haben Sie mit ihm gesprochen?“ „Wir sprachen über ein Rennen in England!“ „Der Diener John bezeugt, Sie hätten mit Ihrem Onkel einen heftigen Streit gehabt. Stimmt das?“ Einen Moment Zögern, dann:“ Ja!“ „War der Streit im Anschluß an das erste Gespräch entstanden?“ „Nein!“ „Wann kamen Sie an dem Abend ins Haus Ihres Onkels?“
„Um halb zehn!“ „Wann entstand der Streit?“ „Später.“ „Viel später?“ „Ja.“ „Sagen Sie mir den Inhalt Ihres Streites!“ „Nein!“ „Warum nicht?“ „Ich verweigere die Auskunft!“ „Handelte es sich um geschäftliche Angelegenheiten?“ „Ich verweigere die Auskunft!“ „Betraf der Streit Ihr Privatleben?“ „Ich verweigere die Auskunft!“ „Schön, Sie verweigern die Auskunft, sehr schön! Also dann, was geschah dann?“ „Ich ging weg.“ „Ohne sich von Ihrem Onkel zu verabschieden?“ „Ja!“ „Wie gingen Sie weg? Es sind zwei Ausgänge da, einer durch die Galerie und eine Hintertreppe aus dem Arbeitszimmer Ihres Onkels.“
„Den Hauptausgang durch die Galerie!“ „Gingen Sie in den Garten?“ „Nein!“ „Gingen Sie geradeswegs herunter und verließen das Haus durch die Haustür?“ „Ja.“ „Hielten Sie sich gar nicht weiter in der Umgebung des Hauses auf?“ „Nein.“ „Wann war das, als Sie weggingen?“ „Ziemlich spät!“ „Wissen Sie wann?“ „Nein.“ „War es noch Nacht oder schon Morgengrauen?“
„Ich weiß nicht.“ „Was taten Sie dann?“ „Ich ging weg.“ „Das haben Sie schon gesagt. Wohin gingen Sie?“ „Ich weiß nicht.“ „Wo hielten Sie sich bis zum Vormittag des folgenden Tages auf?“ „Ich weiß nicht!“ „Sie wissen nicht? Gut! Woher haben Sie die aufgeschürften Hände?“ Soltau betrachtete seine Hände. Die Handflächen hatten Rißwunden. Er hatte es bis dahin in seiner Apathie noch gar nicht beachtet. „Ich weiß nicht!“
„Gut, gut!“ sagte der Untersuchungsrichter. „Es ist mir sehr interessant, was Sie sagen. Sie wissen also nichts? Nun, dann will ich Ihnen sagen, was ich weiß, und ich werde verschiedenes richtigstellen, was Sie mir unrichtig sagten! Fürs erste, Sie verließen das Haus nicht durch die Galerie und den Vorderausgang, sondern durch die Tapetentür im Arbeitszimmer. Sie gingen durch den Garten. Sie hatten einen Kampf mit Brandorff, dabei rissen Sie sich die Hände aus, sie befleckten dabei Ihr Klubband und verloren es unter der großen Linde!“ Dabei hielt er das kleine Seidenband ihm vor Augen, das er den Akten entnommen hatte. Es hatte in einer Ecke einen kleinen rötlichen Streif: offenbar Blut. „Sie können sich hier nicht ausreden,“ fügte er hinzu, „es ist chemisch untersucht worden, die rote Stelle ist Menschenblut! Was haben Sie begangen? Gestehen Sie es – gestehen Sie alles !“
Der Untersuchungsrichter war aufgestanden. Hinter der goldenen Brille funkelten seine Augen. Seine Stimme dröhnte: „Erich Soltau, sagen Sie, was Sie wissen! – Sprechen Sie! Von Ihrem Wort wird es abhängen, ob man gegen Sie wegen Totschlags oder wegen Mordes verhandelt. Denken Sie: Mord, Mord! Und auf Mord steht das Schafott! Sprechen Sie. Es handelt sich um Ihren Kopf!“ Doch Soltau sah dem Richter gleichgültig in die Augen. Er zuckte nicht zusammen, als er mit der leisen Stimme eines unendlich Gequälten erwiderte: „Das ist eine Folter! – Ich habe nichts zu sagen!“ Nach diesem Wort klappte der Richter die Akten zu und drückte auf eine Klingel. Der Wärter kam, und der Untersuchungsrichter ließ Soltau wieder in die Haft zurückführen, nicht ohne ihm vorher zugerufen zu haben: „Sie werden schon noch reden!“
Als die Kunde von Soltaus Verhaftung zu Rechtsanwalt Sanders drang, hatte sich dieser sogleich entschlossen, Soltaus Verteidigung zu übernehmen. Er forderte die Akten ein. Aber ihre Lektüre erfüllte ihn mit der höchsten Bestürzung. Alles, was seine eigene Logik in diesen Tagen ihm für die Schuld des Freundes zugeflüstert hatte, fand er hier hundertmal und aber hundertmal bestätigt von den Indizien des Untersuchungsrichters und von der Logik der erbarmungslosen schwarzen Buchstaben auf den kalten, weißen Aktenbogen. In fürchterlicher Weise sah er so sein eigenes Denken gegen den Freund gerichtet, und je mehr er sich in das Aktenmaterial vertiefte, um eine Lücke der Beweisführung zu finden, die es Soltau ermöglichen konnte, frei auszugehen, um so dichter sah er das Netz der Schuld sich um den Freund verstricken. Dennoch, konnte es möglich sein? Wie hatte es nur geschehen können? Und er beschloß, seine Pflicht als Freund und als Rechtsanwalt zu tun und Soltau im Gefängnis aufzusuchen. Es war ein betrübendes Bild, das sich dem Rechtsanwalt bot, als er zu Soltau in die Zelle trat.
In seinem Beruf hatte er schon oft jene Besuche im Gefängnis machen müssen, welche zu seinen traurigen Pflichten gehörten. Aber jetzt dort jenen Mann wiederzutreffen, den er sonst nur aufs sorgfältigste gekleidet und in heiterer Gesellschaft gesehen hatte, davor graute ihm. Und doch mußte es sein. Als die Tür der Zelle sich hinter ihm schloß, war sein erstes Wort, das er erregt ausstieß, nur, um seiner tiefen Erschütterung keinen Platz zu gönnen: „Erich, ich werde dein Rechtsanwalt sein!“ Denn das Bild, das sich ihm hier bot, übertraf seine schlimmsten Befürchtungen.
Der Untersuchungsgefangene trägt nicht etwa Gefängniskleidung, sondern seine eigenen Sachen. Für alles, was sich auf die körperliche Instandhaltung bezieht, hat er selbst und auf seine eigenen Kosten Anordnung zu treffen. Und nun gewahrte Sanders, wie schwer sich Soltaus Apathie rächte. Des Gefangenen Gesicht starrte ihm entgegen, schmutzig, unrasiert. Seine Kleidung, ein hocheleganter Straßenanzug, der noch vor wenigen Tagen seine Gestalt aufs vorteilhafteste zur Geltung gebracht hatte, hing ihm vernachlässigt um den Leib. Soltau war schrecklich abgemagert. Man sah, alles war ihm gleichgültig, er kümmerte sich um nichts.
Als er Sanders eintreten sah, war seine erste Bewegung die, stürmisch aufzuspringen und den Freund zu umarmen. Aber sofort ließ er sich mit einer Gebärde der tiefsten Hoffnungslosigkeit wieder zurück auf seine Pritsche sinken. Sanders sah diese Bewegung mit einem Schmerz, der ihm fast die Kehle zuschnürte. Hatte Soltau schon aller Hoffnung entsagt? Oh, dann war alles verloren! Er näherte sich ihm, setzte sich auf den Rand der Pritsche und legte sanft seinen Arm um Soltau. „Sieh’ Erich, ich bin hier“, sprach er leise. „Ich will deine Verteidigung übernehmen. Wir alle sind überzeugt, dass du schuldlos bist!“ Oh, er wußte nur zu gut, wie er log!
Soltau kehrte ihm ein schmerzverzerrtes Antlitz zu. Seine Augen lagen glanzlos, wie erloschen, in dunklen Höhlen. Und mit erstickter Stimme brachte er hervor: „Es hat gar keinen Zweck. Du bist sehr gut! Ich danke dir – aber geh’ nur wieder!“ Doch Sanders’ Opposition war durch die verstockte Resignation des Freundes im heftigsten Sinne rege geworden. Nein, so leicht sollte ihm seine Aufgabe doch nicht gemacht werden. Er wußte, wie ein Unglücksfall die Menschen oft ganz weich, oft aber auch ganz starrköpfig macht. So leichten Kaufes sollte ihn dieser Starrköpfige da nicht loswerden. Es galt, diese Hartnäckigkeit, wenn nicht anders, so mit List zu besiegen. Zart wandte er sich zu Soltau: „Ich weiß, Erich, sie quälen dich! Aber glaubst du, dass ich, dein alter Freund, zu gleichem Zwecke hergekommen bin?“
Da plötzlich konnte Soltau nicht mehr an sich halten und brach in ein furchtbares, leise, nervenschütterndes Schluchzen aus. Sanders fühlte sich bis ins Innerste gepackt. Aber er wußte wohl, dass er diese Stimmung jetzt nicht aufkommen lassen durfte, wenn er seinen Zweck bei Soltau durchsetzen wollte. Er schlug also einen scheinbar jovialen Ton an: „Na, höre mal, alter Knabe! Wer wird denn auch gleich den Mut so sinken lassen! Denke dir doch, Erich, du selbst weißt ja am besten, dass du unschuldig bist! – Sieh’ mal, ich weiß ja ganz genau, wie dich die letzten Tage mitgenommen haben. Aber du mußt doch auch bedenken, dass nur deine Worte allein dir bei einem so schwierigen Fall helfen können! Also sage mir, Erich, was ist vorgefallen? Was weißt du?“
Soltau bedeckte das Gesicht mit den Händen und stöhnte: „Oh, immer dieselbe Frage, immer dieselbe Frage!“ „Freilich immer dieselbe Frage!“ erwiderte Sanders erregt. „Siehst du denn nicht ein, Erich, dass von der Beantwortung dieser Frage dein Leben abhängt?“ „Oh, ich weiß alles, was du auch fragen wirst. Sie fragen immer dasselbe, erst auf der Polizei, dann der Untersuchungsrichter und jetzt du!“ „Ja!“ entgegnete Sanders jetzt mit fester Stimme. „Auch ich frage dasselbe. Aber ich frage es nicht, um dich zu peinigen, das weißt du so gut wie ich. Ich frage dich, weil ich überzeugt bin, dass ich von dir eine Antwort erhalten werde!“ „Du hast kein Recht dazu!“ bäumte sich Soltau auf.
„Doch, ich habe es! Und wenn nicht ich, dein Freund, dann hat es nur noch ein einziger Mensch auf der Welt!“ „Wer?“ schrie Soltau. „Cecily!“ entgegnete Sanders ernst und bedeutsam. Da sah ihn Soltau starr an und schlug, wie vom Blitz getroffen, auf die Pritsche hin. Ein paar Minuten regte sich nichts in der Zelle. Dann kam von der Pritsche her ein leises Wimmern: „Frage mich, Sanders, ich will antworten!“ „Endlich!“ seufzte Sanders erleichtert auf.
Aber bevor er noch mit seiner Frage beginnen konnte, richtete sich Soltau auf und sagte mit einer plötzlich wunderbar festen Stimme: „Höre, Sanders, du kannst mich fragen, was du willst, nur eins nicht: „worum es sich im meinem Streit mit Brandorff gehandelt hat! Darüber kann ich dir keine Auskunft geben, dir und niemand. Ich darf es nicht. Ich würde vor mir selbst, meine Ehre verlieren. Es sei dir genug, wenn ich zugebe, ich habe mit Brandorff einen heftigen Streit gehabt. – Und nun frage nur immer – aber ich muss dir offen sagen, ich habe kaum die Hoffnung, durch dein Fragen etwas zu gewinnen. Denn auf alles andere kann ich dir keine Antwort geben, nicht weil ich nicht will, sondern weil ich nicht kann!“ „Warum nicht?“ fragte gespannt Sanders.
„Ich weiß es nicht!“ war die sofortige Antwort. „Sieh’ mal, Sanders,“ fuhr Soltau mit ruhiger Stimme fort, „alle diese Leute auf der Polizei und im Gefängnis wollen es nicht glauben, oder sie verstehen nicht, wenn ich sage: Ich weiß nicht! – Aber du bist mein Freund, ich kenne dich. Würdest du genug Verständnis aufbringen, wenn ich dir sagte: von allem, was nach dem Streit mit Brandorff mit mir geschehen ist, weiß ich nichts, habe ich nicht die geringste Ahnung!“
„Du weißt nicht, was mit dir geschehen ist?“ „Nein, Sanders, ich kann nichts anderes sagen als: auch die geringste Bewegung, der kleinste Schritt, den ich gemacht habe, ist total meinem Gedächtnis entschwunden!“ „Du hast es vergessen – ah, das ist unglaublich!“ rief wie vor den Kopf geschlagen Sanders. „Ja, unglaublich, das ist das richtige Wort!“ entgegnete Soltau. „Darum will es mir ja auch niemand glauben! Und doch ist es so!“ „Und du kannst dich an nichts mehr erinnern?“ „An nichts!“
„Armer Freund,“ sagte Sanders, „wie muss dir zumute sein! Wie einem Ertrinkenden, dem eben der letzte Balken von den Wellen fortgespült wird!“ „Sage lieber, wie einem Mann, der seinen eigenen Kopf noch vor dem Tode unterm Arm trägt!“ entgegnete Soltau mit einem schwachen Versuch zu scherzen. „Höre, Soltau, und siehst nirgends eine Möglichkeit, ein Alibi nachzuweisen, nirgends einen Ausweg, einen schwachen Lichtschimmer, der dich retten könnte?“ „Du vielleicht?“ fragte Soltau. „Offen gesagt, vorläufig nicht!“ sprach zaghaft und in sich gekehrt Sanders. „Na, ich auch nicht!“ höhnte Soltau. „Höre, Erich, es ist jetzt keine Zeit zu scherzen. Vielleicht finden wir gemeinsam einen Weg. Versuche doch dich zu besinnen! Wann hast du denn Brandorffs Haus verlassen?“
„Ich habe dir schon gesagt, ich weiß es nicht!“ antwortete Soltau diesmal mit schmerzhaft verzogenem Gesicht, denn diese hundertmal wiederholte Frage rührte zuviel Qual in ihm auf. „Und du weißt auch nicht, wohin du gegangen bist?“ „Mein Ehrenwort: nein!“ „Du hast niemand unterwegs getroffen?“ „Das kann ich dir beim besten Willen nicht sagen!“ „Besinne dich doch, Eich! Denke doch, wie leicht ist es möglich! – Es wohnen so viel Bekannte von uns im Tiergartenviertel!“ „Ich weiß es nicht! – Alles, alles ist total wie ausgelöscht!“ „Denke nach – bist du vielleicht durch den Tiergarten gegangen oder über die Charlottenburger Chaussee oder über die Linden?“ „Über die Linden?“ fragte wie in einem tiefen Traum Soltau. „Denke nach, könnte dich am Ende jemand gesehen haben? Denke doch, dann wärst du ja gerettet! – Herrgott im Himmel, wer könnte denn so spät in der Nacht noch auf der Straße sein? Vielleicht Kerzner – oder Leutnant von Massow?“ Soltau schüttelte den Kopf. „Oder Wilhelmi oder: - um Himmels willen – Maretzki vielleicht?“
„Nein, nein, Sanders, es ist vergeblich!“ wehrte sich Soltau. „Oder“ – fragte hatnäckig Sanders, „oder jemand vom Klub? – Vielleicht Mohl – aber nein, dernicht, der hat sich ja nach dir erkundigt; der hat dich ja schon lange nicht mehr gesehen!“ „Mohl?“ Soltau fuhr erschreckt auf. „Mohl – der Klub?“ Er starrte wie träumend über Sanders hinweg. Sanders sah es sofort, dass irgend etwas in Soltaus Erinnerung rege wurde. „Um Gottes willen, Erich, besinne dich! Was träumst du, was kommt dir ins Gedächtnis? Denke an den Klub oder an Mohl, vielleicht liegt hier die Rettung!“ „Warte, Sanders“, sprach Soltau langsam, wie jemand, der aus einem tiefen Schlaf erwacht. „Warte, mir ist, als dämmert irgendwo ein Licht. Mohl – der Klub – frage mich, bitte, frage mich, ich hoffe – ich glaube, ich komme auf irgend etwas!“ „Hast du am Ende irgendeinen von Mohls Freunden gesehen?“
„Einen Moment“ – sprach Soltau mit starren Augen. „Jetzt steigt es langsam vor mir auf. Laß sehen, ich besinne mich, ich ging aus dem Haus – weiter, auf meinem Wege war irgendwo ein Schutzmann, er sah mich an, ich beachte ihn nicht – aus!“ Er fuhr sich mit der Hand über die Augen, wie etwas Entschwundenes festzuhalten.“ „Und dann – und dann?“ fragte fieberhaft erregt Sanders. „Und dann - - - dann war ich im Tiergarten und ging die Allee herauf, die Siegesallee.“ Er sprach stammelnd wie ein Kind. „Ging bis zur Siegessäule, da setzte ich mich auf eine Bank.“ „Weiter, weiter!“ drängte Sanders. „Es geht nicht so schnell!“ wehrte Soltau. Er legte die Hand an den Kopf. „Ich sitze in einem Wagen, wir sind am Brandenburger Tor.“ „Was? In einem Wagen? Mit wem? – Mit wem saßest du im Wagen?“ Schweigen. „Mit wem? – Besinne dich doch! – Mit einem Mann oder einer Frau?“
„Mit – mit – mit einer Frau!“ rief plötzlich laut Soltau. Und sofort setzte er hinzu: „Mit Frau – mit - - - mit Frau von Zemlinska!“ Und er schlug sich dabei mit der Hand vor dem Kopf. „Mit der Freundin Mohls?“ fragte in tiefstem Erstaunen Sanders. „Ja!“ erwiderte er nachdenkend, grübelnd. „Ja, mit Frau von Zemlinska! - - - Wie war’s nur? – Ich saß auf der Bank, und der Morgen kam schon herauf. – Eine Equipage kommt vorbei, mit zwei Rappen bespannt. Im Fond eine Dame. Sie läßt den Kutscher halten und ruft: „Herr Soltau!“ Ganz weich und hell herüber: „Herr Soltau!“ Ich stehe auf und gehe zur Equipage. „Kommen Sie, steigen Sie ein!“ sagt sie und lacht und blitzt mich aus ihren schwarzen Augen an. Und dann wirft sie den Kopf zurück: „Kommen Sie, wir fahren hinunter zu „Riche“! Ich stieg ein und fuhr mit ihr die Linden hinunter zum Restaurant Riche.“ „Und du trafst da Bekannte?“ fragte Sanders gespannt. Soltau schwieg einen Moment. Plötzlich machte er eine lebhafte Bewegung. Nun erst schien die Erinnerung in ihm völlig erwacht zu sein. „Ja“, sagte er, „Kersow vom Klub und zwei Freunde von ihm und den langen Strehlen.“
Sanders machte hastig Aufzeichnungen in sein Notizbuch. „Wir tranken“, fuhr Soltau fort. „Frau von Zemlinska saß neben mir und plauderte unaufhörlich mit mir; sie fragte mich tausend Dinge. Ja - - und dann - ich glaube, ich war wie toll. Sie stand auf, schritt hinaus – ich ihr nach, in einer dunklen Nische des Korridors – packte ich sie beim Kopf und küßte sie auf den Mund. - - Und da - - kam mir der Gedanke an Cecily. - - Ich riß mich los und rannte wie toll auf die Straße. Es war mir, als wäre ich mit irgendeinem schrecklichen, narkotischen Mittel vergiftet worden. Ich war halb besinnungslos – rannte an den Leuten vorbei, die mich anstarrten und mir etwas nachschrieen. Und dann – ich weiß nichts mehr. – Wie eine Wolke ist alles vor meinen Augen. – Plötzlich fand ich mich in einer Zelle - - im Gefängnis! – Ich kann es mir und dir gar nicht erklären.“ „Vorläufig nicht nötig!“ bemerkte Sanders. Und trocken sagte er hinzu: „ Das genügt mir. Ich glaube, ich kann dir versprechen: Heute abend bist du frei!“
X. Geständnisse.
Soltau war frei. Sanders hatte es durchgesetzt, dass man sehr rasch und diskret bei einigen Teilnehmern jener lustigen Nachtgesellschaft im Restaurant Riche Erkundigungen einzog, so dass das Alibi für Soltau nachgewiesen werden konnte. Es ergab sich die vollkommene Unwahrscheinlichkeit einer Schuld Soltaus, und seine Entlassung aus der Haft wurde sofort verfügt. Sanders holte ihn aus dem Gefängnis ab. Sie fuhren mitten durch die belebten Straßen Berlins, durch das Grün des Tiergartens, und voll Seligkeit trank Soltau in durstigen Zügen die Luft, die um die saftig prangenden Bäume des Tiergartens einen blauen Schleier mit den weißen Tupfen der Nachmittaswölkchen schlang. Noch war Soltau in sehr geschwächter Verfassung. Mit abgehärmtem Gesicht saß er schlaff in den Fond des Wagens zurückgelehnt da und starrte in den Nachmittagshimmel. „Wie wird Cecily sich freuen, wenn sie dich wiedersieht!“ unterbrach Sanders seine Träumereien.
Soltau fuhr aus seiner Versunkenheit auf: „Cecily“- Weißt du, Sanders,“ sagte er langsam, „mir ist so, als hätte ich ein Unrecht begangen. Vielleicht waren diese Tage im Gefängnis nur eine Prüfung für mich – vielleicht eine Strafe dafür, dass ich in jener Nacht in der Weinlaune mich so weit vergessen konnte, ein fremdes Weib zu küssen!“ Und er versank in ein selbstanklägerisches Grübeln. Aber Sanders riß ihn heraus. „ Nein, nein, mein Lieber, das ist es nicht. Du schwärmst, aber die Wirklichkeit kümmert sich nicht um Träume und Phantasiebilder. Deine Selbstvorwürfe machen dir alle Ehre, aber ich glaube nun und nimmer, dass man lediglich durch einen kleinen Rausch in deinen damaligen Zustand versetzt werden kann. Dieser Zustand ist mir höchst rätselhaft. Diese Lethargie, diese Schwächung des Willens, diese vollkommene Lähmung der Gedächtniskraft ist mir unerklärlich. Das ist doch eine direkte pathologische Veränderung aller Körperfunktionen, und ein solch pathologischer Zustand entsteht nie und nimmer durch einen Kuß und eine Erinnerung an die Geliebte.“
Soltau wippte nachdenklich mit der Fußspitze hin und her. „Ich muss sagen, daran habe ich noch nicht gedacht. Ich glaube, dass mein Zustand sich schon vorbereitete, als ich oben im Restaurant saß und trank .... Ich fühlte wirklich meine Willenskraft schwächer und schwächer werden, und ich erinnere mich ganz dunkel, als ich mit der Zemlinska sprach, dass meine Zunge mit mir durchging.... Berauscht, vom Sekt berauscht war ich nicht, das weiß ich sicher. Ich kann sonst eine gehörige Dosis vertragen. Aber außerdem war das Gefühl, das ich empfand, so ganz anders als ein Sektrausch.“
„Nein,“ erwiderte Sanders, „es war auch kein Sektrausch. Ich habe dich während dieser Tage genau beobachtet. Eher möchte ich behaupten, dass du unter den Nachwirkungen irgendeines narkotischen, höchst merkwürdigen Giftes zu leiden hattest. Wenigstens gewann ich diesen Eindruck von dir. Die überaus seltsame Art, wie du nur ganz langsam und mit Hilfe von gewaltsamen Personenvergegenwärtigungen dich auf deine Erlebnisse zu besinnen vermochtest, hatte etwas durchaus Ungewöhnliches, ja Unheimliches an sich, etwas, das ich wenigstens hier in unserm zurückhaltenden Norden noch nicht erlebt habe.“ Soltau sah Sanders ins Gesicht: „Hast du etwas im Hinterhalt?“ fragte er mißtrauisch. „Nein.“ Sanders schüttelte ruhig den Kopf. „Ich habe bei dem, was ich sage, durchaus keine besonderen Gedanken oder etwa gar heimliche Ziele. Mir kommt die ganze Sache nur höchst unnatürlich vor. Der Zustand, in dem du dich befandest, entsteht sicher nicht allein durch seelische Erlebnisse, wie du es gern glauben möchtest – eher in einer Art Opiumrausch.“
Der Wagen war in der Königgrätzer Straße vor Soltaus Wohnung angekommen. Sie stiegen aus und gingen ins Haus. Als Soltau die Wohnung öffnete, war das erste, das Sanders in die Augen fiel, ein großer, reisefertig gepackter Rohrplattenkoffer. Er schlug Soltau auf die Schulter: „Du, was war das mit dem gepackten Koffer? Ich will dir offen sagen, diese Reisevorbereitungen haben nicht wenig Verdacht erregt!“ Aber wenn er gedacht hatte, dass Soltau ihm im gleichen scherzhaften Ton antworten würde, so hatte er sich geirrt. Mit sehr ernstem Gesicht erwiderte Soltau: „Ja, es war ein tolles Zusammentreffen von unglücklichen Umständen. Ich kann dir mitteilen, dass ich alles abhängig für mich machte von Brandorffs Worten in der Auseinandersetzung, die ich, wie ich wußte, mit ihm haben würde. Und wenn jener seltsame Rauschzustand oder, wie du glaubst, jene Vergiftung nicht dazwischen gekommen, so wäre ich wirklich noch, glaube mir, in jener Nacht gefahren.“
„Nun, dem Himmel sei Dank, dass du es nicht tatest“, erwiderte Sanders. „Ich bin überzeugt, der Verdacht wäre so stark gegen dich gewesen, dass ich dich heute noch nicht freibekommen hätte. Sicherlich nicht; und ich könnte mich jetzt hier nicht so behaglich in deinem bequemen Sessel strecken und in aller Ruhe die Abendzeitung lesen, wie ich es jetzt tue, während ich erwarte, dass du, lieber Junge, dich in dieser Zeit wäschst, rasierst und umziehst! Es tut dir wirklich not. Adieu, mein Sohn, auf Wiedersehen bis nachher! Ich lese!“ ... Und behaglich lachend, lehnte er sich mit der Zeitung in der Hand zurück, während Soltau in das Toilettenzimmer seiner eleganten Junggesellenwohnung verschwand. Aber wer Sanders genau kannte, der wußte, dass das Lachen bei ihm diesmal nur gemacht war. Als die Tür sich hinter Soltau geschlossen hatte, versank er in tiefes Grübeln. Die Tatsache ließ nicht ab, seinen Geist zu beschäftigen, die Tatsache, die ihm immer klarer wurde: dass Soltau sich in einem narkotischen Zustande befunden hatte, nachdem er mit seinen Bekannten und der Frau v. Zemlinska, der Freundin Mohls, bei „Riche“, zusammen gewesen war.
Als Soltau sich mit Sanders auf den Weg zu Cecily machte, war er kaum wiederzuerkennen. Frisch und sorgfältig gekleidet, wie in früherer Zeit, stand er da, heiter, fast strahlend vor Freude über seinen eigenen neuen Menschen. Nur die ausgestandenen Qualen der letzten Tage hatten eine bleiche Farbe auf seinem Gesicht zurückgelassen, die sich nicht so leicht überwinden ließ. Als sie ins Haus Brandorff traten, kam ihnen Cecily völlig unvorbereitet entgegen. „Erich!“ rief sie in höchster freudiger Überraschung. Und er konnte nur das eine Wort hervorbringen: „Cecily!“ Beider Gesichter färbte ein glühendes Rot. Sanders hielt es für geraten, sich zu verabschieden, unter dem Vorwande, er wolle im Bibliothekzimmer ein Buch einsehen. Und er verschwand auf der Treppe. Die beiden gingen, fast als ob dies so sein müsse, Hand in Hand in den Garten hinaus. Als sie den Vorhof überschritten hatten, klappte hinter ihnen das rostige, alte Eisentor des Gartens zu, als wenn es wüßte, dass die beiden allein sein wollten. Schweigend schritten sie auf den schattigen Wegen dahin. „Was hast du ausstehen müssen, Erich!“ brach Cecily zuerst das Schweigen.
„Und du erst, Cecily!“ erwiderte herzlich Soltau. „Oh, erinnere mich nicht daran,“ erwiderte sie, „es war entsetzlich. Und wenn ich daran denke, dass nicht das geringste Zeichen von meinem Vater da ist!“ „Cecily, es wird kommen! Wir werden alles wissen! Ich verspreche es dir, so wahr ich hier stehe. Mit aller meiner Kraft werde ich mich jetzt für die Auffindung deines Vaters einsetzen. Ich fühle es, jetzt bin ich wieder ich selbst, der dumpfe Druck ist von meiner Seele geschwunden. Nun soll alles klar, nun muss alles gut werden!“ Mit leuchtendem Blick sah Cecily zu ihm auf. „Oh, Erich, ich hoffe so auf deine Hilfe, du kannst dir gar nicht denken, wie ich darauf vertraue!“
„Cecily!“ rief Soltau, und er fühlte, wie sein Blut stürmisch wallte. Sie waren jetzt am Ende des Gartens angelangt. Mit weich berauschendem Duft breiteten die alten Linden ihre Zweige über die beiden aus. Soltau fühlte, wie der süße, schmeichelnde Geruch ihm immer mehr von seiner Selbstbeherrschung raubte. Oh, er wollte vor sie hinstürzen, er wollte ihr gestehen, dass er sie liebte, wollte sie umfangen und sie heiß küssen! Denn er liebte sie. Im Gefängnis war es ihm plötzlich klar geworden. Das Bild seiner Cousine folgte ihm überall nach, wo er ging und stand.
Und hier nun, wo sie so dicht neben ihm war, wo sie ihm so warme Worte der Herzlichkeit sagte, warum stürzte er da nicht vor ihr nieder, warum sagte er nicht, was er fühlte? Woher kam diese unbegreifliche Scheu, die ihn abhielt, sich ganz auszusprechen? Oh, er wußte, warum er zauderte, warum im letzten Augenblick ihn alle Männlichkeit verließ. Denn immer, wenn er im Begriff stand, zu Cecily von seiner Liebe zu reden, tauchte wie ein wüster, schwerer Traum vor seinem Auge die Szene auf, wie er Frau von Zemlinska geküßt hatte. Er sagte sich zuerst tausend Entschuldigungen, aber auch diese konnten ihm nicht über die Tatsache forthelfen, dass er an der süßen, unschuldigen Cecily einen Treubruch begangen hätte. Von zwiespältigen Empfindungen gequält, ging er herum. Er begehrte Cecily heftig zum Weibe, er wollte ihr seine Liebe gestehen, und er liebte sie andererseits viel zu sehr, um es nicht als einen Betrug zu empfinden, wenn er über das Abenteuer mit Frau Zemlinska so leichtfertig hinwegglitt. Cecily fiel das lange Schweigen Soltaus auf. Sie sah ihn an und war aufs höchste betroffen von seinem fast schmerzverzerrten Gesicht.
„Was hast du, Erich?“ fragte sie mild. „Oh, nichts, laß nur!“ versuchte er sie zu beschwichtigen. Doch sie ließ sich nicht abweisen: „Nein, dich quält etwas, Erich, ich sehe es genau!“ „Oh,“ sagte er mit heiserer Stimme, „nichts, es ist wirklich nichts!“ „Du bist verstockt, Erich. Geh’, sprich doch zu mir! Du weißt doch, dass du mir alles sagen kannst.“ Und sie legte ihm sanft die Hand auf die Schulter. „Sprich ruhig zu mir, vertraue dich mir an. Was ist es denn, das dich quält?“ Soltau stieß nur das eine Wort hervor: „Du!“
„Ich?“ „Ja, du!“ Und es war um seine Selbstbeherrschung geschehen. Mit einer Heftigkeit, die ihn selbst erschreckte, packte er ihre beiden Hände und rief: „Cecily, Cecily, weißt du es denn noch immer nicht? Du bist es, die ich meine, du bist es, die mich quält! Denn ich liebe dich maßlos, ohne Ende. Erst in den letzten Tagen ist es mir klar geworden, wie sehr! Mein Selbst, mein alles, die ganze Welt möchte ich darum geben, um dich zu gewinnen. Nichts wäre mir zu schwer, nichts zu gewaltig, das ich nicht für dich erreichen konnte! Alles gäbe ich um deine Liebe, selbst mein Leben!“ Mit rasender Wucht stieß er seine Worte hervor, zitternd vor Erwartung, wie im Fieber. Kaum wagte er den Blick auf ihr Gesicht zu richten, in ungeheuerster Angst vor ihrer Antwort. Doch als er sie jetzt ansah, da gewahrte er, wie ein liebliches Rot auf ihren Wangen lag. Sie blickte ihm voll ins Gesicht, mit einem unnennbar glücklichen Ausdruck, und sagte nur: „Erich, ich hab dich lieb!“
Ihre Hände fanden sich. Selig sahen sie sich in die Augen. Da beugte er sich über sie und küßte sie innig und lange. Doch kaum hatten sie einige Worte über ihr junges Glück gewechselt, als Soltau plötzlich verstummte. Ein schwarzer Schatten huschte über sein Gesicht. „Was hast du, Liebster?“ fragte Cecily. „Ach, nichts, nichts“, sagte er ausweichend. „Willst du es mir nicht vertrauen?“ bat sie. „Ich kann es dir nicht sagen. Es war ein Rausch, ein Wahnsinn ... die Überrumpelung eines unbegreiflichen Augenblicks!“ „Du machst mir Angst, Erich!“
Soltau schwieg. Düster vor sich hinblickend, griff er an seine Stirne, als wollte er böse Gedanken wegwischen. „Was war es denn, Erich?“ fragte Cecily dringend, zärtlich. „Ein Unrecht gegen dich – in einem unseligen Augenblick.“ „Gegen mich?“ meinte sie erstaunt. „Ja,“ sagte er entschlossen, „ich will es dir nicht verbergen. Ich weiß noch immer nicht, wie es geschehen konnte. Ich war da – ganz gegen meinen Willen in eine Gesellschaft hineingeraten. Herr von Mohl“ --- „Herr von Mohl?“ wiederholte sie mit erschrecktem Blick.
„Ja ... und auch andere ... und auch eine Frau von Zemlinska. Wir tranken, und plötzlich fühlte ich mich wie betäubt – wie ausgetauscht – als wäre ich gar nicht ich! Alles brannte in mir, mein Blut kochte und hämmerte in den Schläfen, und neben mir saß Frau von Zemlinska und plauderte und lachte mich an. Dann stand sie auf – ich glaubte, sie zog mich mit den Blicken mit sich, und ich ging ihr nach ... In einer Nische, es war da dunkler – blieb sie stehen und blickte mich mit ihren Augen an ... Und ich weiß nicht, wie es über mich kam .. ich .. küßte sie!“ „Du .. du .. küßtest sie? – Diese Frau!“ rief Cecily fassungslos. „Cecily, liebe Cecily – Verzeihung!“ flehte er beschämt.
„Nein,“ rief sie empört, „wie konntest du! ... O pfui! Geh’ jetzt, geh’ nur! Geh’ zu diesem Weibe!“ ... Und ohne auf seine Rufe zu hören, eilte sie davon und ließ ihn in Bestürzung und Trauer zurück. Sie fühlte sich in ihren Gefühlen schwer verletzt. Während sie sein Bild in der Seele trug, während sie nur darauf wartete, von ihm ein Wort der Liebe zu hören, hatte er eine andere geküßt! – Und danach hatte er ihr von seiner Liebe gesprochen! Und wer war die andere? Die Freundin jenes Menschen, der ihr, kaum, dass sie ihn gesehen hatte, in tiefster Seele verhaßt war, jene Frau von Zemlinska, die sie an jenem Abend vor dem Westen-Klub im Wagen gesehen hatte.
Cecily weinte fast vor innerer Wut. Doch nicht lange hatte sie Zeit, ihrem Schmerz freien Lauf zu lassen. Lautes Geräusch drang aus dem Hause an ihr Ohr. Sie hörte aufgeregtes Gehen und Kommen, Leute liefen hin und her, die hastig durcheinandersprachen. Sie unterschied eine Stimme: „Leiser doch zum Teufel, nehmt doch Rücksicht!“ Eine andere Stimme – sie erkannte die des alten Portiers – fragte aufgeregt: „Wo ist denn um Gottes willen nur das gnädige Fräulein?“ Cecily runzelte die Stirn. Was war das? Was ging da vor? Doch als sie in den Hausflur kam, war keine Menschenseele zu sehen. Aber oben im ersten Stockwerk hörte sie unruhig hin und her gehen. Was war denn nur geschehen? Als sie die Treppe emporstieg, sagte gerade Sanders’ helles, scharfes Organ: „Aber man muss zuerst Fräulein Cecily holen!“
In erregter Hast sprang sie die Stufen empor. Mit klopfendem Herzen riß sie die Tür zum Vorsaal auf. Niemand war zu sehen. Die beiden Türen der Galerie waren geöffnet. Sie lief hindurch und in der Bibliothek. Die Tür zum Fremdenzimmer stand weit offen. Drinnen waren viele Leute, unbekannte Gesichter, darunter ein Droschkenkutscher. Fragend sah sie sich um: „Ich hörte meinen Namen rufen – was soll ich? – Was wollen diese fremden Leute hier?“ sagte sie befremdet, in höchster Unruhe. Doch niemand antwortete ihr. Ein unheimliches Schweigen herrschte im Zimmer.
Alle wichen respektvoll zurück und ließen einen Gang von der Tür zum Himmelbett frei. Cecilys Blick fiel aufs Bett: Herrgott – was war da? Aber nein, es war ja nicht möglich! Das Gesicht eines Greises lag auf den Kissen, und auf der Decke suchte eine zitternde Hand herum. Cecily stürzte zum Bett, und in Jubeln und Weinen schluchzte sie völlig fassungslos: „Mein Vater – mein Vater!“ Im Bett lag der alte Brandorff!
XI. Unerwartete Ereignisse.
Das Unerwartete von der Welt war geschehen: Brandorff war da. Es war etwas so Ungeheuerliches, dass weder Sanders noch Cecily irgendeinen Gedanken fassen konnten, ein starres Staunen lag an den Gesichtern all der Menschen im Zimmer. Selig in Schmerz und Glück lag Cecily vor dem Bett und bedeckte die Hand des Greises mit Küssen. Sie konnte nichts anderes hervorbringen als die unter Tränen gestammelten Worte. „Mein Vater, mein Vater!“ Sanders faßte sich zuerst. Leise, aber bestimmt gab er der alten Haushälterin den Auftrag: „Einen Arzt – so schnell wie möglich!“ Dann wandte er sich an den Kutscher und an die Männer, die beim Transport Brandorffs behilflich gewesen waren, und winkte ihnen, ihm ins Bibliothekzimmer zu folgen. Nichts hatte er weniger erwartet, als den alten Brandorff überhaupt je wiederzusehen, und das unglaublichste war, noch dazu in seinem eigenen Hause. Er war gerade im Begriff gewesen, das Bibliothekzimmer zu verlassen, in das er sich während Cecilys und Soltaus Gang in den Garten zurückgezogen hatte, als er schwere Tritte die Treppe heraufkommen hörte. Dazwischen vernahm er die jammernde Stimme des alten Lehnert, die ihm wegen eines ganz ungewohnten Klanges auffiel.
Er hörte die stampfenden Schritte mehrerer Menschen durch die Galerie kommen, die Tür zum Bibliothekzimmer wurde aufgerissen, und seine Augen sahen drei Männer mit dem Körper des leise ächzenden Brandorff hereinkommen. Schnell hatte er die alte Martha rufen lassen, schnell hatte er mit ihrer Hilfe Brandorff ins Bett bringen können, und nun war er es, der wiederum alle nötigen Anordnungen im Hause traf. Die Männer hatten sich gleich wieder entfernen wollen, aber mit rascher Geistesgegenwart hielt Sanders sie zurück. Wo kamen sie her? Denn auch das durfte man nicht vergessen, wenn auch das Unerhörte geschehen und Brandorff wieder im Hause war. Die drei Leute, welche den Transport Brandorffs geleitet hatten, boten das typische Bild der gänzlich heruntergekommenen, verhungerten Arbeitslosen, die jede Tätigkeit, die man ihnen anbietet, übernehmen.
„Wo sind Sie gemietet worden?! Fragte Sanders den Droschkenkutscher. „In der Müllerstraße!“ erwiderte dieser. „Von wem?“ „Die Herren hier haben mich gemietet“, antwortete er mit einer Handbewegung auf die drei Männer. Sanders musterte die Männer. Sie sahen absolut nicht so aus, als seien sie bei einem so raffinierten und komplizierten Verbrechen beteiligt. Im Gegenteil, es machte den Eindruck, als erwarteten sie ein besonders fettes Trinkgeld. „Wie kamen Sie zu dem Herrn?“ fragte Sanders einen der drei, der ihm durch eine größere Intelligenz in dem abgehärmten Gesicht auffiel.
Der Angeredete war offenbar unangenehm überrascht, dass er das Trinkgeld nicht sofort bekam, und schien jetzt erst zu merken, dass seine Tätigkeit vielleicht ihm unerwünschte Verwicklungen zur Folge haben könne. Er rückte sich ein wenig unruhig das rote Halstuch zurecht: „Ja, das ist nicht so einfach zu erklären, Herr!“ sagte er. „Aber ich dachte natürlich nicht, dass die Sache nicht ganz sicher ist. Ich übernehme sonst nämlich nur ganz reelle Sachen!“ fügte er erklärend hinzu. „Sie brauchen auch gar keine Bedenken zu haben!“ sagte Sanders und gab den Leuten ein schönes Trinkgeld, das sie auch mit befriedigtem Schmunzeln entgegennahmen. „Ich möchte nur einige Fragen beantwortet haben.“ „Können Sie kriegen, Herr!“ erwiderte bereitwillig der Sprecher der drei. „Also dann sagen Sie mir, wer Sie gemietet hat und wo das geschehen ist!“
„Na also, Herr, das ist nicht so ganz leicht zu erzählen. Wie ich mich gestern nacht um den Schlesischen Bahnhof, da draußen an der Koppenstraße, herumdrückte, vielleicht um was aufzuschnappen, wo man ‚ne Kleinigkeit verdienen kann, da kam auf mich so ein Mann zu, mit ‚ner Mütze auf dem Kopf und ‚ner Pfeife im Mund. Sah nicht gerade aus, als ob er’s sehr dick im Portemonnaie hätte, aber das tat ja nichts zur Sache. Ich hatte gemerkt, wie er mir schon ‚ne ganze Weile zugesehen hatte. Und nun fragte er mich, ob ich helfen wollte, ‚nen Kranken zu transportieren.
„Gewiß,“ sagte ich, „wenn’s was einbringt!“ Darauf gab er mir eine Mark und sagte mir, ich sollte am Tage darauf in der Müllerstraße mich einfinden, er gab genau die Stelle an, da, wo sie abzweigt nach Tegel, und dann gäbe es die anderen vier Mark. Wie ich nun heut nachmittag hinkomme, da stehen schon diese beiden da und warten auch, und nach kurzer Zeit kommt eine Droschke an und hält, mit dem Droschkenkutscher hier! Also wir kannten keiner den andern, aber wie wir so warten, kommen wir ins Gespräch und es stellt sich heraus, dass jeder von uns herbestellt war und Vorausbezahlung bekommen hatte. Wie wir so etwa eine Viertelstunde warten, kommt von Tegel her ein kleiner Leiterwagen. Auf dem Bock saß ein alter, weißbärtiger, verrunzelter Bauer. Wie er uns warten sah, hielt er und fragte: „Warten Sie hier auf’n Kranken?“ „Jawohl!“ sage ich. „Sind Sie’s etwa selbst?“ „Nein,“ sagt er in seiner komischen Sprechweise, die man nicht leicht verstehen konnte, „der Kranke ist hier!“ Und nun sahen wir erst, dass im Wagen, ganz in Decken eingewickelt ein Mann lag. „Den sollen Sie in die Stadt bringen!“ sagte er zu uns und gab uns die Adresse von dem Haus hier an. Und dann holte er Geld vor und gab jedem, was er zu kriegen hatte. Dann holten wir den Kranken heraus und packten ihn in die Droschke. Der Bauer drehte den Wagen um und fuhr nach Tegel zurück, und wir machten, dass wir hierher kamen. Mehr kann ich Ihnen auch nicht sagen, Herr!“ Das war nun allerdings wenig. Aber Sanders ließ den Mut nicht sinken. Er fragte einen nach dem andern aus, aber sie konnten alle nur dieselbe Antwort geben; In verschiedenen Gegenden Berlins war nachts ein nicht sehr gut gekleideter Mann an sie herangetreten und hatte sie für den folgenden Tag gemietet. Sanders schrieb sich ihre Namen und Adressen auf und ließ sie gehen.
So war nun also Brandorff da. Aber woher war er gekommen? Und wie war er gekommen? Als Kranker. Er, der früher ein alter Mann zwar, aber doch durchaus rüstig gewesen war. Und nun? Ein Blick hatte Sanders von der Hinfälligkeit Brandorffs übezeugt. Und was war das für eine Geschichte mit dem Bauernwagen? Offenbar ein höchst sorgfältig in Szene gesetzter Plan. Die Verbrecher hatten es fürs erste aufs beste verstanden, ihre eigene Person in Dunkel zu hüllen. Diese nächtlichen Aufforderungen Geldbedürftiger, dieses ganze sorgsam überlegte Ineinandergreifen von Tatsachen deutete auf eine durchaus überlegene Intelligenz, der man die Schuld an dem Attentat gegen Brandorff zuschreiben mußte. Doch warum war Brandorff wieder hier? Warum war dieses doch für den Täter gefährliche Unternehmen ins Werk gesetzt, den Greis wieder zurückzuschicken?
Und Brandorff lebte doch! Es war unerklärlich. So sehr Sanders zuerst von der Ankunft Brandorffs fast entsetzt war, so sehr staunte er, als er diese Tatsachen durchdachte. Denn es war klar, der Täter setzte sich der allergrößten Gefahr aus, wenn nicht durch seine unwissenden, gemieteten Werkzeuge, so doch durch alle Erklärungen aus Brandorffs Mund. Und nun erst kam ihm überraschenderweise der Gedanke: Was sagt Brandorff? Ein Gedanke, der bis jetzt durch das Mitleid mit dem hinfälligen, alten Mann hintangesetzt worden war. Doch sofort kreuzte die Idee seinen Kopf: Wie, wenn Brandorff nicht vernehmungsfähig war? Wenn er es überhaupt nicht mehr wurde? Und hatte dies der Täter am Ende gewußt? Hatte er sich nur eines unerwünscht Sterbenden entledigen wollen? Das ganze Mitleid des Freundes der Familie kam in Sanders jetzt zum Durchbruch. Im Moment hatte er vergessen, welche Rätsel er eigentlich lösen wollte. Alles, was bei Sanders das nur Verständige bedeutete, verschwand plötzlich, und das rein Menschliche trat hervor. Brandorff – wie ging es ihm? War er denn nicht die Hauptsache? Waren nicht alle Kombinationen nebensächlich von der Erwägung: Hier nebenan liegt der alte Mann, der alte Freund krank, vielleicht – im Sterben! Sanders trat leise in das Krankenzimmer.
Ein junger Mann stand mit ernstem Gesicht am Bett, der sich als Doktor Heinrich vorstellte. Es war der Arzt, der geholt worden war. Cecily saß zu ihres Vaters Füßen, sie machte einen gefaßten Eindruck, trotzdem ihre Augen von einem mühsam zurückgehaltenen Weinen gerötet waren. Der Arzt trat auf Sanders zu und sagte mit leiser Stimme: „Der Zustand ist mehr als bedenklich. Der Patient scheint irgendwelchen heftigen äußeren Eingriffen ausgestzt gewesen zu sein. Es ist ein außerordentlicher Kräfteverfall zu konstatieren. Ich verstehe eigentlich gar nicht, was vorgegangen ist. Sehen Sie hier an den Handgelenken diese wunden, eiternden Stellen – es sieht so aus, als wenn eine unmenschlich grausame Fesselung bei dem alten Mann vorgelegen hätte. Und dann scheint mir auch, als hätte der Patient längere Zeit mit einem Knebel im Mund leben müssen.“ Sanders versuchte kurz, mit wenigen Worten das Vorgefallene zu berichten.
Doktor Heinrich zuckte unmerklich mit den Achseln und sagte: „Ich weiß nicht, was geschehen ist, aber im Vertrauen: es scheint mir wenig Hoffnung zu sein. Ich fürchte eine Herzlähmung. Ich hielt es für angebracht, einen Kollegen zu Rate zu ziehen.“ Und so saßen denn zwei Ärzte am Bett des Kranken. Sanitätsrat Spemann hatte sofort bei dem Bericht des jüngeren Kollegen ein sehr bedenkliches Gesicht gemacht. Und als er den Patienten selbst untersuchte, überfiel ein ungeheurer Ernst seine sonst so freundlichen Züge. „Wird er noch sprechen können?“ fragte Sanders. Im selben Moment bewegte der Kranke die Lippen und verlangte fast unhörbar Wasser. Cecily reichte es ihm mit zitternder Hand. Es war das erste Wort aus dem Munde Brandorffs. „Er spricht!“ flüsterte Cecily voll Glück. Und „Er spricht“ dachte Sanders voller Freude. Plötzlich verdüsterte sich Cecilys Gesicht. Sie stand leise und schnell auf, kam zu Sanders und flüsterte durch die Stille des Krankenzimmers: „Soltau ist noch im Garten. Holen Sie ihn!“
Sanders eilte hinunter und fand Soltau nach langem Suchen stumpf brütend in der Laube sitzen. „Komm’ schnell hinauf!“ rief er ihm schon von weitem zu. „Was soll ich da?“ erwiderte trübe Soltau. „Komm’, komm’“, drängte Sanders. Und dicht vor ihm rief er ihm außer Atem zu: „Brandorff liegt oben!“ „Was?“ schrie Soltau auf und starrte dem Freude ins Gesicht, als zweifelte er an seinem Verstande. „Ja, ja!“ rief Sanders, „Brandorff ist da – schwerkrank. Komm’ schnell!“ Soltau war aufgesprungen. Er war eben im Begriff, mit Sanders durch den Garten zu eilen, da stand er plötzlich still. Sein Gesicht verzerrte sich. „Was hast du?“ fragte Sanders heftig, beinahe rasch.
„Ich kann nicht!“ erwiderte gepreßt Soltau. „Warum nicht?“ „Nach dem, was damals vorgefallen ist?“ Er stand da, man sah einen harten Kampf auf seinem Gesicht spielen. „Darum handelt es sich jetzt nicht!“ rief Sanders hastig. „Solche kleinlichen Erwägungen müssen jetzt fortfallen!“ Und als Soltau immer noch zu zögern schien, packte er ihn hart beim Handgelenk und sagte: „Vorwärts! Brandorff ist schwerkrank – vielleicht stirbt er!“ Als Soltau ins Haus trat, hatte er ein Gefühl, als ob sich die Atmosphäre des Krankenzimmers bis hier heruntergeschlichen hätte und jedem lauten Ton eindringlich Ruhe gebot.
Zagend und leise stiegen beide die Treppe empor und traten in die Galerie. Cecily kam ihnen entgegen. Soltau und Cecily machten jeder unwillkürlich eine Bewegung und sahen sich aus bleichen Gesichtern in die Augen. Aber keiner schlug die Augen nieder. Man sah es, in Cecily arbeitete ein innerer Zwist, dann ließ sie den Kopf sinken und gab mit einer Handbewegung den Weg für Soltau frei. Sie traten ins Krankenzimmer. Soltau blieb auf der Schwelle stehen und sah zu dem Kranken hin. Brandorff hatte das Gesicht mit weit offenen Augen gerade auf die Tür hingerichtet, aber er machte keine Bewegung. Man merkte, er erkannte den Eintretenden nicht. Die Ärzte standen mit der Uhr in der Hand bei dem Kranken und maßen die Pulsschläge.
„Ich glaube,“ sagte der Sanitätsrat mit leiser, ernster Stimme zu Cecily, „mein gnädiges Fräulein, ich muss Sie auf das Schlimmste vorbereiten. Ich gebe Ihrem Vater noch etwa zwei Stunden zu leben!“ Cecily faßte sich an den Kopf, verzweifelt, stumm. Plötzlich machte Brandorff eine Bewegung im Bett, gleich als habe er die letzten Worte des Arztes verstanden. Seine Lippen bewegten sich, und er murmelte Worte. Cecily beugte sich in unnennbaren Qualen zu seinem Munde, und man konnte endlich das eine Wort unterscheiden: „Cecily!“ Langsam, Silbe für Silbe ward es fast unhörbar gesprochen. Mit wildem, angstvollem Schluchzen warf sich Cecily über ihn und rief: „Hier bin ich, Vater – hier bin ich! Erkennst du mich?“
Ein schwaches Aufleuchten in Brandorffs Augen zeigte an, dass er sie verstanden und erkannt hatte. „Du darfst nicht sterben, Vater!“ rief sie verzweifelt, „Du darfst es nicht!“ Und Soltau, der immer noch an der Schwelle stand, stöhnte mit den Händen vor dem Gesicht: „Oh spräche er doch!“ „Du darfst nicht sterben, Vater!“ rief Cecily von neuem. „Sprich zu mir, Vater!“ Aber nur leise Mundbewegungen des Greises gaben die Antwort. „Was ist?“ fragte, aufmerksam gemacht, der alte Sanitätsrat. „Es handelt sich um ein schreckliches Geheimnis“, antwortete leise Sanders. „Alles kommt darauf an, dass der Sterbende spricht. Stirbt er, ohne gesprochen zu haben, so bleibt der schwerste Verdacht vielleicht auf Schuldlosen haften!“
Der Sanitätsrat zuckte die Achseln: „Ich weiß nicht, ob er überhaupt noch sprechen wird!“ „Er muss es!“ drang Sanders leise in ihn. Eine neue Beratung zwischen den Ärzten fand statt, und dem Kranken wurden einige Tropfen eingeflößt, die ihn sichtlich ein wenig belebte. „Sie müssen das ganze Vorgehen in dieser Angelegenheit mir überlassen!“ wandte sich der Sanitätsrat an Sanders. „Und nun bitte ich um die Mitteilung des Namens; um wen handelt es ich?“ „Um Herrn Soltau hier!“ deutete Sanders hin. „Gut ich werde es versuchen!“ sagte der Sanitätsrat.
Er beugte sich über Brandorff und strich ihm leise und beruhigend mit der Hand über die Stirne. Dann fragte er sanft, aber sehr deutlich: „Herr Brandorff, hören Sie mich?“ Der Kranke riß die Augen auf, er sah starr auf den Arzt; seine Lippen bewegten sich, und hörbar murmelten sie ein „Ja“. Eine freudige Bewegung ging durch die Anwesenden, aber der ernste Blick des Arztes gebot ihnen sofort Zurückhaltung. Er beugte sich von neuem über das Bett und sagte: „Herr Brandorff – es geht Ihnen jetzt besser. Möchten Sie sprechen?“ Wieder ein leises „Ja“. „Möchten Sie Herrn Soltau sprechen?“ fuhr der Arzt fort.
Die Züge des Kranken umdüsterten sich auf einmal. Weit und erschreckt strarrten seine Augen den Fragenden an. Der Arzt winkte Soltau herbei und führte ihn neben sich ans Bett: „Hier ist Herr Soltau!“ Der Sterbende bewegte die Lippen, und plötzlich hörte jeder ein deutliches: „Nein!“ Ein starrer Schreck befiel alle. – Er wollte Soltau nicht in seiner Nähe haben? War am Ende Soltau doch schuldig – war er der Täter, der jetzt den Tod Brandorffs auf dem Gewissen hatte, der Mörder? Da stürzte Soltau fassungslos vor dem Bett auf die Knie und rief in höchster, gequälter Angst: „Onkel, sprich mit mir! Um Gottes willen sprich! – Vergib mir alles, was früher war, nur sprich! Stürze mich nicht ins Unglück; sag’ doch: bin ich schuld an deinem Tode? Bin ich der Verbrecher? Sprich doch, wir alle bitten dich – sprich: Bin ich es?“ Eine atemlose Spannung lag auf allen. Jetzt sollte sich das Geschick Soltaus entscheiden. Da hörte man deutlich, wie der Sterbende sagte: „Nein!“
Es war, wie wenn allen eine ungeheure Last vom Herzen gefallen wäre. Cecily, von der Nervenerschütterung überwältigt, schluchzte fassungslos. Doch Soltau ergriff ihre Hand und trat mit ihr zum Bett. „Vergib mir, Onkel“, sagte er. „Vergibst du mir?“ „Ja!“ hauchte Brandorff. Ein freudiges Zucken überflog Soltaus Gesicht. „Sieh,“ fuhr Soltau fort, „gib mir Cecily. Du weißt, ich begehre sie zum Weibe, und ich werde sie glücklich machen. Ich lege deine Hand in unsere beiden, ziehe sie nicht zurück. Ich bitte dich, Onkel, gib uns deinen Segen!“ Die Stille im Zimmer wurde nur durch das leise Schluchzen Cecilys unterbrochen. Alle lauschten atemlos.
„Ja!“ sagte Brandorff. Seine Augen wurden schon wieder matt. Die Ärzte berieten wieder leise. Der Sanitätsrat sagte: „Er wird wohl nicht mehr sprechen!“ Da schien es, als sehe Cecily plötzlich jetzt zum ersten Male, was hier eigentlich geschehe, als wache sie aus einem tiefen Traum auf; als besänne sie sich nun erst auf das furchtbare Geheimnis, das der Sterbende mit ins Grab nehmen wolle. „Er muss sprechen! Mein Vater muss sprechen!“ rief sie in wilder Verzweiflung. Der junge Arzt schüttelte den Kopf. Aber der Sanitätsrat flößte dem Sterbenden wieder einige Tropfen ein. Brandorffs Augen wurden wieder heller. Cecily beugte sich so dicht über ihn, dass ihr Mund fast sein Ohr berührte.
„Höre mich, Vater,“ sprach sie, „höre mich – ich bin Cecily, deine Tochter! Ich bin verzweifelt! Du mußt sprechen, lieber Vater! Nimm dein Geheimnis nicht mit dir! Sprich, ich bitte dich! Wir alle müssen es wissen: wer, wer war es, Vater, wer?“ Totenstille herrschte im Raum. Man sah, wie sich die Brauen des Strebenden krampfhaft zusammenzogen, wie er gewaltsam seine Lippen bewegte, ohne einen Laut hervorzubringen. „Sprich doch, sprich doch, Vater!“ schluchzte Cecily verzweifelt. „Wir müssen es wissen!“ Und mit dem plötzlichen Zweifel, ob sie überhaupt noch gehört würde, fragte sie angstvoll: „Verstehst du, was ich sage, Vater?“ Aber ein mit großer Anstrengung vollführtes Auf –und Zumachen der Augenlider Brandorffs zeigte ihr, dass sie verstanden wurde.
„Oh, du hörst mich, du verstehst mich, Vater!“ rief sie voller Freude. Doch mit sofortigem Rückschlag in ihren verzweifelten Zustand stöhnte sie: „Oh, wenn ich wüßte, was du meinst, Vater! Oh, könntest du doch sprechen! Sieh’, hier auf uns allen ruht ein Verdacht. Du allein weißt, was geschehen ist. Du allein kannst sprechen. Oh, wenn ich doch wüßte, wie wir deine Worte vernehmen könnten, wie wir die Wahrheit erfahren könnten!“ Da richtete sich plötzlich mit ungeheurer Anstrengung der Liegende auf. Seine Augen brannten in unnatürlichem Glanze, seine Hände griffen kraftlos in die Luft. Und heiser, leise und deutlich, durch eine schier übermenschliche Anstrengung brachten seine Lippen die Worte hervor: „Tagebuch – Opale!“ Plötzlich warf er seine Hände hoch, als fehlte ihm die Luft, und fiel lautlos und schwer zurück. Mit einem wildgeängstigsten Gesicht warf sich Cecily über ihn. Und ihr Verzweiflungsschrei zeigte an, dass die Kindesliebe eher den Tod des Vaters erkannt hatte als die ärztliche Wissenschaft.
XII. Die Toten schweigen.
So war also das eingetroffen, was bei den Freunden im Hause Brandorffs die verschiedenartigsten Empfindungen lösen mußte: Brandorff war tot. Leise schlich man durch das Haus. Leise und traurig klangen die wenigen Worte, die gewechselt wurden. Es war, als wenn der Tod seine geheimnisvollen Schleier über das Haus gebreitet hätte, unter denen die Menschen hinwandeln und sich weltenweit entfernt fühlen von dem Getriebe des Lebens, das unaufhaltsam das Todeshaus umbraust. Und doch galt es, bei aller Trauer dringende Geschäfte zu erledigen. Sanders war es, der sich zuerst aufraffte, der die Verpflichtung in sich fühlte, mit seiner Lebenskenntnis der Warner, Schützer und Berater jener beiden jugendlichen Idealisten zu sein, deren Liebe noch am Sterbebette Vereinigung und Segen durchgestzt hatte. Alles im Hause war noch zu ordnen, die Sichtung des Nachlasses war in Angriff zu nehmen, die Vollstreckung des Testaments zu beantragen, kurz: lauter Dinge, zu denen Anordnung und Ausführung Cecily zurzeit nicht fähig war, weil sie den raschen Überblick eines energischen Menschen erforderten. So schmerzlich Sanders auch den Tod des alten Familienfreundes empfand, so dachte er dennoch, ob es nicht im Grunde ganz gut so war. Diese quälende Ungewißheit, in der sich Cecily und nicht zum wenigsten ihre Freunde befunden hatten, alle jene qualvollen Zweifel, ob Brandorff noch liebe, was mit ihm geschehen war, wo er sich befand, mußten jetzt wenigstens aufhören. Und das kam noch hinzu: Brandorff war wenigstens in den Armen der Seinigen gestorben.
Nun über dies eine kam Sanders nicht hinweg: Wie war Brandorff zurückgekommen? Was hatte dies ganze furchtbare Ereignis zu bedeuten? – Wer waren diese Verbrecher, die jene scheinbar so sinnlose, unmenschliche Tat an Brandorff begangen hatten? Das Ganze schon so toll, dass man vielleicht auf den Gedanken kommen konnte, mit Wahnsinnigen zu tun zu haben, mit Verrückten, die offenbar zwecklos einen fast genial ausgerechneten Plan durchgeführt hatten. Aber was war das nun alles – wozu hätte es dienen sollen? Die unerklärlichen Worte des Sterbenden fielen ihm ein: „Tagebuch-Opale“. Was bedeutete das? War hier etwa die Lösung zu suchen? Ihm kam ins Bewußstein, dass ihm schon zum dritten Male das Vorhandensein der beiden großen Opale auffiel. Jedesmal hatte er ein unerklärliches, unheimliches Gefühl bei ihrer Erwähnung verspürt. Aber was sollte das bedeuten?
„Tagebuch-Opale!“ – Ganz recht, das letzte Wort im Tagebuch war Opale. Aber dies Tagebuch war ja unvollständig und unverständlich. Schon früher hatte er sich vergebens um eine Erklärung abgemüht. Schon früher hatte er einsehen müssen, dass es ihm nicht gelingen würde, einen Zusammenhang zu finden zwischen den geheimnisvollen Berichten des Tagebuchs und den erschütternden Ereignissen in diesem Hause. Es schien ihm, als solle dieses Rätsel nie gelöst weren. Und dabei war doch etwas ganz Ungeheuerliches vorgegangen: Ein alter Mann verschwindet aus seiner Wohnung spurlos, er erscheint eines Tages plötzlich wieder, zurückgebracht von Männern, die unter geheimnisvollen Umständen gemietet sind. Man nimmt an ihm die Spuren und die Folgen von Fesselung und Knebelung wahr. Er stirbt, ohne das Geheimnis verraten zu haben, an Kräfteverfall und Herzlähmung. Es erschien wahnsinnig, und doch war es so.
Konnten da die Notizen eines alten Tagebuchs irgend etwas verraten, zu irgendeiner Erklärung beitragen? Kaum. Sah es nicht vielmehr aus, als habe der Sterbende willkürlich Worte gesprochen, die ihm gerade in den Sinn kamen, als habe er Bilder aus vergangenen Tagen, Bilder der Erinnerung, die im Tode plötzlich wieder lebendig wurden, in Worte gefaßt über seine Lippen dringen lassen?
Und doch – dieses eigentümliche Gefühl, das Sanders stets beschlich, wenn er an die Opale denken mußte – es wirkte wider seinen Willen auf ihn. Er wußte, es war der Instinkt in ihm, der sprach, etwas Unerklärliches, eine Empfindung, die in hohem Grade sonst nur bei Frauen auftritt. Und so sehr er, der Mann des klaren, kühlen Verstandes, sich auch sonst gegen alles, was nur Instinkt war, wehrte, so verspürte er doch hier die unbezwingliche Neigung, der dunklen Spur seines Gefühls nachzugehen. Aber der Weg erwies sich als unzugänglich. Die Opale waren eben da, und weiter war nichts über sie zu sagen. Nachdenklich stand er im Arbeitszimmer des Verstorbenen und betrachtete das irisierende Funkeln der beiden auf Samt gebetteten eiförmigen Riesensteine durch die Glasscheibe des verschlossenen Kastens. In milchigen Strahlen brach sich das Licht in ihnen und machte sie undurchsichtig, machte sie zu den schimmernden Behütern eines seltsamen Geheimnisses, das ebenso undurchsichtig war wie sie. Mit Gewalt riß Sanders sich los aus den Träumereien, in die das merkwürdige Aufzucken des Lichtes über die glatten Edelsteine ihn versetzt hatten. Mit Gewalt sagte er sich: „Fort, es ist ja noch so viel zu tun! Hier bin ich in einem Trauerhause, und meiner harren vorläufig noch andere Pflichten, als diese Rätsel zu lösen. Jetzt heißt es der Lebenskluge und Praktische sein.“ Er durfte nicht die Hände in den Schoß legen. War er doch der einzige in diesem Hause, dessen Welterfahrung ihn in den Stand setzte, über den dunklen und bedrängenden Fragen, die aus allen Ecken entgegenstarrten, auch die notwendigen Formalitäten nicht zu vergessen, wie sie der Moment gebot. Der Rechtsanwalt, der Mann der Verantwortung regte sich in ihm. Es war nötig, alle Feierlichkeiten der Bestattung anzuordnen, es war nötig, die geschäftlichen Angelegenheiten für die verwaiste Cecily in die Hand zu nehmen, die Aufnahme des Inventars anzuordnen, die Hinterlassenschaften Brandorffs zu registrieren und für die Eröffnung des Testaments zu sorgen. Denn daran dachten die beiden Liebenden, Cecily Brandorff und Erich Soltau, kaum, in der Verwirrung all ihrer Gefühle, unter dem ungeheuren Druck der furchtbaren Ereignisse dieser Tage.
Ruhelos begann nun Sanders seine Arbeiten im Trauerhause. Er rüttelte den alten Lehnert aus seiner stumpfbrütenden Angst, in die das Unbegreifliche ihn und seine Frau versetzt hatte. Er traf Anordnungen zur Säuberung des ganzen Hauses, deutete der alten Martha an, ein wachsames und liebevolles Auge auf Cecily zu haben, und übernahm den ganzen Verkehr mit den Behörden. Er erstattete dem Kriminalkommissar v. Redberg Meldung des Sachverhalts, benachrichtigte den Notar, der Brandorffs Testamentvollstrecker war, und bestellte den Sachverständigen zur Inventaraufnahme.
Wie er so bei seinen Besorgungen durch das wilde Gewühl der Stadt fuhr, in dem die Menschen aneinander achtlos vorbeiliefen, sich anstießen und sich dabei nicht einmal umdrehten, sagte er sich: In dieser Stadt ist alles möglich! In dem Strudel der Riesenstadt Berlin wohnen oft Menschen in abgelegenen Gegenden, von denen man in den Vierteln des Westens keine Ahnung hat. Hier kann jemand, der will, dass man ihn nicht oder nicht mehr sieht, untertauchen, jahrelang in einem der Massenquartiere des Nordens leben, ohne dass seine nächsten Bekannten von seiner Existenz wissen. Denn Berlin, dieser ungeheure Komplex von gleichförmigen Häusern, war ja nicht nur die helle, reine, strahlende Stadt, wie sie der Fremde oder der reiche Müßiggänger oder der vielbeschäftigte Großkaufmann sieht, sondern es war auch eine Stadt der Dunkelheit, unterirdischer Schlupfwinkel, voller Höhlen des Lasters, Aufenthalte des Verbrechens, Asyle der Verzweifelten, trüber, enger Räume, vollgepreßt mit Menschen, die nichts mehr zu verlieren haben und die jedem Menschen, der noch nicht in ihre Gesellschaft gehört, gefährlich sind.
Oh, er, der Rechtsanwalt, wußte das alles! Und doch – es war nicht zu glauben, dass sich an einem jener lichtscheuen Orte Brandorffs Schicksal entschieden haben solle, dieses ruhigen, reinlichen alten Mannes! Dennoch wiederholte sich Sanders immer. Niemand kann es wissen – niemand kann es wissen! Was war das? War er plötzlich gegen seinen alten, väterlichen Freund noch nach dessen Tode mißtrauisch? Sollte jener Skeptizismus des Kriminalkommissars auch ihn angesteckt haben – jenes Mißtrauen gegen alles und alle? Unsinn, sagte er sich, und doch wollte der leise Zweifel, den Redberg über Brandorffs Charakter geäußert, nicht ganz verstummen.
Der Kriminalkommissar hatte sich als sorgfältig und ruhig denkender Mann erwiesen, gar nicht als die elegante Plaudertasche, für die man ihn im ersten Moment hielt. Hatte er nicht sein Mißtrauen begründet mit dem Tagebuch Brandorffs? Aber diese Begründung war doch wirklich oberflächlich. Denn über die Bedeutung der Tagebuchnotizen für Brandorffs Leben konnte sich nicht einmal ein guter Bekannter des Hauses klarwerden, geschweige denn ein Fremder. Plötzlich durchfuhr es Sanders. Das Tagebuch! Er griff hastig nach seiner Brusttasche – wahrhaftig, er hatte es noch bei sich! Er hatte einfach vergessen, es Cecily zurückgegeben, hatte es voller Achtlosigkeit in all der Aufregung in die Tasche gesteckt. Er zog es hervor, und während das Automobil eben vom glatten Asphalt springend auf unebenes Steinpflaster rollte, blätterten seine Finger von neuem in dem kleinen, braunen Buch, das sich vom Platz in seiner Brusttasche noch ganz warm anfühlte. Aber wie er es ja gleich vermutet hatte, auch diesmal konnte er aus den abgebrochenen Notizen nicht klug werden. Mißmutig und nervös blätterte er in den Seiten und wollte es gerade wieder schließen und fortstecken, als er unwillkürlich stockte. War da nicht eben noch irgend etwas an sein Auge gedrungen – etwas, das er noch nicht kannte – irgend etwas, was er früher übersehen hatte? Sorgfältig nahm er noch einmal jedes einzelne Blatt in die Hand und prüfte es. Plötzlich, als er zum allerletzten Blatte kam, das vor dem Einbande lag, sah er, was ihn so unklar festgehalten hatte. Es war eine der leeren Seiten, das Papier graubräunlich vom Alter. Und da, beinahe unten am Rande, starrte ihm ein Wort entgegen, ein Wort, das er in unbegreiflicher Nachlässigkeit bisher übersehen hatte. Mit bräunlich vergilbter Tinte, zart wie ein Spinnwebenhauch sah er vor sich das Wort. „nie“. Ganz allein stand es auf der Seite. Es war sichtlich Brandorffs Handschrift, jene großgeschwungene Kursivschrift, die den Kaufmann kennzeichnet. Und in ihr stand da, kleingeschrieben, das Wort „nie“. Unheimlich starrte es den Überraschten an und erfüllte ihn mit den düsteren Gedanken von ungelösten Rätseln und ungesühnten Verbrechen. Es war, als wollte es sagen: „Nie, nie wirst du hinter dieses Geheimnis kommen!“
Aber wie hatte Sanders bei all seiner Aufmerksamkeit nur dieses Wort sich entgehen lassen können? Er verstand es nicht. Er begann die Blätter des Tagebuches noch einmal dicht vor seinen Augen durchzusehen. Aber nichts war zu entdecken, was ihm noch entgangen wäre. Wieder und wieder versuchte er den geheimen Sinn jenes Wortes zu enträtseln, das wie ein verlorener Posten auf der Seite allein stand. Aber er konnte keine Zusammenhänge finden. Das Automobil hielt plötzlich an. Resigniert klappte Sanders das Tagebuch zu und steckte es in seine Aktenmappe, um von den schweren, dunklen Schleiern ungelöster Geheimnisse hinaus in die Forderungen des hellen Tages zu treten.
In dem kleinen, einfach eingerichteten Zimmer, das Cecily bewohnte, saßen, tiefbewegt, zwei Menschen. Erich Soltau hatte alles vergessen, was im Garten zwischen Cecily und ihm vorgefallen war, und nur noch das ein Gefühl beherrschte ihn, das Gefühl der tiefen Liebe und des tiefen Mitleids, und der Gedanke, dem unglücklichen Mädchen beizustehen. Und auch Cecily war erhaben über alle jene bösen Gedanken und harten Vorwürfe, die sie Erich Soltau gemachte hatte. Die Schauer des Todes verdrängten alle kleinlichen Gedanken, alle winkelzügigen Kombinationen, richteten den Blick auf das Tiefe, Große und Hohe im Leben und banden die beiden jungen Menschen fester aneinander als je.
Der Abend warf lange Schatten in das Zimmer. Cecily saß in einer dunklen Ecke, ganz versunken in einen großen Lehnstuhl, den Kopf in beide Hände gesenkt. Das matte Licht, das vom Fenster kam, zeichnete weich ihre Silhouette und ließ einen zart metallischen Schimmer von ihrem blonden Haar aufblinken. Soltau ging ruhelos im Zimmer auf und ab. Beide schwiegen, und die Dämmerung, die immer mehr herabsank, umspann jeden von ihnen mit einem Netz, in dem sich die rastlosen Gedanken singen, so dass kaum eines vom anderen Notiz nahm. So viel Unausgesprochenes lag jetzt in der Luft, so viel Worte, die man gerne gesagt hätte, um einander seiner Zärtlichkeit und seines Vertrauens zu versichern, und die doch nicht gesagt wurden, weil sie jetzt in der Gegenwart des Todes zu kleinlich geklungen hätten! Soltau ging in das Dunkel zu Cecily. Er blieb vor ihr stehen, und leise und zaghaft legte er ihr seine Hände aufs Haar. Er fühlte, wie ein krampfhaftes Schluchzen ihren zarten Körper erschütterte.
„Mein süßes Lieb!“ sprach er in dem sanft beruhigenden Ton der Zärtlichkeit. Cecily hob den Kopf. „O Erich,“ sagte sie, „du bist so gut! Ich fühle es – du bist jetzt meine einzige Stütze, meine einzige Hoffnung. Du allein kannst mich aus diesen Wirrnissen retten!“ Und mit feuchtem Schimmer suchte ihr Auge in der Dämmerung das seine. „Cecily,“ erwiderte Soltau, „es gibt Momente im Leben, in denen die Leidenschaft zurücktreten muss vor einer reinen und zärtlichen Liebe, die nur daran denkt, ob es dem Geliebten wohlgehe. Sieh’ – so eine Stunde ist jetzt gekommen. Im Augenblick des Todes müssen alle anderen Gedanken schweigen, und nur der eine bleibt mir, dein Schutz und Schirm zu sein!“ Cecilys Hand suchte die seine, und Soltau fühlte voller Rührung den warmen, dankbaren Händedruck der Geliebten.
„Cecily, o meine Cecily,“ sprach er sanft, „ich fühle, wie nach all den Tagen voller Unruhe und Aufregung der Tod deines Vaters uns nur noch fester und fester mit dem Bande einer klaren und zarten Liebe umschlingt. Mir ist, als hätte dein Vater mit seinem letzten, milden Blick uns dies sagen wollen.“ „O mein Vater!“ stöhnte Cecily. „Der Tod!“ – Und plötzlich kamen ihr alle grausamen Seelenqualen der letzten Tage wieder ins Gedächtnis zurück. Sie zuckte zusammen, und eine tiefe Falte bildete sich auf ihrer Stirn, während sie vor sich hin murmelte: „Wer – wer? Oh, wer kann es nur gewesen sein!“ Doch plötzlich raffte sie sich auf. Sie ergriff Soltaus Hand und sprach mit energischer Stimme: „Komm’, ich muss zu ihm, ich muss meinen geliebten Vater sehen!“ Widerspruchslos folgte ihr Soltau in das Sterbezimmer. Wie ein kalter Hauch kam es ihnen eisig entgegengeweht, als sie in das Zimmer traten, in dem Brandorffs Leichnam aufgebahrt war. War es nicht, als ob sie jetzt schon in eine Gruft hinabstiegen?
Finster starrten die mit schwarzem Samt ausgeschlagenen Wände sia an. Die Vorhänge der Fenster waren herabgelassen, und das Zimmer hatte sein Licht nur von den vier mächtigen Kandelabern, die am Bett des Toten zu Kopf und Füßen standen. Leise schwelend stiegen dünne Rauchwolken von den riesigen Kerzen auf und verwoben sich oben an der Decke zu seltsam phantastischen Gebilden von merkwürdiger Beweglichkeit! Hier lag der Tote. Das leise hin und her zuckende Licht spielte auf seinem Gesicht, das, jetzt so weiß und ruhig, nichts mehr von dem Krampf und den Verzerrungen der letzten Stunde hatte. Seine Hände falteten sich über dem blühendweißen Linnen, wie wenn sie müde aller der Kümmernisse des Erdentags wären.
Cecily und Soltau traten näher. Soltau stand vor dem Totenbett in stumme Gedanken versunken. Cecily kniete vor dem Toten hin. Sie starrte auf das Gesicht ihres Vaters, als wollte sie jeden dieser geliebten Züge in sich einsaugen, als wollte sie in den wechselnden Schatten, die das auf und ab zuckende Kerzenlicht über das bleiche Antlitz des Toten warf, noch einmal die Illusion des Lebens genießen. – Vielleicht schlief er nur? Er mußte im nächsten Moment erwachen! – Vielleicht war alles nur ein wüster, häßlicher Traum, den man abschütteln konnte? Aus jedem Traum wacht man ja auf – warum nicht auch schnell aus diesem? Nein! Es war kein Traum, es war Wirklichkeit, die furchtbare Wirklichkeit des Todes. Von Zeit zu Zeit machte ein schwaches Geräusch die Wohnung ein ganz klein wenig erzittern; es waren die Geräusche der Großstadt, die draußen, fern von diesem Zimmer, ihr wildes Leben weitertreiben ließ, unbekümmert darum, ob mitten in ihrem Herzen Luft oder Schmerz, Liebe oder Tod in die Häuser eingezogen waren.
Es war Wirklichkeit – diese leisen Lebensäußerungen der Großstadt sagten es ihr – dieser Stadt, die Schuld an dem Tode ihres Vaters trug, diese Ungeheueres Berlin, das in den dunklen Schatten seiner verborgenen Adern die Mörder ihres Vaters barg! Diese Verruchten, die sie verabscheute bis auf den Tod, die ihr Leben und ihre zarte Frauenseele mit dem bis dahin unbekannten Gefühl des Hasses durchtränkten! Ein leichtes Geräusch hinter ihr ließ sie zusammenfahren. Sie blickte sich hastig um. Soltau stand immer noch unbeweglich da. An der Tür bewegte sich der Schatten einer eben eintretenden Gestalt. Cecily konnte sie, geblendet vom Kerzenlicht, nicht genau erkennen. „Es wird die alte Martha sein,“ dachte sie und schenkte der Gestalt weiter keine Beachtung, sondern versank aufs neue in ihre düsteren Träume.
Auch Soltau, durch Cecilys Bewegung aufmerksam geworden, sah sich um. In diesem Augenblick wollte sich die Gestalt zurückziehen. Von einem dunklen Gefühl getrieben, trat Soltau vor und rief: „Wer sind Sie?“ Cecily schrak zusammen, ihr Kopf fuhr herum, blitzschnell legte sie die Hand über die Augen, um das Licht abzudämpfen. Plötzlich sprang sie auf und lief auf die Tür zu. Mit ungewohnt lautem, herben Klang durchtönte ihre Stimme das Totezimmer, als sie rief: „Halt – bleiben Sie!“ Der Angerufene trat, sekundenlang zögernd, dann aber mit raschem Entschluß aus der Dunkelheit ins Licht. „John!“ stieß Cecily in einem Ton hervor, in dem sich Überraschung, Zorn und Grauen mischten. Ein minutenlanges Schweigen entstand. Soltau, dem es nur zu gut bekannt war, wie belastend John gegen ihn ausgesagt hatte, stand stumm da, mit gerunzelten Brauen und zusammengepreßten Lippen. „Was wollen Sie hier?“ brach endlich Cecily das Schweigen in strengem Ton.
John näherte sich mit einer kriechenden Demut in seinen Bewegungen. „Gnädiges Fräulein haben mich zwar fortgeschickt,“ erwiderte er unterwürfig, „ich habe mir aber erlaubt, noch einmal das Haus zu betreten, um den gnädigen Herrn, bei dem ich im Dienst war, noch einmal vor seiner Bestattung zu sehen. Gnädiges Fräulein können sich nicht denken, wie tief mich der Tod meines gnädigen Herrn erschüttert. Und nun, wenn gnädiges Fräulein gestatten, will ich wieder gehen!“ Und mit einer tiefen Verbeugung glitt er in dem ungewissen Schein des Kerzenlichts schlangengleich, schattenhaft zur Tür hinaus. Einen Moment war das Gefühl des tiefen Widerwillens, das Cecily gegen diesen Menschen hatte, verdrängt worden von einer Empfindung der Rührung. Vielleicht hatte sie ihm unrecht getan. Vielleicht war es wirklich der treue Diener, der herkam, um im Tode seinen Herrn noch einmal zu sehen.
Aber plötzlich flog ihr der Gedanke durch den Kopf: Woher wußte er vom Tode Brandorffs? Ja, woher wußte er überhaupt von der Rückkunft ihres Vaters? Sie hatte doch der alten Martha und den Portierleuten aufs strengste verboten, über das, was im Hause geschah, auch nur das geringste laut werden zu lassen, und sie wußte, auf diese alten Diener konnte sie sich verlassen. Unwillig über die Erscheinung dieses Menschen, der sie in ihren tiefsten Empfindungen am Sterbelager ihres Vaters gestört hatte, raffte sie sich auf und befahl durch das Sprachrohr dem alten Lehnert, ins Vorzimmer zu kommen. „Haben Sie jetzt mit dem entlassenen Diener John gesprochen?“ fuhr sie den alten Mann mit einer ihr selbst ungewohnten Heftigkeit an. Und ohne eine Antwort abzuwarten, fuhr sie fort: „Warum haben Sie ihn überhaupt ins Haus hereingelassen? Sie wissen doch, dass er hier nichts zu suchen hat!“
„John?“ erwiderte der alte Lehnert verwundert und erschreckt. „Ich habe ihn gar nicht gesehen, gnädiges Fräulein! Ich würde ihm selbstverständlich den Eintritt verwehrt haben!“ „Aber er war eben hier!“ sagte Cecily. „Er war hier?“ fragte Lehnert mit aufgerissenen Augen. „Wo waren Sie bis jetzt?“ fragte Cecily streng. „In meiner Loge,“ erwiderte der Pförtner. „Und John ist nicht an Ihnen vorbeigekommen?“ fragte sie. „Nein, sonst würde ich ihn gesehen haben,“ war die Antwort.
„Haben Sie zu irgendeinem Menschen von den traurigen Vorgängen in diesem Hause gesprochen, Lehnert?“ fragte Cecily weiter. „Ich nehme es Ihnen nicht übel, ich will es nur wissen!“ „Nicht ein Sterbenswörtchen, gnädiges Fräulein, so wahr ich hier stehe!“ „Es ist gut,“ sagte Cecily, „Sie können gehen, aber Sie geben nicht genug aufs Haus acht!“ Erschreckt und zerknirscht verließ der Alte das Vorzimmer. Offenbar war er sich keiner Schuld bewußt. Cecily aber war aufs höchste erregt. Der entlassene Diener hatte sich also unbemerkt auf eine unheimliche Weise ins Haus geschlichen. Was sollte das? Und so leise, wie er gekommen war, so leise war er wieder davongeglitten. Sie war weniger als je geneigt, ihrem sicheren Gefühl zu mißtrauen, mit dem sie stets Abscheu und heimlichen Widerwillen vor dem schweigsamen, geräuschlosen Gesellen empfunden hatte. Hier lag vielleicht die Lösung des furchtbaren Rätsels. Aber wie konnte sie an das alles herankommen? – Wie die Knoten dieser düsteren Wirrnisse zerhauen – was konnte sie überhaupt machen ohne Beweise, allein mit ihren Frauenahnungen und Überzeugungen, auf die kein Gerichtshof der Welt etwas geben würde! Und voll schwermütigen Trotzes gegen die Welt kehrte sie zurück an das Lager des teuren Toten und bedeckte die geliebten bleichen Hände mit Küssen und mit Tränen.
XIII. Visionen.
Ein schimmernder Sommertag leuchtete, als Brandorff zu Grabe geleitet wurde. Ein kleiner Trauerzug nur war es, der dem Sarg Brandorffs zum Kirchhof folgte. Unauffällig schlichen die beiden schwarzen Wagen durch das lärmende Treiben der Straßen Berlins, und niemand von all den Menschen, die achtlos an diesen Zeichen des Todes vorübergingen, konnte ahnen, wieviel Schmerz, wieviel schlaflose Nächte, wieviel erregte Verzweiflung, Hoffnung und Enttäuschung das düstere Coupé barg, das zunächst hinter dem Sarge fuhr und in dem Cecily mit dem Geistlichen saß. In aufrechter, ruhiger Haltung saß sie da. Der Pfarrer im schwarzen Gewande sprach ihr mit milder Stimme Trost zu, aber er gewahrte mit Erstaunen, wie die Tochter des Verstorbenen, diese zarte Mädchenblüte, für deren Nerven man bei dem erschütternden Ereignis fürchten mußte, gefaßt dasaß, ohne eine Träne zu vergießen. Er schrieb diese Wirkung seinen Worten zu, die von dem unendlichen Leben der Seele und von der Wiedervereinigung nach dem Tode sprachen. Aber mit der Zeit gewahrte er, wie Cecily trotz ihrer geraden Haltung ganz in dämmernde Gedanken versunken dasaß. Ihre Augen sahen geradeaus, als suchten sie weit, weit weg irgend etwas zu erfassen, als könnten sie die schwarzen Wände des Wagens durchdringen. Ein herber Zug lag auf ihrem Gesicht, etwas Verschlossenes, das bei den jugendlich milden Zügen des anmutigen Mädchens besonders merkwürdig wirkte.
Es war Cecily, als ob ein dichter, grauer Nebelschleier vor ihren Augen auf und ab wallte. Oft wurde er zart und wie durchsichtig, als schimmere Licht hinter den Wolkennebeln. Cecily kam es vor, als säße sie in einem ungeheuren Zuschauerraum, in dem alles um sie her verschwamm, und hinten – in der Ferne – täte sich der Blick auf eine kleine Bühne auf. Gestalten glitten schattenhaft vorüber, aber, so sehr sie sich auch anstrengte, etwas deutlich zu erfassen, so zerfiel doch alles immer im Moment wieder ins Körperlose, Unbestimmte. Allmählich hob sich aus den vor ihren Augen kreisenden Schemen ein Gesicht heraus: Mohl! – Cecily wußte nun, dass sich in ihrem Hirn ein Moment des Klubabends widerspiegelte, den sie selbst miterlebt hatte. Plötzlich verwischte sich alles, sie sah nur noch die gleitenden Schatten und dann auf einmal Bäume im Dunkel und eine Straßenlaterne vor sich. Sie erkannte das Tor des Klubhauses in der Tiergartenstraße, sie sah Mohl aus dem Hause kommen und sah ihn in den harrenden Wagen steigen, aus dessen Schlag ein Weib sich ihm entgegenbog. Die Kutsche fuhr davon, sie sah sich selbst hinter dem Wagen herlaufen, sie sah eine andere Gestalt aus dem Dunkel der Bäume treten und die erste zurückreißen. Und im selben Moment zerfloß auch dieses Bild in Luft.
Sie begriff, dass ihre Seele alle Einzelheiten jenes Abends noch einmal durchlebte. Sie hatte das Gefühl, als sei sie vollständig getrennt von ihrem Körper, der im Wagen saß, sie fühlte sich der Welt fast entrückt. Von neuem schossen die Nebelschatten zusammen. Cecily erblickte jetzt einen dunklen, engen Raum vor sich, in dem sie undeutlich Gegenstände, von denen einer ein Bett zu sein schien, unterschied. Zwei Männer traten ins Zimmer. Cecily erkannte sie sofort. Mit einer ungeheuren Ruhe, die ihrem halbwachen Bewußtsein einen Moment lang selbst merkwürdig vorkam, sah sie, dass es Mohl und der Diener John waren. Das gelbe, glatte Gesicht des Dieners war verzerrt wie eine Teufelsfratze. Es schien Cecily, als sei alle Verstellung von ihm nunmehr abgefallen, und als sehe sie vor sich das wahre Wesen des Menschen, ein wildes, höhnisches Gesicht, von einer wüsten, höllischen Verruchtheit. Dann kam ein Weib dazu, es war Frau von Zemlinska. Sie zeigte mit großer Bewegung auf das Bett. John schlich zum Bett hin. Er nahm die Decke fort, die den dort liegenden Gegenstand verhüllt hatte. Cecily sah, dass es ein Mensch war. Plötzlich zuckte etwas wie ein gewaltiger Blitz vor Cecily nieder, sie stieß einen markerschütternden Schrei aus, und alles vor ihr zersprang in nichts: Sie hatte auf dem Bett das bleiche, von weißem Haar umrahmte Gesicht ihres Vaters erkannt.
Der Geistliche neben ihr fuhr entsetzt aus seinen Gedanken auf, als er sie so schreien hörte. Er stützte die Zusammengesunkene, er streichelt sie, redete ihr zu: „Die Aufregung, mein Kind, macht das. Sie sollten sich schonen, sich nicht Ihren düsteren Gedanken hingeben!“ – Aber eigentlich war er doch ratlos. Er war froh, als er sah, dass Cecily sofort wieder zu sich kam und ihn ruhig mit zwar tränenfeuchten, aber klaren Augen ansah. „Ich danke Ihnen, Hochwürden, es ist schon gut. Nur ein Augenblick der Schwäche!“ Und zu seiner Beruhigung merkte er, dass sie jetzt aufmerksam und voll fraulicher Weichheit seinen Worten zuhörte.
Der Wagen hielt, und die Trauernden betraten den Kirchhof. Durchsichtig blau glühte die Luft, und schmale, weiße Wölkchen glitten durch den hohen Raum. Es war ein Tag des Lebens, nicht des Todes. Die Leichensteine und die Kreuze, die sonst dem Friedhof seinen bedrückend feierlichen Eindruck geben, hatten heute etwas weiß Leuchtendes, in ihrer Klarheit Versöhnendes an sich, etwas, das die Seele nicht bedrängte, sondern mit einer süßen Wehmut erfüllte. Und die Zypressen, die sonst in ihrer finsteren Steilheit so streng wirken, das Gemüt verdünstern wie der Anblick von Marterpfählen, standen heute hastig schwellend in ihrem dunklen Grün gegen das sanft leuchtende Blau des Himmels, dass man mitten auf diesem Friedhof der Großstadt, vor dessen Mauern das laute Leben Berlins in stürmendem Strudel weiterraste, fast den beglückenden Eindruck einer milden Landschaft des Südens hatte. Heute lagen hier nicht des Todes Schauer in der Luft, sondern ein mildes, süßes Erinnern schwebte über den Gräbern. Der leichte Duft gelber, welker Blätter kam auf Cecily zu und rührte ihre Seele wie die Klänge einer fernen Harfe.
Als die Trauernden über die gelben, grabumsäumten Kieswege dahinschritten, dachte Cecily an den Tod ihres Vaters nur noch mit zarter, wehmütiger Trauer, die ihr ganzes Inneres warm und weich durchdrang. Aus ihrem Herzen waren die Gedanken der Rache, diese, wilde Unruhe, von der sie beherrscht wurde, gewichen. Die Feier in der Kapelle hatte begonnen. Von den erblühten Blumen, die sich auf dem Sarge türmten, stieg ein voller und würziger Duft auf, der sich zu dem leise flackernden Rauch der Kerzen mischte und in dem kleinen, feierlichen Raume, der vom Tageslicht nur spärlich erhellt wurde, alle in eine zarte Betäubung versetzte. Hier in der Kühle der matt erleuchteten Kapelle war nach den ersten Worten des Geistlichen jeder in sich selbst versunken und achtete nicht mehr auf seinen Nebenmenschen. Auf den Stühlen saßen, wie es bei jedem Begräbnis zu geschehen pflegt, fremde Menschen, die man kaum beachtete.
Als die Trauernden die Kapelle verließen und dem Sarg zum Grabe folgten, löste sich aus einer Ecke ein schwarzgekleideter, älterer Herr, der bis dahin unbeachtet im Schatten gesessen hatte. Unauffällig schritt er hinter dem kleinen Zug der Leidtragenden her. Nur Sanders streifte ihn mit flüchtigem Blick. Einen Moment lang war es ihm so vorgekommen, als habe er schon einmal irgendwie die Bekanntschaft dieses Herrn gemacht. Irgend etwas erinnerte ihn an ein ehemaliges Zusammentreffen. Aber bei einer raschen Musterung überzeugte er sich sofort, dass er sich geirrt hatte. Er kannte diesen würdigen Herrn mit dem leicht ergrauten Vollbart und Haupthaar nicht, der mit müdem Schritt hinter ihnen ging. Und Sanders hatte ein vorzügliches Personengedächtnis. Nein, es war ein Irrtum, irgendeine flüchtige Ähnlichkeit hatte ihn getäuscht.
Dennoch war er ein wenig erstaunt, als der fremde Herr den hohen Hut zog und ihn leicht grüßte. Er grüßte zurück und versuchte sich noch einmal zu besinnen – vergebliche Mühe, es gelang ihm nicht. Der fremde Herr schien Miene zu machen, ihn anzusprechen. Sanders, neugierig geworden, blieb ein wenig hinter den anderen zurück. Der Herr näherte sich Sanders, die beiden gingen jetzt in einiger Entfernung von den Trauerzuge. Mit gedämpfter Stimme sagte der Fremde: „Herr Rechtsanwalt Sanders, nicht wahr?“ „Der bin ich!“ erwiderte Sanders. „Mit wem habe ich die Ehre?“ „Es freut mich,“ entgegnete der andere, „dass Sie das nicht wissen. Ich glaubte schon einen Augenblick lang, von Ihnen gekannt zu sein.“ „Ja,“ erwiderte Sanders auf diese merkwürdige Ansprache, „ich dachte in der Tat einen Moment.“ –
„Oh,“ erwiderte der Fremde, „das bedaure ich ungemein. Bitte, Herr Rechtsanwalt, legen Sie meinen Worten keinen beleidigenden Sinn unter. Sie werden sich vielleicht wundern.“ Als aber Sanders ihn starr und schweigend anstarrte, nahm der fremde Herr von neuem das Wort: „Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle“ – und nach einer kurzen Pause mit noch gedämpfter, aber bedeutend hellerer Stimme: „Ich bin der Kriminalkommissar von Redberg.“ „Was?“ fuhr Sanders auf. „Sie sind“ – „Kriminalkommissar von Redberg, wenn Sie nichts dagegen haben,“ sagte der andere jetzt mit seiner natürlichen Stimme. „Bitte,“ fuhr er fort, „seien Sie nicht erschreckt – ich habe meine Gründe. Dass Sie mich nicht erkannt haben, ist das schönste Kompliment für mich.“ „Und darf ich fragen, welche Gründe Sie zu dieser Maskerade auf dem Friedhof bewogen?“ lauteten die Gegenworte des Rechtsanwalts.
„Gewiß,“ war die Antwort. „Sehen Sie, Herr Rechtsanwalt, Sie selbst wissen ja aus unserer gemeinsamen Begegnung in jener bewußten Nacht, dass ich den Fall Brandorff nicht habe ruhen lassen. Oder besser – ich will offen sein – der Fall hat mich nicht ruhen lassen. Denn, ehrlich gesagt, ich habe außerordentlich wenig erreicht. Ich weiß jetzt nur eines mit Sicherheit: die Täter müssen der besten Gesellschaftsklasse angehören. Denn die Motive, von denen sie geleitet wurden, scheinen mir nicht die gewöhnlicher Verbrecher zu sein, die sicherlich noch auf ein Lösegeld erpicht gewesen wären. Und nun wissen Sie ja auch aus Ihrer Praxis, dass die meisten Verbrecher eine eigentümliche Neigung haben: sie kehren immer wieder zum Tatort zurück. Sie beobachten mit krankhafter Leidenschaft alles, was mit ihrem Opfer geschieht. Und sie können es nicht lassen, am Grabe ihres Opfers zu stehen, sie umkreisen es, wie der Nachtfalter das Licht. Oft, wenn sie ihren Plan aufs allergenaueste durchgeführt haben, setzen sie später alles aufs Spiel durch jene Neigung, an die man nicht glauben will, wenn man nicht die Verbrecherpsyche kennt. Nun hat sich allmählich in mir die Überzeugung festgesetzt, dass der Täter kein normaler Mensch sein kann. Die ganze Art dieses Verbrechens oder, um bei unserem Beamtenjargon zu bleiben, der Stil des Verbrechens deutet auf einen abnormen Geisteszustand. Es ist meine feste Überzeugung, dass der Täter über kurz oder lang irgend etwas tut, was seinen ganzen, so verrückt sorgsam ausgearbeiteten Plan über den Haufen wirft und ihn der Öffentlichkeit preisgibt.“ „Darf ich eine Frage an Sie richten, Herr Kriminalkommissar?“ sagte Sanders „Bitte sehr, Herr Rechtsanwalt!“ erwiderte dieser. „Nur muss es schnell geschehen, denn wir nähern uns schon dem Grabe, wie Sie sehen!“ „Erinnern Sie sich noch an das alte Tagebuch Brandorffs?“ fragte Sanders.
„Genau!“ lautete die Antwort. „Sie haben,“ fragte Sanders weiter, „jedenfalls den Inhalt der Blätter noch in Erinnerung?“ „Vollkommen,“ erwiderte Redberg. „Wissen Sie vielleicht aus dem Kopf,“ fragte Sanders sehr gespannt, „welches das letzte Wort in Tagebuch überhaupt war?“ „Ja, das kann ich Ihnen genau sagen,“ entgegnete Redberg. „Es fiel mir besonders auf. Das Wort heißt: Opale!“ „Dacht ich’s doch!“ rief Sanders erregt. „Warum?“ fragte Redberg. „Nun,“ entgegnete Sanders, „auch ich war bis dahin überzeugt, dass das letzte Wort „Opale“ hieß. Ich habe aber vor kurzem auf der letzten Seite ein Wort entdeckt, es ist das Wort: „Nie“. Wir, Sie wie ich, haben es bis jetzt einfach übersehen.“
„Das ist unmöglich!“ rief der Kriminalkommissar. „Und doch ist es so!“ antwortete Sanders. „Nein, es kann nicht sein!“ sagte Redberg. „Sie müssen wissen, ich habe das Tagebuch immer wieder, Blatt um Blatt durchgesehen. Besonders auf der letzten Seite wäre es mir aufgefallen. Doch schon war der Zug am Grabe angekommen, und es war Sanders nur noch möglich, dem Gespräch rasch hinzuzufügen: „Schön – bei mir zu Hause werde ich Ihnen zeigen, dass es so ist, wie ich gesagt habe.“ Der Kriminalkommissar nickte stumm mit dem Kopf. Im warmhellen Nachmittagssonnenlicht lag der frisch aufgeworfene Hügel von gelbem Sand da, der später die dunkelstarrende Grabhöhlung wieder ausfüllen sollte. Ein leichter, lauer Wind strich über die dunklen Gebüsche des Friedhofs, der in seinem duftigen Wehen so gar nichts vom Sterben und so viel von Hoffnung auf eine blühende Sommerzukunft zu tragen schien.
Als Sanders und Redberg sich dem Grabe näherten, sahen sie Cecily in ihrer ganzen jugendlichen Anmut mit leicht gesenktem Kopf am Rande des Grabes stehen. Jetzt, in der Trauer, war ihr Gesicht bleich geworden, eine leichte Falte hatte sich über den Mund gegraben, aber die Leiden um den Vater schienen ihr Antlitz, ja ihre ganze Haltung in einer ungemeinen Weise veredelt zu haben. Knapp saß das Trauerkleid aus schwarzem Krepp und ließ jede Linie ihres schlanken Mädchenkörpers voll zur Geltung kommen. Das dichte, blonde Haar schimmerte unter dem schwarzen Schleier, der von dem Trauerhute herabging, hervor wie die Sonne, die aus den verhüllenden Wolken hervordringt. Hier in der freien Natur, mitten unter den Zeichen des Todes, sah man erst, wie schön sie war. Es war, als ob das Leben in ihr seine Zeichen herausgesteckt hätte, im Trotz gegen die ringsum androhende Gewalt des Todes.
Der Sarg wurde hinabgelassen. Der Geistliche sprach die letzten Worte von dem im Leibe Ärmsten, den Bubenhände der Erde entrissen hätten und der doch in der Seele jetzt so reich sei. Die Sonne schien auf die schwarzgekleideten Menschen, und ein Vogel pfiff hinter ihnen, fast als wollte die Natur zeigen, dass sie sich um den Jammer der Menschen nicht kümmere, und dass sie voller Hoffnung auf Reife immer weiter blühe und jubiliere. Drei Hände voll Sand warf jeder noch dem Sarg nach. Und dann fielen dumpf die Erdschollen der Totengräber hinab.
Die Trauerfeier war dem Ende nahe. Cecily stand ganz in ferne Träume versunken da. Sie dachte daran, dass sie nun nie mehr das geliebte Haupt des Vaters mit seinem Kranz silberner Haare küssen, nie mehr diese bleichen, schmalen Hände in den ihren halten würde. Und ein Gefühl unendlicher Bitterkeit überkam sie. Mitten hinein in den hellen, blau und gelb strahlenden Sommertag wuchs plötzlich ein ungeheurer Haß auf diese ganze unbekannte Welt, die da draußen, vor den Toren des Friedhofs, vorbeirollte, in ihr empor – diese Welt, die Geschöpfe von so satanischer Verderbtheit in ihren Armen bergen konnte, wie es jene Verruchten waren, die ihr kindliches Glück zerstört hatten.
Sanders war durch das Gespräch mit dem Kriminalkommissar vor aller innerlichen Versenkung eines Trauernden bewahrt geblieben. Er blickte um sich, und als er die finstere Miene Cecilys sah, war es ihm sofort klar, dass sie an das Verbrechen dachte. Er empfand seine Wahrnehmung schmerzlich genug, denn in seiner Absicht lag es, Cecily hinfort vor allen trüben Rückerinnerungen an jene furchtbaren Tage des Leidens, die nun vergangen waren, zu bewahren. Als sie wieder auf der Hauptallee des Kirchhofs waren, die sie dem großen, eisernen Ausgangstor zuführte, bemerkte Sanders flüchtig in einer parallel laufenden Allee, in einiger Entfernung von ihnen, einen Mann, der, offenbar in nachdenklicher Haltung, die Hände auf dem Rücken, langsam einherschrit. Jetzt bog er in einen Querweg ein. Wenn er so langsam weiterging, mußten sich ihre Wege kreuzen. Sanders hatte das so flüchtig beobachtet, wie man in schweren Gedanken oft kleine, unwichtige Dinge sieht und sie fast mechanisch registriert. Größere Aufmerksamkeit schenkte er dem Spaziergänger nicht.
Wenige Minuten darauf begegneten sie sich wirklich. Scheinbar überrascht blieb der Mann stehen, schritt auf Soltau zu, zog den Hut und reichte ihm die Hand. Soltau hob den Kopf, auch Sanders blickte jetzt schärfer hin – es war Herr von Mohl. Cecily war allein mit ihren Gedanken, den Kopf zur Erde gesenkt, rasch vorwärts gegangen, sie war schon um eine Querallee weiter als die anderen und hatte die Begrüßung gar nicht bemerkt. Soltau wurde bleich und zuckte zusammen. „Wie geht es Ihnen?“ fragte Mohl mit seiner hohen, dünnen Stimme, während seine hellen, grauen Augen unruhig flackerten. „Wie geht es Ihnen, lieber Soltau? Habe Sie ja so lange nicht gesehen! Dem Klub untreu geworden? Was machen Sie hier? Doch nicht lieben Anverwandten begraben – äh was?“ Sichtlich aufs unangenehmste berührt, gab Soltau die notwendigsten Antworten.
Sanders grüßte kurz, reichte Mohl schnell die Hand und ging rasch weiter, um Cecily zu erreichen. Sie waren am Ausgang angekommen. Als Sanders mit Cecily auf die Straße trat, sahen sie vor dem Tore einen Wagen halten, der trotz des warmen Sommertages dicht geschlossen war. Sie bleiben einen Moment an der Friedhofsmauer stehen, um auf Soltau zu warten. Sanders kehrte dem Tore den Rücken zu und erzählte Cecily, dass Soltau eben einen Bekannten getroffen hätte. Plötzlich sah er Cecilys Gesicht bleich wie Wachs werden. Ihre Augen waren weit aufgerissen, und sie starrte über Sanders’Schulter nach etwas, das hinter seinem Rücken vorging. Er drehte sich schnell um, sah aber nur Soltau mit Mohl aus dem Tor kommen. Der Schlag des geschlossenen Wagens öffnete sich jetzt. Eine Dame beugte sich heraus: Es war Frau von Zemlinska. Mohl stieg zu ihr in den Wagen. In diesem Moment stieß Cecily einen Schrei aus und sank mit geschlossenen Augen um. Sanders fing die Ohnmächtige auf und schickte Soltau sofort nach Wasser und Hilfe.
Während er noch mit Cecily beschäftigt war, hörte er plötzlich hinter sich eine Stimme. „Entschuldigen Sie, wie sind die Namen der Herrschaften, die eben wegfuhren?“ Sanders drehte sich, empört über den unzeitgemäßen Aufdringlichen, um. Es war der Kriminalkommissar, der mit einem Interesse, das nicht nur einer menschlichen Teilnahme entsprang, beobachtet hatte, welch furchtbare Wirkung der Anblick des neben Soltau schreitenden Fremden und dessen am Kirchhofstor im Wagen harrender Gefährtin auf Cecily ausübte.
Der Rechtsanwalt hatte nicht übel Luft, die Frage Redbergs unbeantwortet zu lassen. Er sah sich nach Soltau um, der jetzt mit Hilfe herbeikam. Der Kommissar aber stand immer noch abwartend da, und mechanisch sagte Sanders: „Das war Herr von Mohl und Frau von Zemlinska.“ „Ich danke!“ sagte der Kommissar und war nach wenigen Sekunden den Blicken der Anwesenden entschwunden, unauffällig, wie er gekommen war.
XIV. Juwelen.
Cecily kam im Wagen bald wieder zu sich. Doch weder Sanders noch der um seine Braut besorgte Soltau wagten das Schweigen zu brechen, das drückend auf ihnen lag. Stumm fuhren sie den Weg zurück, den sie gekommen. In düsterem Schweigen empfing sie das Haus. Die traurigen Gesichter der alten Portiersleute, die weit offenstehenden Fenster vermehrten nur noch den Eindruck des Beängstigenden. Jeder Schritt hallte durch alle Räume wider. Langsam, mit traurigem Antlitz, schritt Cecily durch alle Zimmer des Hauses, wie wenn sie prüfen wollte, ob sich in der kurzen Zeit ihrer Abwesenheit nichts verändert habe. „Mir ist,“ sagte sie mit dunklem Klang der Stimme zu Sanders, der ihr folgte, „als ob dies alles hier unendlich anders geworden ist, seit ich weiß, dass mein Vater nie mehr hier weilen wird. Es ist alles so fremd! Und doch – war es mir nicht einst so vertraut? Aber nun – nein, Sanders, ich halte es nicht mehr aus!“ Und mit einem energischen Raffen ihres Rockes fügte sie hinzu: „Es geht nicht mehr! Alles das lastet zu schwer auf meiner Seele – ich kann hier nicht mehr bleiben. Ich hasse diese Stadt, die mir meinen Vater stahl, ich hasse dieses wüste, unheimliche Treiben verborgener Mörder, ich hasse Berlin! Ich muß fort von hier, ich werde mit Erich irgendwo in der Welt hinziehen, sei es, wo es sei, nur fort!“
Sanders hatte still zugehört, er verstand ihre Gefühle. Sie waren währenddessen im kleinen Arbeitszimmer des Toten angelangt. Seltsam befangen blickte Sanders um sich. Wieviel Erinnerungen, wieviel Gedankenverbindungen wollten ihm doch hier zu Bewußstein kommen! Sein Blick fiel unwillkürlich auf die Glaskästen mit den Edelsteinen. Cecilys Augen waren seinem Blick gefolgt. Jetzt trat sie neben ihn, und mit erregter Stimme sprach sie: „Oh, wenn Sie wüßten. Sanders, wie mir diese Geschmeide hier in tiefster Seele zuwider sind! Gewiß, Sie wundern sich, bei einer Frau derartige Empfindungen anzutreffen. Aber seien Sie überzeugt, die kalte, glitzernde Pracht allein hat an meinem Unglück schuld! Sehen Sie nur, wie die Steine so leblos und funkelnd zugleich auf ihrem Samt gebettet daliegen! Ist es nicht, als wollten sie sagen, dass alles, was Schönheit und äußeren Glanz trägt, gefühllos und ohne Herz sein müsse? Ich hasse diese Lebensauffassung, und darum, Sanders, hasse ich diese leuchtenden Edelsteine. – Und sehen Sie nur die beiden riesigen Opale in ihrem besonderen Kästchen! Ich weiß, wie mein Vater gerade an ihnen ging. Gott weiß, welche Erinnerungen sich an diese Steine knüpften. Aber gerade sie mag ich nicht. Sehen Sie, dies Funkeln und Glitzern, wenn ein Lichtstrahl auf sie fällt. Jetzt erscheinen sie grün, jetzt rosa! Jetzt auf einmal milchig trübe, als wollten sie sich verbergen, und nun im Moment prachtvoll blaurot! Darin, finde ich, steckt etwas Charakterloses, das mir in meinem Herzen widerwärtig ist. Männer empfinden hier vielleicht anders, und die meisten Frauen ziehen wohl auch die Schönheit des Glanzes allen heimlich echten Empfindungen des Herzens vor. Aber ich bin anders. Ich brauche keinen Schmuck, ich mag diese Steine nicht, sie haben für mich etwas tief Unheimliches. Jedesmal, wenn ich auf diese Opale blicke, ist es mir, als sähe ich im glimmernden Aufblitzen des Lichtes über die seltsam undurchsichtige Oberfläche Blutströme laufen! Ich weiß, wie mein Vater seine Sammlung geliebt hat, aber ich muss mich von diesen Steinen trennen. Sie müssen fort! Ich werde sonst nie wieder meines Lebens froh!“
Und Sanders mußte ihr versprechen, einen Juwelier zu besorgen, der die Steine kaufen würde. Der Juwelier Biedenkapp musterte aufmerksam und wohlgefällig die Sammlung. Ein älterer, fast unscheinbar aussehender Mann, dem man es nur an seiner geraden, schlichten Sicherheit anmerkte, dass er wohl täglich Gelegenheit hatte, mit den höchsten Kreisen in Berührung zu kommen. Die Fächer der Glaskästen hatten alle ihre besonderen Schlüssel, die im Geldschrank aufbewahrt wurden. Cecily kam mit den Schlüsseln und öffnete die Kästen. Der Juwelier nahm jeden Stein in die Hand, ging ans Fenster und prüfte ihn sorgfältig. Er hatte eine kleine Wage mitgebracht, auf der er die Steine wog, und man sah ihn vorsichtig mit Ätzdiamanten, Flüssigkeiten und Hämmerchen operieren, mit denen er die Echtheit der leuchtenden Schätze prüfte.
Es blieb nur noch das Kästchen mit den beiden Opalen. Es war ganz schmal, hatte etwa die Größe eines Rauchtischchens, und ganz aus schwarzem, mattem Ebenholz ruhte es auf vier schlanken Beinen. Unter dem schrägen Glasdach lagen, fast in weichen, schwarzen Samt versinkend, die beiden eigroßen Opale, auf denen das Licht sich verwirrend in buntvermischten Farben milde brach. Cecily steckte den Schlüssel ins Schloß – er drehte sich nicht. Sie zog ihn heraus und sah ihn an, es stellte sich heraus, dass er nicht paßte. Sie probierte einen anderen aus dem großen Schlüsselbund, an dem die Schlüssel für die Juwelensammlung hingen – auch dieser paßte nicht. Sie versuchte es nacheinander mit allen Schlüsseln, aber keiner wollte das Schloß öffnen. Nach ihr tat es Sanders, aber mit demselben erfolglosen Resultat. Was war das? Wo war der Schlüssel? Cecily und Sanders durchsuchten den ganzen Geldschrank, er war nicht da; auch im Schreibtisch war nichts zu finden. Der Schlüssel war verschwunden.
Doch Cecily war ungeduldig. „Aufbrechen!“ rief sie. „Ich will nicht, dass durch äußere Umstände die unheimlichen Opale Sieger gegen mich bleiben!“ Und so wurde ein Stemmeisen gebracht, und Sanders sprengte mit leisem Krach den Deckel ab. Er konnte das Schloß dadurch bloßlegen und sah, dass seine seltsam verschnörkelte Konstruktion einen Schlüssel von besonders gezacktem Bart verlangte, wie er tatsächlich im ganzen Hause nicht zu finden war. Schon vorher hatte der Juwelier mit großen Augen die Opale betrachtet. Doch nun, als er sie in die Hand nahm und ihr Gewicht fühlte, wurde seine Miene bedenklich. „Ich muss Ihnen offen sagen, gnädiges Fräulein,“ sprach er, „als langjähriger Bekannter des Herrn Sanders, was ich darüber denke, Sehen Sie, die Opale sind wundervoll. Sie sind in dieser ungeheuerlichen Größe ein Wunder, wie ich es in Europa einfach noch nicht gesehen habe. Und darum fehlt mir, ehrlich gesprochen, die Schätzung!“
Er streichelte die schweren Steine bewundernd und liebevoll und fügte kurz hinzu: „Ich kann sie einfach nicht bezahlen!“ Und nach einer kurzen Pause, während welcher Cecily und Sanders sich schweigend und verblüfft ansahen, sprach er: „Jeder dieser Steine ist ein Monstrum. Ich will Sie nicht übervorteilen, ich bin kein junger Mann mehr, und ich führe meine Geschäfte seit Jahren in denselben Bahnen weiter. Solche Extravaganzen kann ich mir nicht erlauben. In diesem Ausnahmefall bin ich nicht einmal imstande, augenblicklich den objektiven Wert der Steine anzugeben. Sie wissen wohl, Opale sind nur Halbedelsteine, aber bei solcher Größe und bei solchem Feuer fällt jede normale Schätzung weg, und man kann nur nach Kuriositätswert schätzen. – Ja, wenn ich darüber nachdenke, so weiß ich nicht einmal, wie ich diese ungeheuren Steine verwerten sollte. Also, mit einem Wort, ich kann sie nicht nehmen!“
Aber Cecily sagte: „Die Steine müssen weg. Sie sind gegen uns ehrlich, Herr Biedenkapp, ich will es auch zu Ihnen sein: ich mag die Opale nicht, ich habe eine unüberwindliche Abversion gegen sie. Ich gebe sie um jeden Preis fort!“ Der Juwelier schüttelte nachdenklich den Kopf: „Ich selbst kann sie wirklich nicht nehmen, gnädiges Fräulein, das wird mir immer klarer. Aber ich will Ihnen etwas sagen. Ich habe einen alten Kunden, es ist ein Herr von der türkischen Botschaft, der sich sehr für Kuriositätssteine interessiert. Wenn ich nicht irre, so versteht er sich gerade besonders auf Opale. Den werde ich Ihnen mit Ihrer gütigen Erlaubnis schicken.“
„Wer ist es?“ rief Sanders. „Doch nicht etwa Nured-Bei.“ „Jawohl,“ erwiderte der Juwelier, „es ist Herr Nured-Bei.“ „Oh, den kenne ich ja sehr gut!“ rief Sanders lebhaft. „Es ist ein reizender Mensch. Denken Sie sich, Cecily, einen türkischen Herrn in den besten Mannesjahren. Aber nicht etwa träge und veträumt, wie man sich die Türken meistens vorstellt, sondern lebhaft und aufgeweckt. – Ich bin Ihnen sehr dankbar, Herr Biedenkapp, dass Sie uns an diesen Herrn weisen!“ Und man vereinbarte mit dem Juwelier, dass, im Falle Herr Nured-Bei auf die Steine reflektieren sollte, die weiteren Unterhandlungen durch die Hände des Juweliers gehen sollten.
Der Attaché an der türkischen Botschaft Nured-Bei kam zum Tee. Sanders selbst brachte ihn, indem er eine alte Bekanntschaft wieder auffrischte. Nured-Bei war ein schöner Mann, den man etwa auf 36 Jahre schätzen konnte, mit großen, dunklen, blitzenden Augen und tiefgebräuntem Teint, dem man indessen in seiner eleganten europäischen Kleidung den Orientalen kaum anmerkte, hätten ihn nicht seine Hände mit der dunklen Haut unter den Fingernägeln verraten. Nured-Bei zeigte sich als ein Mann, der die Welt kannte. Er hatte nach seiner Studienzeit in Deutschland lange Jahre in Paris gelebt, und so war sein Benehmen das eines Menschen von bester europäischer Kultur. Dennoch lag über seinem Gesicht ein Zug der Schwermut, den alle Orientalen haben.
Er saß Cecily gegenüber zwischen Soltau und Sanders im Salon, der wohl nun seit langer Zeit zum ertsenmal wieder behaglich plaudernde Menschen sah, und erzählte von den Sitten der Türken, von seinen Reisen, gab kleine Erlebnisse zum besten, kurz: man merkte gar nicht, dass es mehr und mehr dämmerte. Dann kam man auf Imitationen von Edelsteinen zu sprechen. Eine gute, moderne Imitation in echter Fassung, warf Soltau ein, „ist doch ohne Gerätschaften auch von geübten Augen schwer als unecht zu erkennen!“
„Oh,“ entgegnete Nured-Bei, „ich würde sie schon erkennen. Sie müssen bedenken, das Auge eines Türken ist für Echtheit oder Unechtheit von Juwelen unendlich viel geschärfter als das eines Europäers. Sie müssen nämlich wissen, dass man in Kleinasien Imitationen von Edelsteinen herstellt, nicht etwa Glasflüsse, sondern Nachahmungen, deren Zusammensetzung und Herstellung sorgfältig gehütetes Geheimnis ist, die, wenn sie nach Europa kämen, selbst das feinste Juwelierauge täuschen würden. Aber diese falschen Steine kommen nie nach Europa. Sie werden in der Türkei zu allerlei seltsamen Zwecken gebraucht.“
„Herr Biedenkapp erzählte uns von Ihrem besonderen Interesse für Opale!“ knüpfte Sanders an, der nun endlich auf das Hauptthema gekommen war, um dessentwillen Nured-Bei hier saß. „Das,“ sagte Nured-Bei, „ist eine andere Sache. Wenn ich sagen sollte, woher eigentlich mein besonderes Interesse für Opale kommt.“ „O bitte, sprechen Sie doch!“ rief Cecily eifrig. „Nun,“ entgegnete Nured-Bei, „es ist Ihnen vielleicht bekannt, dass bei uns in der Türkei der Sultan sich in fast noch größerer Abgeschlossenheit hält als in Rußland der Zar. Das alles kommt von der unteirdischen Arbeit einer geheimen, revolutionären Partei, die das ganze Leben bei uns unsicher macht. Das ist jene geheime Partei, die man „Jungtürken“ nennt. Das seltsamste bei alledem ist, dass der Gründer der Geheimpartei der eigene Bruder des Sultans war. Schon begannen die „Jungtürken“ ihre Macht auszudehnen, schon begann die geheime Revolution zu arbeiten, da wurden plötzlich ihre Reihen durch Verrat ungeheuer geschwächt. Die Pforte verstand es, tüchtige Leute, deren Beteiligung an der Geheimpartei sie ahnte, in ihrem eigenen Dienst zu fesseln, und es schien dadurch, als ob eines Tages die Partei der „Jungtürken“ fast verschwinden wolle. Da auf einmal trat ein kühner Mann an die Spitze. Und nun ging es wieder von neuem in schreckenerregender Tätigkeit los.
Abdul Hamid war damals Sultan geworden. Eines Tages fühlte sich der Sultan krank. Das Fieber peinigte ihn furchtbar, und er wälzte sich in düsterem Schrecken auf seinem Lager, denn natürlich glaubte er sich von seiner Umgebung verraten und vergiftet. Eine strenge Untersuchung wurde eingeleitet, aber sie ergab nichts Stichhaltiges. Schon fühlte der Sultan sich unter gräßlichen Qualen immer schwächer und schwächer werden, schon murmelte das Volk von der ängstlich geheimgehaltenen Krankheit, da ließ sich im Palast ein alter Pilger melden, der behauptete, er könne dem Sultan Heilung bringen. Der Sultan fühlte sich dem Tode so nahe, dass er jede Aussicht auf Rettung glückselig ergreifen mußte, und er befahl, den Pilger zu ihm zu führen. Der Pilger kam und wünschte mit dem Sultan allein zu sein. Niemand weiß, was die beiden gesprochen haben. Der Pilger hatte kaum den Palast verlassen, als sich im Befinden des Sultans schon eine Besserung einstellte. Er wurde gesund, aber er war an diesem Tage ein tiefernster Mann geworden. Bald darauf konnten die Intimen des Hofes den Sultan in einem neuen Gürtelschmuck sehen. Es war ein weißer, breiter Ledergürtel, auf dem über den einfachen, alten Silberschnallen zwei riesige Opale saßen. Allmählich erfuhr man, dass der Gürtel mit den kostbaren Opalen ein Geschenk des Pilgers war, der die Steine aus Indien mitgebracht hatte. Wie sie da in seinen Besitz gekommen sind, blieb Geheimnis. Es scheint, als wären es alte Tempel-Schmuckstücke. Bald wußte man, der Sultan glaubte, in ihnen läge seine Gesundheit und sein Glück. Da faßte der entschlossene und trotzige Führer der Jungtürken, um seiner Partei den Mut wiederzugeben, einen tollkühnen Plan.
Er verstand es, Verbindungen mit dem Harem herzustellen, und eines Tages geschah es, dass durch Frauenuntreue die Steine in seine Hände gerieten. Damals ging im Volke das Gerücht, der Bosporus könne die Menge der Weiberleichen nicht fassen, sondern spüle täglich neue Leiber ertränkter Frauen an den Strand. Doch in den Geheimquartieren der Jungtürken herrschte Jubel. Ihr Führer ließ von den Opalen in Damaskus Imitationen anfertigen. Die Hauptleiter der Geheimgesellschaft bekamen jeder einen weißen Ledergürtel mit den beiden unechten Opalen darauf, um in der Partei den Eindruck hervorzurufen, als gingen die indischen Glückssteine blitzschnell durch alle Gegenden und Länder, tauchten bald hier, bald dort auf und erfüllten die Revolutionäre allerorten mit neuem Mut. Doch auch der Räuber sollte sich nicht lange der Steine freuen. Er knüpfte enge Verbindungen mit Europa und Europäerinnen an, und wie es dem Sultan gegangen war, so ging es auch ihm: durch Frauenlist wurden ihm die echten indischen Opale geraubt. Was aus ihnen geworden ist, das weiß niemand. Sie sind damals spurlos verschwunden. – Aber um auf unseren Ausgangspunkt zurückzukommen: Wenn ich Sie bitten darf, mein gnädiges Fräulein, ich hörte von Opalen, die in Ihrem Besitz sind. Darf ich sie sehen?“
„Aber gewiß,“ sagte Cecily liebenswürdig. Sie verließ den Salon auf einen Moment, um die Steine zu holen. „Ein merkwürdiges Land, Ihre Heimat!“ nahm Soltau das Gespräch auf. „Ja, sicherlich!“ erwiderte Nured-Bei. „Und trotzdem,“ fuhr er fort, „versichere ich Ihnen, dass ich mich bei aller Unsicherheit, bei aller Verräterei doch nach meiner Heimat sehne!“ „Es scheint mir kaum glaublich,“ bemerkte Sanders, der bis dahin nachdenklich dagesessen hatte, sinnend, „dass Europäer die Steine geraubt haben sollen.“ „Und doch war es sicher so!“ erwiderte Nured-Bei.
Cecily kam zurück mit einem Etui in der Hand, in das sie die Steine gelegt hatte, um sie zur vollen Wirkung zu bringen. Sie stellte das Etui auf den Tisch, und mit einer anmutigen Bewegung schlug sie vor Nured-Bei den Deckel zurück. Doch kaum hatte Nured-Bei die Steine erblickt, so stutzte er in heftiger innerer Bewegung. Seine Gesichtsfarbe wurde einen Moment fahl. Er biß sich auf die Unterlippe und sprach kein Wort. Dann ergriff er langsam jeden Stein einzeln, ließ das Licht vielfach darüber gleiten, hauchte sie an, und plötzlich legte er sie sorgfältig in das Kästchen zurück. Mit äußerster Bewunderung hatte ihn Sanders beobachtet. Er fragte Nured-Bei: „Gefallen Ihnen die Steine?“ Doch der Türke hatte jetzt seine ganze orientalische Ruhe wiedergewonnen. Er schwieg einen Moment währenddessen er prüfend auf die Anwesenden blickte. Dann sagte er mit fester, wohltönender Stimme: „Die Opale sind unecht!“
„Unmöglich!“ riefen Cecily und Soltau entrüstet. „Dennoch ist es so!“ erwiderte Nured-Bei.“Zu meinem Bedauern, ich kann nichts daran ändern!“ „Aber der Juwelier erkannte doch sogar ihre Echtheit an!“ rief Cecily. „Herr Biedenkapp ist ein tüchtiger Kenner, aber darauf kann er sich nicht verstehen!“ erwiderte gelassen Nured-Bei. „Und um Ihnen alles zu sagen: die Steine gehören zu den Imitationen der indischen Opale des Sultans, die Mustapha Fasil-Pascha einst in Damaskus machen ließ. Ich habe sie sofort erkannt!“
XV. "Feuer!"
Die Opale waren also unecht! In die Worte des türkischen Kenners, den sogar der Juwelier gerühmt hatte, konnte man keinen Zweifel setzen. Doch wie kam es, dass der alte Brandorff die Imitationen neben den anderen unzweifelhaft echten Edelsteinen so liebevoll aufbewahrte, dass er sie als echt bezeichnete? Das war doch merkwürdig, denn ihre Größe mußte ja für jeden Unbefangenen zuerst den Verdacht der Unechtheit erwecken, wenn nicht unzweifelhafte Beweise für das Gegenteil vorlagen. Folglich mußte der alte Brandorff beim Erwerb der Opale mißtrauisch gewesen sein, wie jeder vernünftige Mensch. Und bei solchen Riesensteinen war es schwer, einen Menschen lange über den Wert zu täuschen. Folglich mußte Brandorff ihre Unechtheit gekannt haben. Doch nein, er legte ja den größten Wert auf die Steine!
Es war ein wahrer Rattenkönig von Folgerungen und Schlüssen, ein wirrer Knäuel von Mißverständnissen, der durch jeden neuen Schluß nur immer wirrer und widerspenstiger wurde. Und Rechtsanwalt Sanders erinnerte sich, dass an jedem wichtigen Punkte in dieser ganzen unglücklichen und so seltsamen Begebenheit einmal der Moment gekommen war, wo seine Aufmerksamkeit auf die Opale gelenkt wurde. Immer wenn man glaubte, alles zu wissen, gab ihr unfaßbares Glitzern, ihr durch alle Regenbogenfarben gleitendes Funkeln neue Rätsel auf. Waren nicht die letzten Worte des Sterbenden gewesen: „Tagebuch – Opale!“ – Ja, war nicht das letzte Wort im Tagebuch selbst „Opale“ gewesen?
Nein – schoß ihm auf einmal ein kleiner Nebengedanke durch den Kopf – das ist unrichtig; das letzte Wort im Tagebuch war das kleine Wort „Nie“ auf der letzten Seite. Jenes Wörtchen, das er zufällig entdeckt hatte, und wegen dessen er sich mit dem Kriminalkommissar nicht einig werden konnte. – Ja, aber, wenn dieses Wort bis dahin übersehen war, gab es nicht eine Möglichkeit, dass noch andere Dinge im Tagebuch übersehen waren? – „Kalten Kopf, Sanders!“ sprach der Rechtsanwalt zu sich selbst. Nein, diese Möglichkeit gab es nicht. Die Sache mit dem Wörtchen auf der letzten Seite war eben nur ein Zufall gewesen, und solcher Zufälle gibt es kaum mehrere. Sanders war auf dem Nachhauseweg, als ihm diese Gedanken durch den Kopf schossen. Trotzdem er einsah, dass es uberflüssig und zwecklos wäre, in dieser Richtung noch irgendwelche Versuche zu machen, beschloß er doch, das Tagebuch noch einmal zu prüfen.
Es war am Spätnachmittag, als er seine Wohnung betrat. Der Sommer begann schon sacht in leuchtend klare Herbstabende überzugehen, bei denen auf einem mattblau strahlenden Abendhimmel blaßgrünliche Lichter spielen und die Wolken rosa aufglühen. Es war noch nicht ganz dunkel im Zimmer, als der Rechtsanwalt die Aktenmappe hervorsuchte, in der sich das Tagebuch noch immer befand. Seine erste Begierde war, jenes Wort auf der letzten Seite wiederzusehen, an das er sich klammerte, und das ihm trotz der seltsam traurigen Bedeutung „Nie“ doch mit Hoffnungen für die Lösung aller Rätsel erfüllte. Er holte das Tagebuch heraus, ging ans Fenster und blätterte hastig die Seiten um. Auf der letzten Deckelseite machte sein Blick auf der wohlbekannten Stelle halt. Aber es war kaum mehr etwas zu unterscheiden in der Dämmerung. Er mußte die Lampe anzünden. Dennoch fühlte er, wie seine Hand zitterte. Er hatte das Wort nicht gleich gefunden.
Die Lampe blakte trüb auf, und Sanders schob hastig die Seite in den Schein des angezündeten Lichtes. Doch was war das? Sollten seine Augen von den Aufregungen der letzten Zeit zu angestrengt sein? Sollte er nervös sein? Er konnte auf der Seite nichts sehen. Er drehte die Lampe hell auf, strich sich mit der Hand über die Augen und richtete dann seine Blicke mit erzwungener Ruhe auf das Papier. Doch mit wildem Herzklopfen sprang er auf – war er etwa schon wahnsinnig? Denn was er sah, war nichts als eine Seite leeren, vergilbten Papiers. Die Stelle am Rand mit dem Wort „Nie“, das er so genau im Gedächtnis hatte, war leer, vollständig leer. Das Wort fehlte! Während Sanders mit heftigster Bestürzung auf das leere Blatt starrte, klopfte es plötzlich an die Tür. Ins Zimmer herein trat Erich Soltau. Trotz der wilden Erregung, in der sich Sanders befand, sah er doch sofort, dass mit dem Fremde irgendetwas nicht in Ordnung war. Gewisse Unordnungen in der eleganten Toilette Soltaus machten Sanders darauf aufmerksam, dass etwas geschehen sei. Er sah in das Gesicht des Freundes: es war erhitzt und offenbar ein wenig verstört.
Sanders war als Rechtsanwalt gewohnt, seine eigenen Angelegenheiten immer vor denen seiner Besucher in den Hintergrund zu stellen. Und diese Angewohnheit, die sich auch auf sein ganzes Privatleben erstreckt hatte, ließ ihn jetzt sofort seine Erregung über die unbegreifliche Entdeckung im Tagebuche zurückdrängen und veranlaßte ihn zu der Frage: „ Was hast du? Was ist mit dir geschehen?“ Soltau ließ sich in einen Stuhl fallen. Unwillkürlich erinnerte sich Sanders an jenen Tag, wo Soltau auf derselben Stelle saß, apathisch, gebrochen, hoffnungslos. Aber heute war er erregt, suchte offenbar nach Ausdrücken und hielt sein Temperament gewaltsam zurück. „Höre,“ sagte Soltau, „mir ist etwas passiert von dem ich nicht weiß, ob es sehr schlimm oder sehr gut ist.“ Sanders holte eine Flasche Wein und zwei Gläser, schob die Lampe auf dem Tisch zurecht, um Soltaus Gesicht besser sehen zu können, und lehnte sich in seinen Stuhl zurück, als gäbe es auf der Welt für ihn weiter nichts Interessanteres als Soltaus Erlebnis. „Womit hängt das zusammen, was du erlebt hast?“ fragte er.
„Mit Brandorff!“ antwortete Soltau. Jeder Zug in Sanders’ Gesicht spannte sich. Soltau goß ein halbes Glas Wein herunter und erzählte: „Ich schlenderte heute nachmittag die Friedrichstraße langsam zum Oranienburger Tor hinauf. Meine Angelegenheiten hatte ich erledigt, und ein wenig die letzten warmen und sonnigen Stunden zu genießen, die wir wohl in diesem Jahr haben werden, beschloß ich, nach Tegel zu fahren. Dass mir gerade dieser entfernte Vorort einfiel, lag wohl zumeist daran, dass nach den Angaben der Leute, die auf so geheimnisvolle Weise dazu gemietet worden waren, den alten Brandorff kurz vor seinem Tode in sein Haus zurückzubringen, dieser in der Richtung von Tegel her zu dem Treffpunkt in der Müllerstraße transportiert wurde. – Kurz und gut, jene Gegend interessierte mich; ich wollte sie mit meinen eigenen Augen erforschen, und rasch entschlossen sprang ich auf einen eben vorüberfahrenden Straßenbahnwagen, der an seiner Stirnseite die Aufschrift „Tegel“ trug.
Während der ganzen Fahrt beschäftigte sich mein Denken unausgesetzt mit jenem tragischen Erlebnis, nach dessen Lösung wir immer noch vergeblich suchen. Auf dem Vorderperron des Wagens stehend, musterte ich die Straßen, durch die wir fuhren, mit der schärfsten Aufmerksamkeit. Schon zeigten sich zur Linken die Bäume eines spärlichen Wäldchens, und in der Ferne tauchten bereits die ersten Häuser von Tegel auf, als ich plötzlich vor mir auf dem Wege eine kleine, eckige Gestalt bemerkte, in der ich sofort Brandorffs ehemaligen Diener John erkannte. Du kennst meine Verachtung und den Haß, den ich gegen diesen Menschen hege. Warum wollte er nur damals gerade mich mit seinen versteckten und später deutlich wiederholten Andeutungen als Mörder Brandorffs gelten lassen? Es ist mir unbegreiflich, wenn ich nicht glauben sollte, er habe sich auf niederträchtige Weise für ein böses Wort, das ich ihm einmal zufällig gesagt haben mag, rächen wollen! Als ich ihn nun so vor mir auf der Straße sah, konnte ich mich nicht halten. Ich sprang von dem Wagen, um ihn zu stellen und zur Rechenschaft zu ziehen. Aber kaum war ich ihm nahe, als er, ohne sich umgedreht zu haben, anfing, schneller zu gehen. Auch ich beschleunigte sofort meinen Schritt, aber nun begann er mit seinen fixen Jockeisprüngen sich in Trab zu setzen.
Dieses hartnäckige Mir-aus-dem-Wege-Gehen kam mir höchst sonderbar vor, und ich wendete meine ganze Kraft an seine Verfolgung. Immerhin hatte er schon einen bedeutenden Vorsprung gewonnen und stand gerade vor dem großen Tegeler-Park. Ich wußte, dass der Park jetzt geschlossen war, und freute mich schon, den Halunken endlich am Kragen packen zu können, als ich plötzlich sah, dass der Kerl die Stäbe des großen eisernen Tores erfaßte und wie ein Wiesel daran hinaufkletterte. Als ich atemlos ankam, war er längst drüben und rannte in den Wald. Ich schrie dem Wächter des Tores etwas zu, er zögerte zu öffnen, aber kurz entschlossen lief ich ein Stück am Gitter entlang und kletterte trotz der lauten Protestrufe des Wächters gleichfalls hinüber. Vor mir tat sich im leuchtenden Nachmittagslicht der ziemlich dichte Tegler Laubwald auf, und unter seinen Schatten versuchte der Fliehende zu verschwinden. Aber ich war ihm auf den Fersen, und so oft er versuchte, über einen Hügel hinter den dicken Baumstämmen zu entkommen, so oft setzte ich ihm mit einer Ausdauer nach, die jetzt schon etwas von verbissener Wut an sich hatte. Schließlich kamen wir bei dieser Hetze zu dem Gitter, dass den Park von der andern Seite begrenzt.
Wieder packte John zu und schwang sich hinüber. Bei unserer Jagd hatte uns schon das ungewisse Dämmern des sinkenden Tages überrascht. Ich sah ihn wie einen Schatten über das Gitter huschen. Ich hinterher, kletterte ihm nach, und als ich mich jenseits des Gitters umsah, befand ich mich in einer Straße, die zu einigen baufälligen kleinen Häusern führte. Weit hinter den Häusern sah ich einen rötlich glitzernden Schein in die Luft strahlen, es war wohl der See, in dem sich die Abendsonne spiegelte. Plötzlich, während ich noch den Fliehenden suchte, erhielt ich einen heftigen Stoß gegen die Brust, der mich umwarf. Der Schmerz raubte mir fast die Besinnung, ich konnte nur noch so viel erkennen, dass die dunkle Gestalt des Dieners, der mir so heimtückisch aufgelauert hatte, eilends wie im Fluge die Straße entlagglitt. Ich versuchte mich aufzuraffen, es gelang. Mit den letzten Kräften nahm ich die Verfolgung auf, aber plötzlich war der dunkle Schatten verschwunden, als habe ihn die Erde verschlungen.
Ich eilte zur Stelle, wo ich John zuletzt zu sehen glaubte und befand mich vor einem kleinen, verfallenen Hause, das mit einer grauen Mauer umgeben war. Das starke, hölzerne Tor war fest verschlossen. Vor den Fenstern lagen dichtverstaubte, grüne Fensterläden. Ich klopfte an, niemand kam zu öffnen. Ich schlug an die Fensterläden, doch nichts rührte sich. Ich mußte eine kleine Strecke zurückgehen, bis ich zum nächsten Hause kam. Durch das Fenster des Erdgeschosses sah ich Leute im Zimmer. Ich entschuldigte mich wegen der Störung und fragte, wer das kleine, einsame Haus eigentlich bewohne. Aber die Leute sahen mich verwundert an und sagten: „Da wohnt schon seit Jahren niemand. Wem das Haus gehört, wissen wir nicht. Der Besitzer läßt sich nie blicken, und das Haus steht leer. Die Kinder gehen nicht in seine Nähe, denn man sagt, es spukt dort.“"
Sanders hatte schweigend zugehört. Doch kaum hatte Soltau geschlossen, so sprang er auf und rief: „Wir müssen hin! – Führe mich!“ In eiliger Fahrt begaben sich die beiden im Automobil auf dem Weg. Sanders war fest überzeugt, dass Soltau eine wichtige Fährte im Falle Brandorff entdeckt habe. Die Erzählung von der hastigen Flucht des Dieners John gab ihm die Idee, dass John etwas, wenn nicht alles von den Schuldigen, den Mördern Brandorffs, wußte, und Sanders wollte keine Zeit verlieren, um ihre Spur zu verfolgen. Es war fast schon ganz dunkel, als sie in Tegel ankamen. Auf der Seite des Ortes, die dem See abgewandt lag, wo die ärmlichen Häuschen zusammenstanden, waren die Straßen nur spärlich beleuchtet. Die breiten Laubdächer der großen Bäume verbreiteten hie und da dichtes Dunkel und raubten oft noch den letzten Blick zu den Lichtern des Nachthimmels. Endlich standen sie vor dem Hause, das Soltau als dasjenige bezeichnete, in dem John so spurlos verschwunden war. Es war stockfinster davor, nur von ferne leuchtete das trübe Licht einer Straßenlaterne herüber.
„Ich hätte nie geglaubt,“ sprach Soltau, „dass in der Nähe von Berlin solche Verlassenheit möglich ist. Wenn dies der Wohnsitz der Schurken ist, so haben sie ihn trefflich gewählt. Man versteht wohl, dass sich das Gerücht verbreiten konnte, das da sei ein Spukhaus!“ Plötzlich in der Finsternis besannen sich die Männer, dass sie ja in der Eile ohne jede Waffe fortgefahren waren. Aber nun half es nichts, man mußte sein Glück versuchen. Doch soviel sie auch ans Tor und an die Fensterläden klopften und hämmerten, nichts regte sich. Alles war erfolglos.
Wie sie gerade das Vergebliche ihres Bemühens einsahen und unschlüssig sich zum Gehen wenden wollten, hörten sie plötzlich hinter sich in der Dunkelheit der Bäume leise hüsteln. Sie fuhren zusammen, Soltau machte einen Schritt in die Dunkelheit hinein und rief: „Wer ist da?“ Eine Gestalt kam aus dem schwarzen Schatten hervor, und in dem von drüben kommenden Laternenlicht erkannten die beiden einen alten, zerlumpten Mann, der lahm ging und sich auf eine Krücke stützte.
„Eine milde Gabe, liebe Herren, für ein Nachtlager!“ krächzte seine heisere Stimme. Ach so, es war ein Bettler. Soltau warf ihm ein Geldstück in den Hut und fragte dabei: „Hören Sie mal, Mann, kennen Sie das Haus hier?“ „Ja, ich kenn’s wohl,“ krächzte die dünne Stimme des Bettlers in die Nacht. „Schönen Dank auch für die Gabe, meine Herren, schönen Dank. Aber wenn Sie hier was suchen, da kommen Sie zu spät. Es ist niemand drin, niemand drin, meine Herren! Da kommen Sie zu spät, da kommen Sie zu spät!“ Und seine blecherne Stimme verlor sich in der Nacht. „Da kommen Sie zu spät!“ Mehr war aus ihm nicht herauszubringen. Offenbar war er schon altersschwach und dumm. Kopfschüttelnd humpelte er weg, immer die Worte murmelnd: „Da kommen Sie zu spät!“
Als er verschwunden war, fragte Soltau Sanders ganz ratlos: „Was ist jetzt zu tun? So, wie wir hier stehen, werden wir nie hinter das Geheimnis des Hauses kommen!“ Aber Sanders packte ihn am Arm und sagte: „Und wir werden doch dahinterkommen! – Ich habe eine Idee. – Die einzige Möglichkeit, Klarheit zu schaffen, ist mit Hilfe des Kriminalkommissars Redberg! Wir müssen zu Redberg!“ Man muss sagen, dass sie ein wenig erleichtert aufatmeten, als sie aus den düsteren Schatten des einsamen Hauses wieder ins Licht kamen. Aber auf der fast endlosen Fahrt zur Stadt kühlte die frische Abendluft ihre erhitzten Schläfen, und als sie in Berlin endlich vor der Wohnung des Kriminalkommissars ankamen, hatten beide Männer wieder das ruhige Auftreten erlangt, wie sie es im gewöhnlichen Leben zu zeigen pflegten.
„Es ist natürlich sehr leicht möglich,“ sagte Sanders, „dass wir jetzt den Kriminalkommissar nicht zu Hause treffen, aber wir wollen auf jeden Fall unser Glück versuchen!“ Als sie an der Türklingel schellten, machte ihnen eine ältere Dame auf. Es war die Haushälterin Redbergs. Sie bat die beiden Herren einzutreten. „Der Herr Kriminalkommissar ist augenblicklich nicht zu Hause,“ sagte sie. „Aber wenn die Herren Soltau und Sanders heißen, so läßt der Herr Kommissar bitten, in der Wohnung von Herrn Sanders auf ihn zu warten!“ „Ja, so sind unsere Namen!“ erwiderte Sanders mit tiefem Erstaunen. Wie hatte Redberg wissen können, dass er und Soltau zusammen ihn heute abend aussuchen würden! Aus der Haushälterin war nichts herauszubringen, ihre ganze Antwort beschränkte sich darauf: „Der Kriminalkommissar hat gesagt“ – und dann ging sie wieder von vorne an.
Die beiden fuhren also in die Wohnung des Rechtsanwalts, und während sie sich noch den Kopf zerbrachen über die rätselhafte Kenntnis Redbergs, klingelte es plötzlich, und Redberg selbst trat ein. „Ah, guten Abend, meine Herren!“ rief er vergnügt aus. „Da sind Sie ja endlich. Nun, was sagen Sie zu Tegel im Finstern?“ In sprachlosem Erstaunen blickten ihn die beiden Besucher an.
„Ja, Herr Soltau,“ fuhr Redberg lachend fort, „es ist unangenehm, von einem englischen Preisboxer niedergeboxt zu werden! Haben Sie sich schon erholt?“ Mit starrer Verwunderung sah Erich Soltau den Kommissar an. Woher wußte dieser von seinem Renkontre mit dem Diener John? Es war doch beinahe, als wenn dieser Mann mit übernatürlichen Kräften im Bunde stände. Aber Redberg gab sich mit diesen Erfolgen noch nicht zufrieden. „Wissen Sie, meine Herren,“ sprach er, „ich finde es höchst unklug von Ihnen, ja beinahe unverzeihlich, dass Sie in das kleine Haus eindringen wollten, so eilig und unvorbereitet, wie Sie gekommen waren! Wie können erwachsene Männer solche Torheiten begehen!“ „Aber woher können Sie nur das alles wissen?“ rief jetzt Sanders aufspringend aus. Doch Redberg wich aus; „Meine Herren, Sie kamen zu spät!“
Und plötzlich duckte er sich nieder, sein Gesicht legte sich in uralte Falten, und eine rauhe Stimme, die sie sofort wiedererkannten, krächzte: „Ja, da kamen Sie zu spät, da kamen Sie zu spät!“ Es war die Stimme des alten Bettlers, der sie im Schatten der mächtigen Bäume so erschreckt hatte. Nun ward ihnen alles klar: der Bettler war Redberg selbst gewesen, es war eine der Verkleidungen, in denen er unerkannt seinen Forschungen nachging. Dem Rechtsanwalt Sanders imponierte dieser Mann, der bei allen wichtigen Momenten, wo nur die geringste Aussicht auf Erfolg und Klärung des Dunkels war, unbemerkt selbst seine Beobachtungen anstellte, während er vor der Welt die Maske des eleganten Durchschnittsbeamten wahrte. Wenn der Kommissar trotzdem bis jetzt noch keinen Erfolg gehabt hatte, so lag das eben an der ganzen Kompliziertheit des Falles, an der Unnahbarkeit dieser stets entschlüpfenden, unheimlichen Gesellen, die die Urheber des Verbrechens waren und deren Dasein man von Zeit zu Zeit mit bedrückender Gewalt fühlte.
Sanders wußte, mit einem Manne wie Redberg konnte man nicht anders als klar und ehrlich sprechen. Er wandte sich zu dem Kommissar: „Seien wir endlich einmal offen zueinander, lieber Herr von Redberg!“ rief er. „Ich sehe, dass Sie einen bestimmten Verdacht haben. Irre ich mich, wenn ich annehme, dass er Ihnen an dem Tage von Brandorffs Begräbnis zum ersten Male kam?“
Redberg erwiderte ruhig: „Das stimmt doch nicht ganz, Herr Rechtsanwalt. Seitdem seinerzeit durch die Bekundungen der Leute, die den sterbenden Brandorff in seine Wohnung zurückbrachten, die Spur der Verbrecher nach Tegel wies, dehnte ich meine Streifereien häufig nach jenem Ort aus. Und da sah ich einige Male den einstigen Brandorffichen Diener John Barker in jenem verfallenen Hause verschwinden, vor dem ich Sie heute abend traf. Und einmal folgte ihm auf dem Fuße ein gut gekleideter Herr, der nämliche, bei dessen Anblick Fräulein Brandorff am Kirchhoftore in Ohnmacht fiel. Diese sonderbaren Umstände erweckten damals meinen lebhaftesten Argwohn und meine Nachforschungen haben ihn inzwischen nur verstärkt.“ Sanders dachte einen Moment nach und fragte dann: „Aber wenn Sie Verdacht haben, warum haben Sie noch keine Verhaftung vorgenommen?“ Aber Redberg mußte ihm antworten: „Ich konnte das nicht. Mein Verdacht ist lediglich privater Natur. Ich beobachte nur. Der Beweis dafür, dass der Betreffende jemals mit Brandorff in irgendeiner Verbindung stand, wäre erst zu erbringen.“ Dies war ein Argument, gegen das man nichts sagen konnte. Doch Redberg unterbrach plötzlich seinen Gedankengang, sah Sanders heiter an und fragte:
„Übrigens, Herr Rechtsanwalt, weil wir gerade auf den Tag von Brandorffs Begräbnis gekommen sind, erirrern Sie sich noch unserer Wette?“ „Welcher Wette?“ fragte Sanders erstaunt. „Sehen Sie,“ rief Redberg schmunzelnd, „ich dachte mir, dass Sie es vergessen würden! Nun, unsere Wette auf dem Kirchhof, wegen des Tagebuches. Sie behaupteten, etwas Neues gefunden zu haben, ich erlaubte mir diese Möglichkeit zu bestreiten. Was ist nun damit?“ Sanders Gesicht verdüsterte sich. „Ich wage kaum davon zu sprechen,“ antwortete er leise, „weil es mir fast vorkommt, als müßte ich an meinem Verstand zweifeln. Was ich Ihnen damals sagte, hat sich in der Tat als unrichtig herausgestellt. Das neue Wort, das ich damals zu finden glaubte, existiert nicht!“ „So, so,“ sagte Redberg, „es existiert nicht – aber wie kamen Sie nur damals darauf, seine Existenz so fest zu behaupten?“
Sanders antwortete mit trauriger Stimme: „Bitte, halten Sie mich ruhig für verrückt. Als ich das Tagebuch seinerzeit aus meiner Brusttasche zog und durchblätterte, habe ich auf der letzten Seite mit meinen leiblichen Augen das Wort zu erblicken geglaubt. Heute, bevor Soltau kam, sah ich das Tagebuch wieder an und merkte, dass Sie recht hatten: das Wort ist nicht vorhanden! – Vielleicht muss ich meine damalige Wahrnehmung der starken Erregung und Nervosität zuschreiben, in die mich die Ereignisse im Hause Brandorff versetzt hatten. Aber ich kann Ihnen sagen, bisher waren selbst in meinen erregtesten Augenblicken meine Beobachtungen klar geblieben!“ „Bitte, holen Sie doch das Tagebuch her!“ war Redbergs Antwort.
Sanders brachte das kleine braune Buch herbei. Erich Soltau saß mit abwesender Miene in seinem Fauteuil dicht bei dem Tische. Er hörte offenbar gar nicht recht auf das Gespräch der beiden. Er starrte in die Flamme der Stehlampe, die dicht vor ihm an der Ecke des Tisches stand, und drehte mißmutig an den Quasten der Tischdecke. Vielleicht war er im Geiste noch bei der mißglückten Verfolgung Johns, und verärgert darüber, dass ihm jener Bursche doch entschlüpft war. Gedankenverloren beobachtete er das langsame Abbrennen des Dochtes. Redberg nahm das Tagebuch, breitete die einzelnen Blätter aus und untersuchte sie sorgfältig. Dann schüttelte er den Kopf. „Nein, lieber Herr Rectsanwalt, ich glaube, Sie haben sich damals wirklich geirrt – da ist aber auch gar nichts anderes zu sehen, als was ich schon am ersten Tage sah!“ Er legte die Blätter wieder in den Deckel hinein, klappte ihn zu und legte das Buch auf den Tisch. „Und nun, meine Herren,“ sagte er, „heißt es nachdenken und sich gemeinsam besinnen, was wir an Beobachtungen und Verdachtsgründen gegen Mohl vorbringen können!“
„Gegen Mohl?“ Soltau fuhr in seinem Fauteuil zusammen. Sein Gesicht war bleich. „Was für ein Verdacht bezieht sich auf Herrn von Mohl?“ fragte er mit zitternder Stimme. Redberg erwiderte langsam, laut jedes Wort betonend: „Der Fall Brandorff!“ „Mein Gott!“ schrie Soltau und sprang wild auf. „Erich, die Lampe!“ rief Sanders. Aber schon war es zu spät. Krachend klirrte etwas zusammen, und plötzlich war es hell und qualmig im Zimmer, und aus drei Kehlen erscholl der Ruf: „Feuer!“ Über den Tisch hin wogte es von rotzüngelnden Flammen.
In die Angst hinein rief Redberg plötzlich: „Den Teppich hoch!“ Die andern verstanden ihn. Sie packten, halb erstickt, zu und schleuderten den Teppich auf das Feuer. Sanders eilte ans Fenster und stieß es auf. Das Feuer war erstickt, und der Qualm zog langsam ab. Soltau drehte die grelle Glühlampe auf, die zur Nachtbeleuchtung diente. Es zeigte sich, dass der Schaden gar nicht so schlimm war. Im ersten Moment hatte das alles viel gefährlicher ausgesehen. Man nahm den Teppich vorsichtig herab. „Das Teppich ist angekohlt!“ rief Redberg. Sanders, im Verantwortlichkeitsgefühl, griff zuerst nach dem braunen, jetzt hie un da schwärzlich aussehenden Buch. Er wollte das Schloß einknipsen und es weglegen, als er es mechanisch noch einmal durchblätterte. Plötzlich schrie er heiser auf:
„Die Schrift – o hier, hier! Da ist noch etwas geschrieben!“ Redberg sah schnell über seine Schulter und sagte ruhig: „Sympathetische Tinte!“ Sanders schlug sich vor den Kopf: „O ich Esel, ich Esel! Dass ich es nicht damals merkte! Die Schrift wird sichtbar, wenn das Papier erwärmt wird! Damals, als ich in meiner Brusttasche die letzte Seite meiner Körpertemperatur anwärmte. Hier, sehen Sie – hier unten, da steht das Wort: „Nie!“ Und er begann im Zimmer herumzutanzen: „Sehen Sie – ich hatte recht, da steht das Wort!“ Und mitten unter den dampfenden, verkohlten Trümmern lasen die drei Männer die folgenden Seiten.
XVI. Enthüllungen.
Sanders hielt das schon etwas angekohlte Buch in der Hand. „Sie erinnern sich doch noch der vorhergehenden Blätter, nicht wahr? Jener geheimnisvollen Fahrt Brandorffs von Paris nach dem Goldenen Horn, deren Beschreibung plötzlich bei dem Liebesabenteuer von Brandorffs ungenanntem Gefährten abbricht. Nun lese ich hier auf den folgenden Seiten, deren Schrift durch die Wärme plötzlich sichtbar geworden ist:
„Stambul“
Die Sache wird durch das Abenteuer mit Madame Signotani so verwickelt, dass ich nicht mehr wage, alles niederzuschreiben, was ich erlebe. Und doch scheint mir die ganze Reise so denkwürdig zu sein, dass ich den Drang in mir fühle, das Wesentliche festzuhalten. Sollte ich einst einen Erben haben, so ist meine Absicht, meinem Kinde vor meinem Tode das Geheimnis der sympathetischen Tinte zu enthüllen, damit es weiß, mit wie vielen Anstrengungen und Wagnissen sein Vater zu dem Gelde gekommen ist, von dem es lebt.
Mein kleines Bankgeschäft in Deutschland war durch Spekulationen ruiniert. Es war ein ehrlicher Bankrott, und als ich den letzten Gläubiger abgefunden hatte, war ich mittellos. Es gelang mir, in einem Bankhause in Paris eine Stellung zu bekommen, und ich nahm sie an, weil mich Paris lockte. Ich war bereits zwei Jahre in dem Hause und arbeitete im Vorzimmer des Chefs als Korrespondent, da kam eines Tages, kurz vor Schluß der Arbeit, ein Herr, dem man trotz seiner Pariser Eleganz sofort den Orientalen ansah. Er hatte im Privatzimmer des Chefs eine lange Unterredung. Dann öffnete sich die Tür, und ich hörte meinen Chef sagen: „Nein, ich bedaure es unendlich, aber ich kann es nicht machen. Es könnten Komplikationen entstehen, denen ich nicht gewachsen bin!“ Darauf sagte der andere: „Aber ich versichere Ihnen, das alles ist ganz gefahrlos. Wir brauchen nur einen zuverlässigen Mann, der arbeitsam ist und die Augen offen behält.“ Aber mein Chef antwortete: „Es geht wirklich nicht, meine Mittel sind nicht groß genug.“
Das ganze Äußere des Besuchers und die paar aufgeschnappten Worte hatten mich erregt. Er brauchte einen zuverlässigen, arbeitsamen Mann? Ich dachte gar nicht daran, dass er einen Geldmann meinen konnte. Ich dachte nur das eine: „Solch ein Mann war doch ich!“ Der Besucher konnte unser Haus noch kaum verlassen haben. Meine Arbeit war beendet. Ich ergriff meinen Hut und eilte ihm nach. Wenige Schritte vor mir sah ich den Herrn. Ich ging hinter ihm her und folgte ihm durch die Straßen. So waren wir in einer kleinen, engen Gasse auf dem linken Ufer der Seine angekommen, in einem dunklen, von verworfenem Gesindel bewohnten Viertel. Plötzlich drehte der Verfolgte sich um, sah mich scharf an und kam auf mich zu. Ich blieb stehen mit klopfendem Herzen. Dicht vor mir sagte er mit leiser, scharfer Stimme: „Warum gehen Sie mir nach? – Was wollen Sie? Machen Sie es kurz!“
Ich sagte: „Ich bin Korrespondent des Bankhauses, in dem Sie eben waren. Ich hörte, dass Sie einen zuverlässigen Mann brauchen. Ich bin es!“ Er lachte kurz: „Ich brauche einen Bankier!“ „Ich war früher Bankier!“ erwiderte ich. „So, so!“ nickte er, indem er mich scharf betrachtete. „Nun erzählen Sie mir von sich, vielleicht entscheidet sich etwas zu Ihren Gunsten!“ Ich ging neben ihm her und teilte ihm mein Schicksal mit. Er hörte schweigend zu. Als ich zu Ende war, sagte er: „Gut, ich glaube Ihnen. Vielleicht kann ich Sie gebrauchen, folgen Sie mir!“
Seine Wohnung lag in einem kleinen, unscheinbaren Hause, und man mußte zu ihr eine knarrende Wendeltreppe emporsteigen. Er schloß auf, und ich trat in einem dunklen Gang. Dann stieß er die Tür auf. Ich fuhr erschrocken zurück, geblendet von dem Glanz vieler Lichter, die ein mit den kostbaren orientalischen Teppichen ausgeschlagenes Gemach, dessen Vorhandensein in einem Pariser Miethause ich nicht vermutet habe, strahlend erhellten. Der Bewohner dieses kostbaren Raumes brachte Erfrischungen nach orientalischer Sitte herbei, und nun vernahm ich jene Worte, deren Inhalt mein genzes Leben ändern sollte. Ich erfuhr, dass Abdul Assud, so hieß mein Wirt, ein Abgesandter der Partei der Jungtürken war. Damals war die Partei im Aufblühen. Doch brauchte sie, um ein moralisches Übergewicht zu bekommen, zweierlei: Geld und die Sympathie einer europäischen Großmacht.
„Glauben Sie, dass Sie uns nützlich sein können?“ fragte mich Abdul Assud. „Ja, ich glaube es!“ antwortete ich nach kurzem Besinnen. Mir fiel plötzlich ein, dass es für mich seltsamerweise eher möglich war, für die Partei die Verbindung mit einer Gesandtschaft herzustellen, als mit einem Bankhause. Ich kannte nämlich einen jungen Attaché, den ich in Paris wiedergetroffen hatte. Er war stets in Geldverlegenheiten, die mehrmals durch meine Vermittelung behoben wurden, und wir waren recht intim miteinander geworden. An ihn beschloß ich mich zu wenden, vielleicht war es möglich, etwas zu erreichen, natürlich ohne dass die türkische Botschaft in Paris davon Wind bekam. Ich suchte also den Attaché auf. Er befand sich wieder in ärgster Geldverlegenheit, und, Hilfe witternd, ging er nach einigem Zögern auf alles ein. Damit mein Kind auch von diesen Einzelheiten weiß, will ich hier endlich den Namen dessen nennen, den ich vorne nur angedeutet habe: Mein Gefährte heißt Anton von Mohl.“
Ein heftiger Schlag auf den Tisch unterbrach den Lesenden. Soltau war es, der rief: „Lies es noch einmal, Sanders, noch einmal! Mein Gott, wer hätte das geahnt, dass der Name Mohl hier auftauchen würde!“ Doch Redberg unterbrach ihn und sagte mit ruhiger Stimme: „Anton von Mohl war der Vater Ihres Bekannten Hugo von Mohl. Ich habe nach der Familie geforscht. Aber ich wußte nicht, dass sich Anton von Mohl je an der jungtürkischen Geheimbewegung beteiligt hat!“ Und nun berichtete Sanders dem Kommissar, was ihnen Nured-Bei von der Partei der Jungtürken mitgeteilt hatte.
Soltau ging aufs höchste erregt im Zimmer auf und ab: „Mohl war ja die Ursache meines Schweigens vor dem Untersuchungsrichter!“ rief er lebhaft. „Damals in der Nacht gestand ich Brandorff, dass ich Spielschulden an Mohl hatte. Kaum hatte ich das gesagt, als mein Oheim mich in der heftigsten Weise beschimpfte, mich einen Betrüger nannte und mir vorwarf, ich bewürbe mich um seine Tochter nur aus Berechnung. Die Schulden habe ich, da meine Geldkalamität nur eine vorübergehende war, unterdes längst bezahlt. Aber damals konnte ich natürlich weder von ihnen als Ursache noch vom beleidigenden Inhalt der Worte meines Onkels sprechen. Es wäre zu kompromittierend gewesen!“ „Und doch wußte ich von deinen Schulden!“ sagte Sanders.
„Woher?“ „Von Mohl selbst!“ Sanders hielt das Buch noch in der Hand. Er sah, wie Soltau nach Worten rang, wie tausend Entschlüsse in ihm kämpften, tausend Gedanken laut werden wollten. Doch um jede Voreiligkeit bei Soltau zu verhüten, sprach er mit fester Stimme: „Ich begreife deine Erregung vollkommen, Erich. Aber ich bitte dich, beruhige dich jetzt. Wir müssen erst das Ganze hören, ehe wir die Fäden der Begebnisse im einzelnen überblicken können. Und eher dürfen wir nicht handeln. Ich lese also jetzt weiter!“ Und Sanders fuhr in der Lektüre des Tagebuchs fort: „Das geheime Oberhaupt der Jungtürken ist Mustapha Fasil-Pascha.“ Sanders und Soltau tauschten einen Blick des Einverständnisses aus, denn auch dieser Name war ihnen aus der Erzählung Nured-Beis ein bekannter. Sanders las weiter:
„Anton von Mohl verstand es durch seine Eigenschaft als Attaché, mehrere Geldleute unter Diskretion glauben zu machen, eine europäische Großmacht stände der Bewegung der Jungtürken nicht unfreundlich gegenüber. In Wahrheit durfte natürlich niemand auf der Gesandtschaft etwas davon erfahren, denn die Mächte hüteten sich wohl, in die verworrenen Verhältnisse der Türkei einzugreifen. So geschickt Anton von Mohl sich im Anknüpfen von Beziehungen erwies, so unzuverlässig ist er. Für ihn ist es dasselbe, ob er Politik mit Staaten oder mit Frauenherzen treibt. Das Abenteuer mit der Signotani, die in den Harem eines vornehmen Türken kam, hätte uns beinahe um den Zweck unserer ganzen Anstrengungen gebracht. Es war das Unglaublichste, was ich je erlebt habe.
Nachdem wir in Stambul diese und jene Mitglieder der Partei kennen gelernt hatten, merkten wir endlich, dass man uns absichtlich vom Oberhaupte fernhielt. Offenbar wollte man uns auf unsere Gesinnungen und Fähigkeiten prüfen. Wir drangen endlich darauf, das Oberhaupt kennen zu lernen, und Mohl, der in solchen Momenten sehr geschickt und energisch ist, drohte, wir würden die Türkei mit allen unsern Mitteln verlassen, falls dies nicht binnen drei Tagen geschehen würde. Das wirkte. Schon am folgenden Tage wurden wir zu Mustapha Fasil-Pascha geführt.
Mustapha Fasil-Pascha, ein schöner, kräftiger Mann mit mutblitzenden Augen, empfing uns mit der kostbarsten Bewirtung, die wohl je Europäer bei einem Türken genossen. Kaum hat auch wohl je ein Europäerauge die Pracht eines solchen Hauses wie das seine gesehen. Doch so prächtig das Haus Mustapha Fasils war, so einfach ginge er selbst einher. Ein weißes Gewand war sein Kleid, als verschmahte er absichtlich jeden Schmuck, den die Orientalen so sehr lieben. Nur eines fiel auf: ein weißer Ledergürtel, an dessen Schnalle zwei grünlich irisierende Opale von ungeheuerlicher Größe saßen. Mohl konnte nicht anders als ihn nach diesen Steinen fragen. Doch da wurde das Gesicht Mustapha Fasils sogleich tiefernst. Mit feierlicher Stimme sprach er: „Diese Steine sind der Schutz und der Hort unserer Partei. Einst trug sie der Sultan, den wir stürzen wollen. Indien ist ihre Heimat, und der Schweiß, das Geld und das Blut unzähliger Türken klebt an ihnen, mit denen der Herrscher seine Prachtliebe und seine Gefundheit erkaufte. Nun aber haben wir sie erlangt. Mit dem Besitz der Steine sind die Kraft und der Mut des Sultanhauses auf unsere Partei übergegangen. Doch seht“ – er winkte einem Sklaven, der ein Samtetui herbeibrachte –„ in Damaskus ließ ich nach geheimem Verfahren diese Steine nachmachen. Sie täuschen jeden, der die echten nicht kennt.“ Und er nahm aus dem Etui zwei Steine, die den beiden Riesenopale täuschend glichen. Jedem von uns machte er einen zum Geschenk, als geheimes Erkennungszeichen bei den hohen Führern der Partei. Mohl bat mich später, ihm den meinigen zu schenken, und da ich ohne seine Hilfe meinen Plan nie hätte ausführen können, so tat ich ihm den Gefallen.
An Bord. In den nächsten Wochen ging alles gut. Es gelang uns, ein großes Pariser Bankhaus zu bewegen, die Partei zu unterstützen. Das Haus errichtete ein Tochterhaus in Pera unter der Leitung eines französischen Bankiers. Mohl und ich waren durch unsere Bemühungen nunmehr vermögende Männer geworden. Der Tag unserer Abreise kam. Ich sah Mohl in der letzten Zeit selten, und das flößte mir Besorgnisse ein, denn ich fürchtete, dass er Dummheiten machte. Meine Furcht sollte sich am letzten Tage in Entsetzen verwandeln. Vor unserer Abreise wollte Mustapha Fasil-Pascha uns ein großes Fest geben. Am Morgen des Tages, an dem das Fest stattfinden sollte, kam Mohl plötzlich zu mir. „Hören Sie, Brandorff, ich habe Ihnen lange etwas verschwiegen. Unsere Abreise steht bevor, ich muss es Ihnen also sagen. Wissen Sie, in wessen Harem Madame Signotani ist?“ Mich durchzuckte ein tödlicher Schreck. Ich unterbrach ihn: „Doch nicht etwa“ - - „Ja, ja,“ nickte er, „sprechen Sie es ruhig aus: im Harem von Mustapha Fasil-Pascha!“ Um Gottes willen, Unglücksmensch!“ rief ich aus, „Sie verderben uns!“ „Nein, nein!“ rief er. „Seien Sie beruhigt, Ihnen wird nichts geschehen. Madame Signotani, die eigentlich Madame de Trémaine heißt und durch die verdammten Künste des alten Italieners hierhergebracht worden ist, wird uns noch heute abend aufs Schiff folgen!“
Ich war sprachlos – war Mohl ganz des Teufels? Wollte er durchaus eines grausamen Rachetodes sterben? Aber er blieb auf alle Einwendungen verstockt. „Nein, nein! Brandorff,“ rief er. „Sie werden mich nicht von meinem Vorhaben abwendig machen. Noch heute fliehe ich mit ihr, denn ich liebe dieses Weib.“ Was sollte ich machen? Ich konnte nichts anderes tun, als ihm bei der Flucht zu helfen. Und so teilte er mir mit, dass die Haremswächter bestochen seien. Am Abend, wenn Mustapha Fasil-Pascha das große Fest vorbereitete und im Hause die Verwirrung der Feststimmung herrschte, sollte Madame de Trémaine in Sklavenkleidung fliehen. Natürlich durften wir zur Stunde, wo man uns erwartete, nicht erscheinen, sondern mußten noch am selben Abend, also einen Tag früher, als eigentlich festgesetzt war, auf einem der gerade abfahrenden Europadampfer das Weite suchen.
In fieberhafter Erregung ging ich nachmittags an Bord der nach England bestimmten „Morney“, nachdem ich noch eine Stunde vorher einen Diener an Mustapha Fasil-Pascha mit dem Bescheide geschickt hatte, wir würden uns um 10 Uhr nachts einfinden. Schon um 9 Uhr sollte unser Schiff abgehen. Ich stand an Bord, die Ankerketten rasselten schon langsam hoch. Mein Gefährte war noch nicht da. Schon setzte sich das Schiff langsam in Bewegung, als ein mit zwei Menschen besetztes Boot hastig auf uns zukam. Es waren Mohl und die Geraubte. Er stieg mit ihr an Bord, kam auf mich zugelaufen, drückte mir ein Päckchen in die Hand und flüsterte:
„Verwahren Sie mir das, bis ich Sie darum bitte! Niemand darf es bei mir finden, falls man uns verfolgt!“ Und verschwand mit der Dame in der Kajüte, die er bestellt hatte. Ich drehte das Päckchen, das mir Mohl gegeben hatte, in der Hand hin und her und löste voller Spannung die Umhüllung. Meine Finger fühlten Kaltes, Glattes. Plötzlich durchzuckte mich ungeheures Entsetzen. In meiner Hand hielt ich die Opale vom Gürtel Mustafas. Sofort wußte ich: in seiner krankhaften Gier, alles zu begehren, worauf sein Auge wohlgefällig haften blieb, hatte Mohl seine Freundin veranlaßt, die Opale zu rauben.
London. Endlich bin ich auf dem Festland. Nichts von alledem geschah, was ich fürchtete. Niemand verfolgte uns. Mohl ist fort, verschwunden. Eines Morgens stellte sich heraus, dass er sich mit seiner Begleiterin in der Nacht aussetzen und von einem begegnenden Dampfer aufnehmen ließ. Er hinterließ mir nicht eine Silbe der Erklärung oder des Abschiedes. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Die Opale habe ich noch. Was soll ich mit ihnen beginnen? Die ganze Manier von Mohls Verschwinden entspricht ganz seinem sprunghaften, geheimnisliebenden Charakter. Ich erwarte Nachricht von ihm.
London. Drei Monate später. Von Mohl habe ich nichts mehr gehört. Seine Opale, die mir immer wieder von neuem unheimlich sind, bewahre ich immer noch. Die Türken regen sich nicht. Meine Geschäfte gehen gut. Es scheint, als bringe mir das Geld der Türken Glück. Ich schließe hier das Tagebuch. Dir, mein Kind, das Du diese Zeilen lesen wirst, schreibe ich zur Warnung vor allzu kühnen Plänen. Ich vergesse jene Tage der Demütigung, der Erregung, Qual, Verzweiflung und der endlichen Sicherheit nie!“
Das Buch war zu Ende. Es schloß mit jenem Wörtchen „nie“, das Sanders in so tiefe Verwirrung gesetzt hatte. In Gedanken versunken über den seltsamen Inhalt der Blätter, sprach keiner von den drei Männern ein Wort. Redberg faßte sich zuerst. „Hier gilt es zu handeln,“ sagte er. „Das Buch ist ein Zeuge dafür, dass zwischen den Familien Mohl und Brandorff eine bisher unbekannte Verbindung bestand. Wenn ich vorläufig in dieser Sache nichts tun kann, so möchte ich wenigstens versuchen, in die Geheimnisse des verschlossenen Hauses einzudringen. Folgen Sie mir, meine Herren!“
Die drei Männer brachen trotz der späten Stunde – es war mittlerweile neun Uhr geworden – auf, und wieder ging es zu jenem entfernten Vorort im Norden Berlins, in dem das verlassene, unheimliche Häuschen stand. Auf Redbergs Rat nahmen Sanders und Soltau ihre Revolver mit, und dann fuhren sie, um ihr Kommen in jener einsamen Gegend unauffälliger zu machen, diesmal mit der Straßenbahn anstatt mit dem Automobil. Keiner von ihnen aber sah, dass sich, als die drei Männer aus Sanders’ Haus traten, vom Schatten des gegenüberliegenden Hausflures eine dunkle Gestalt losmachte, die ihnen folgte.
Und wie sie nun durch die Straßen der Arbeiterviertel fuhren, wie die Bahn im Staub und Schmutz der spärlich beleuchteten Landstraße unter dem schwülen, gewitterschwangeren Nachthimmel Berlins einhersauste, da ahnte niemand von ihnen, wer die tiefverschleierte Frau war, die ihnen im zweiten Wagen folgte. Wie eine aufblitzende Perlenkette hinter einem dunklen Schleier glänzten drüben die Lichter der Stadt. Sie stiegen an der Endstation aus, und nun wanderten sie schweigend unter dem Schatten der mächtigen Bäume jenen wohlbekannten Weg, den jeder von ihnen erst wenige Stunden vorher zurückgelegt hatte.
Die Luft wurde immer drückender; ein Gewitter schien heraufzuziehen. Hie und das sickerte es sacht herunter: Die ersten Tropfen drangen durch das Laubdach. – Nun passierten sie das Haus mit der letzten Laterne, in dem man Soltau Auskunft gegeben hatte. Jetzt führte sie nur noch der immer schwächer werdende, trübe Laternenschein: Sie waren am Ziele. Der viereckige Bau regte schwarz empor, und die tiefen, dunklen Schatten ein paar Schritte weiter bezeugten, dass dort die Mauer anfing, die das Gebäude umschloß. Plötzlich durchzuckte ein heller Strahl das Dunkel: Redberg hatte seine Blendlaterne entzündet. Im Hause regte sich nichts; kein Geräusch, kein Laut war zu hören. Sie klopften an das Tor, an die Fensterläden, alles blieb still.
Redberg sagte leise: „So, nun aber keine Zeit verloren! Sanders, ich steige auf Ihre Schulter und klettere über die Mauer!“ Er schwang sich hinauf und saß in nächsten Augenblick rittlings auf der Mauer. Dann glitt er jenseits hinab. Einen Moment standen Sanders und Soltau in einem bangen Dunkel, denn mit Redberg war auch das Licht der Blendlaterne verschwunden. – Plötzlich klirrte es vor ihnen. Das kleine Holztor öffnete sich knarrend, und Redberg erschien schmunzelnd.
„Kommen Sie!“ winkte er leise. Der Hof lag still, hinten ragte ein großer Schuppen in die Nacht. Sie folgten Redberg, der mit Hilfe der Blendlaterne vom Hofe aus den Eingang ins Haus fand. Die Haustür war unverschlossen; sie stießen die knarrende Pforte auf und befanden sich in der Moderluft eines vernachlässigten Zimmers. Bisher hatten sie sich so leise wie möglich bewegt. Plötzlich klopfte es gegen die Fensterläden. Alle drei hielten einen Moment erschreckt den Atem an. Redberg blickte vorsichtig durch einen Spalt im Laden und flüsterte: „Eine Frau ist es!“ Sekundenlang herrschte Stille. Dann vernahm man von außen eine Stimme: „Machen Sie doch auf!“ – Ich muss hinein zu Ihnen!“
Soltau fuhr auf: „Das ist ja Cecilys Stimme! Sie ist hier! – Sie kann draußen nicht stehen bleiben!“ Er eilte hinaus und holte die verschleierte Cecily ins Zimmer. „Ich wollte den Rechtsanwalt trotz der vorgerückten Abendstunde in einer dringenden Angelegenheit aufsuchen,“ erklärte Cecily, zitternd vor Erregung. „Da sah ich Sie alle drei fortfahren und bin Ihnen gefolgt. Ich konnte nicht anders.“ Redberg holte eine Kerze hervor und machte Licht. Jetzt erst sahen sie sich in ihrer Umgebung genauer um. Auf einmal stieß Cecily einen Schrei aus: „O meine Ahnungen! Ich habe mich nicht getäuscht – dies ist dasselbe kleine Zimmer, das mir wie eine Vision erschien, als mein Vater begraben wurde. Und niemand sollte hier sein? Nein, das glaube ich nicht! Sicher, hier oder nirgends sind die Mörder meines Vaters verborgen.“
Und ohne auf die Worte der Männer zu hören, stürzte sie aus dem Zimmer hinaus auf den Hof. Redberg und Sanders waren noch unschlüssig, ob sie dem erregten jungen Mädchen sogleich folgen, oder sich zunächst an die Untersuchung des Hauses machen sollten. Plötzlich hörten sie vom Hofe her einen fürchterlichen Aufschrei! „Cecily!“ rief Soltau entsetzt, und die drei liefen hinaus. Im Schatten vor dem Schuppen sahen Sie eine sich hin und her wälzende dunkle Masse. Redberg ließ aus seiner Laterne einen Lichtstrahl darauf fallen, und im gleichen Augenblick stürzten auch die Männer auf die Kämpfenden und rissen sie auseinander. Hell klirrte es durch die Nacht, und eine Stimme brüllte: „O die Hunde – gefesselt!“ Das Licht fiel grell auf das Gesicht des Gefangenen, der sich, die Hände in den Handschellen, die ihm Redberg blitzschnell angelegt hatte, auf dem Rücken, wehrlos unter den festen Fäusten der drei Männer krümmte. Es war der Diener John!
Halb entseelt vor Erschöpfung, berichtete Cecily, wie auf dem Hofe, als sie den Schuppen untersuchen wollte, plötzlich aus der Dunkelheit ein Mann auf sie zugesprungen sei und mit dem Ruf: „Hier kommt niemand weiter!“ sie an der Kehle gepackt habe. Mit übermenschlicher Anstrengung hatte sie sich verteidigt. Doch nun lag John an Händen und Füßen gefesselt auf dem Bett drinnen im Zimmer. Redberg stand vor ihm. „Es nützt Ihnen nichts, wenn Sie schweigen!“ sagte er. „Wir wissen jetzt doch, dass es Mohl war!“ Wut und Hohn lag auf Johns wildem Gesicht, als er ewiderte: „Einmal mußt’ es so kommen. Ich merkte es wohl, dass ihr Verdacht hattet. Wir wären längst in Sicherheit, wenn der verwünschte Mensch, der Mohl, nicht wäre! Ja, ja, junges Fräulein, kucken Sie nur, auf diesem Bett, grad’ wie ich, hat auch, Gott verdamm’ mich, Ihr Vater gelegen!“
Ein Aufstöhnen Cecilys begleitete seine Worte. „Sprechen Sie,“ sagte Redberg, „wenn Sie alles gestehen, kommen Sie vielleicht vor Gericht besser weg!“ „Ich spreche schon,“ erwiderte der Gefesselte mit trotzigem Ton, „aber nicht, weil ihr Polizisten dann milder mit mir seid, sondern weil ich den Wahnsinn satt habe bis hier oben hin.“ Er machte, da ihm seine gefesselten Hände keine Freiheit dazu ließen, eine pantomimische Bewegung mit dem Kinn. „Ich war etwa schon ein halbes Jahr bei Brandorff im Dienst,“ begann er zu erzählen, „da trat eines Tages auf der Straße ein vornehmer Herr an mich heran und fragte mich auf englisch nach einer entfernten Gegend. Es war Herr von Mohl. Die Anrede in meiner Landessprache machte mir die Zunge locker; wir kamen ins Reden, ich erzählte ihm, dass ich früher Jockey war; er sagte darauf: „Ich verlege ohnehin meinen Wohnsitz nach England. Sie gefallen mir; wenn Sie im Stallwesen so tüchtig sind, wie Sie angeben, so könnte vielleicht aus einem Engagement etwas werden. Ich würde Ihnen mehr bezahlen als Ihr jetziger Herr!“ Mohl gab mir seine Adresse, und ich ging am anderen Tage, ohne Herrn Brandorff Mitteilung davon zu machen, zu ihm hin. Mohl verstand es, nach und nach mich den Zweck seines Kommens vergessen zu machen und mich zu bewegen, ihm von den Gewohnheiten, dem Hause und dem Besitz des alten Brandorff zu erzählen. Und als seine Schwester erschien.“ „Seine Schwester?“ unterbrachen ihn die Anwesenden verwundert.
„Ja, Frau von Zemlinska!“ erwiderte der Diener. „Das ist seine Schwester?“ fragte in tiefem Erstaunen Sanders, während Cecily bleich wurde. „Ja, sie ist seine Schwester aus der ersten Ehe, die sein Vater im Auslande mit einer Frau von Trémaine schloß!“
Die Männer tauschten Blicke des Erstaunens über diese seltsame Enthüllung, die sie jetzt erst aus dem Inhalt des Tagebuchs recht verstehen konnten. Der Diener fuhr milde fort: „Allmählich verstand es Mohl, mir beizubringen, dass das Engagement nach England gar nicht die Hauptsache bei der Anknüpfung unserer Bekanntschaft gewesen sei, sondern dass es in meiner Macht stände, ein reicher und bedeutender Mann zu werden. Er hatte ein paar Aufzeichnungen seines Vaters gefunden, aus denen er ersehen wollte, dass er dazu berufen wäre, eine ungeheure Rolle in der europäischen Politik zu spielen. Er behauptete, damit könne man die größten Verwicklungen unter den europäischen Großmächten anrichten.
Ich ließ mich von den großen Worten Mohls und seiner Schwester berauschen, und erst viel später, als schon alles geschehen war, merkte ich, dass es bei den beiden im Kopf nicht recht richtig sein mußte. Aber ich bin ein einfacher Mann, und damals rissen sie mich mit. Mohl brachte mich dazu, ihm in allem gefügig zu sein und ihm alles zu glauben. Zuerst, so sagte er mir, müsse er zwei indische Opale in seinen Besitz bringen, die mein Herr, der alte Brandorff, vor Jahren seinem Vater geraubt habe und in denen ein ganz eigener Zauber stecken sollte. Es zeigte sich dabei, dass Mohl schon seit langer Zeit mich beobachtet und den Plan gefaßt hatte, mich anzusprechen und seinen Wünschen gefügig zu machen. Ich wurde immer mehr sein Werkzeug, schließend ging ich blindlings auf seinen Plan ein, Brandorff die Opale zu rauben.
Mohl verabredete mit mir, dass eines Nachts, wenn der Alte schliefe, ich mit einem falschen Schlüssel, den Mohl nach einem von mir gelieferten Wachsabdruck sich verschafft hatte, den Behälter der Steine öffnen sollte. Ich sollte die Opale herausnehmen und an ihre Stelle zwei Imitationen legen, die er mir zeigte. Niemand würde so den Raub bemerken, und noch in derselben Nacht würden wir abreisen ins Glück! Mohl wollte die Opale gleich in Empfang nehmen und war am Abend ins Haus und in den Garten geschlüpft, ohne dass jemand etwas davon bemerkte. Dafür hatte ich gesorgt, indem ich den Pförtner des Hauses und seine Frau im Gespräch festhielt. Damit ich nicht über die knarrende Treppe zu gehen brauchte, hatte ich mir eine Strickleiter und Stricke besorgt, mit denen ich vom Fenster direkt in den Garten hinunter gelangen wollte.
Endlich hörte ich aus Brandorffs Zimmer kein Geräusch mehr. Ich suchte den falschen Schlüssel zu dem Glaskasten; er war nicht da, ich hatte ihn bei Mohl vergessen. Da wäre nun guter Rat teuer gewesen, wenn ich nicht, durch das ewige Anstiften Mohls schon an ein fortwährendes Belauern meines Herrn gewöhnt, vor kurzem entdeckt hätte, dass der alte Brandorff, wohl einer wunderlichen Marotte folgend, die ihm das unscheinbarste Versteck als das sicherste erscheinen ließ, den Schlüssel zu dem Kästchen mit den Opalen in einem kleinen Schächtelchen verwahrte, das in der Lade eines Tisches im Bibliothekzimmer stand. Ich schlich also ins Bibliothekzimmer, wo ich den Schlüssel an seinem Platz auch fand, kehrte vorsichtig ins Arbeitszimmer zurück, schloß den Kasten auf, vertauschte die echten Opale mit den Imitationen und schloß wieder zu. Den Schlüssel steckte ich einstweilen zu mir, um ihn so bald als möglich an seinen gewohnten Ort zu bringen.“
„Was Sie nachher aber vermutlich vergaßen,“ schaltete Sanders ein. „Der Schlüssel fand sich nirgends, und wir mußten den Kasten mit den Opalen aufbrechen.“ Über Johns Gesicht flog ein Grinsen. „Gut, dass Sie’s so lange hinterher erst taten,“ erwiderte er, „sonst hätten Sie jedenfalls früher erfahren, dass die Steine falsch waren, und würden vielleicht nicht so lange im dunkeln getappt haben. Den Schlüssel konnte ich nicht an seinen Platz zurücklegen, weil ich ihn bei dem, was später geschah, verloren haben muss. Es war so weit alles gut gegangen,“ fuhr John nun in seiner Erzählung fort, „und der Weg zum Glück lag offen vor mir. Ich wandte mich, um zum Fenster zu gelangen, als ich plötzlich hinter mir leichenblaß Brandorff stehen sehe. Mit gebrochener, zitternder Stimme fragt er: „Was tun Sie hier?“ Dabei fällt sein Blick voller Schrecken auf die Opale in meiner Hand. Er oder ich – fuhr es mir durch den Kopf. Für einen von uns bedeutete diese Stunde das Verderben.
Fast besinnungslos stürzte ich mich auf ihn, packte ihr bei der Kehle, riß mein Taschentuch heraus und stopfte es ihm als Knebel in den Mund. Dann warf ich ihn zu Boden und band ihn mit den Stricken, die da lagen. Die Sache stand schlimm. Was tun? Ich eilte zum Fenster, winkte Mohl zu und warf ihm die Strickleiter hinab. Dann schloß ich schnell die Türen ab, um jeden Lärm unhörbar zu machen. Mohl kam herauf, sah, was geschehen war, und machte mit dem Daumen eine unzweifelhafte Bewegung, die er mit grausamem Lächeln begleitete. Ich schüttelte heftig den Kopf: Einen Mord wollte ich nicht begehen! Kurz entschlossen schlug ich vor, Brandorff mitzunehmen, denn verraten durften wir uns nicht lassen, wenn nicht alles vereitelt sein sollte. Wir ließen ihn gebunden aus dem Fenster hinab. Der Morgen dämmerte schon. Ich kletterte über den Gartenzaun, der die Straße abschließt, um zu sehen, ob niemand in der Nähe war. Hinten an der Platane bei der Straßenkreuzung sah ich einen Schutzmann stehen, aber er drehte unserem Hause den Rücken zu. Ich kletterte wieder zurück, und nun kam das Gefährlichste: den Gebundenen aus dem Hause zu schaffen, ohne dass der Schutzmann aufmerksam wurde. Die Aufgabe schien unmöglich. Aber als ob der Satan mit uns im Bunde wäre, kam in diesem Moment von der Matthäikirchstraße her ein Automobil angesaust, das seinen Weg über den Kemperplatz nach dem Tiergarten zu nahm. Mit mißbilligendem Kopfschütteln spähte der Beamte hinter dem Übeltäter her, vermutlich, um dessen Nummer zu entziffern, und zog die Uhr, um die Überschreitung der Fahrgeschwindigkeit festzustellen. Als er dann sehr umständlich und gewissenhaft in seinem Notizbuch zu schreiben begann, paßte ich den günstigen Moment ab. Mit dem ohnmächtigen Brandorff, der meinen muskulösen Armen leicht wie eine Feder schien, schlüpfte ich auf meinen lautlosen Gummisohlen aus dem Hause und glitt, gedeckt durch den hinter mir folgenden Mohl, in eine Seitenstraße, wo ein Wagen Mohls, den dieser selbst lenkte, schon bereit stand. Da hinein luden wir Brandorff, und Mohl fuhr mit ihm ab.
Vorläufig war unser Fluchtplan vereitelt. Als Herr Soltau verhaftet wurde, atmeten wir erleichtert auf; nur Mohls Schwester schien plötzlich mit dieser Wendung der Dinge nicht zufrieden. Als dann aber die Freilassung Soltaus erfolgte, gestaltete sich die Sache für uns immer bedenklicher. Nun, nachträglich hatte niemand mehr den Mut, Brandorff kaltblütig zu ermorden. Er war schon fast dem Tode nahe, als wir beschlossen, um keine Schuld auf uns zu laden, ihn zurückzuschicken. Sie wissen, dass es geschehen ist. Aber diese Handlung war mein Verderben. Es war, als ob Mohl unwiderstehlich durch etwas an Brandorffs Haus und Familie gefesselt sei. Er war nicht dazu zu bewegen, abzureisen. Immer wieder strich er mit seiner Schwester um das Heim Brandorffs, suchte er dessen Freunde und Verwandte zu sprechen oder zu sehen, ja sogar bei seinem Begräbnis mußte er dabei sein.
Und seit dem Tage, als Brandorff begraben wurde, ist alles vorbei. Mohl geht in einem tollen Aufzuge wie ein Narr herum, und selbst seine Schwester hat keine Macht mehr über ihn. Seit diesem Tage weiß ich, dass ich mich in die Hand eines Wahnsinnigen gegeben habe und dass alle meine Hoffnungen zunichte geworden sind. Jetzt ist mir alles gleich. Machen Sie mit mir, was Sie wollen!“ Endlich brach Soltau das Schweigen: „Ist Mohl hier im Haus?“ „Ja, der Schuppen im Hofe versteckt einen geheimen Eingang!“
„Ich will ihn sehen!“ sagte Soltau. „Gehen Sie nicht allein!“ rief Redberg. „Bleibe, Erich,“ bat Cecily. „Doch,“ erwiderte Soltau, „ich werde allein gehen – keiner hat ein größerers Recht dazu als ich. Seid unbesorgt, mir wird nichts geschehen!“ Und er verließ tief aufatmend das Haus. Als er beim Schuppen angelangt war, machte er die Blendlaterne, die er sich von Redberg hatte geben lassen, hell. In diesem Augenblick begann der erste heftige Regen zu fallen, den man in der drückenden Schwüle der Nacht schon lange erwartet hatte. Weit hinten begann ein Gewitter in den Wolken zu kämpfen. Soltau sah am Ende des Schuppens eine kleine Tür, stieß sie auf und fand, dass er Stufen hinabgehen mußte, die in einen langen Gang führten. Eine Eisentür schloß ihn vor zwei Nischen rechts und links in der Wand ab. Soltau blieb stehen. Hinter der Eisentür vernahm er Stimmen. Er erkannte eine Männerstimme, die langsam, in seltsam feierlichen Tönen halb sprach, halb sang. Es war wie ein exotisches Gebet. Von Zeit zu Zeit wurde der Mann durch das schrille, erregte Sprechen einer Frauenstimme unterbrochen. Dann näherte sich die Frauenstimme der Tür, und Soltau zog sich in eine Wandnische zurück. Plötzlich öffnete sich die Tür, hinter der ein Lichtschein herausstrahlte, und Soltau konnte sehen, dass ein Weib hervorkam, das die Türe wieder hinter sich zuschlug und den Gang heruntereilte. Er hatte sie erkannt: es war Frau von Zemlinska. Als sie an ihm vorbeiwollte, ließ Soltau die Blendlaterne aufblitzen und packte das Weib am Arm. Sie stieß einen leichten Schreckensschrei aus, drehte sich um und erkannte sofort ihren Angreifer.
Doch in diesem Moment entriß ihm das Weib blitzschnell den Revolver. Soltau löschte sofort die Laterne, er erwartete den ersten Schuß. Aber die Frau lief wild zur Eisentür zurück und riß sie auf. Soltau folgte ihr mutig. Ohne der Gefahr zu achten, blieb er an der offenen Tür stehen, starr, in höchster Überraschung. Heller Lichtschein von vielen Kandelabern quoll ihm entgegen. Der Raum, in dem er hineinsah, war mit farbensprühenden Teppichen ausgeschlagen wie die Wohnung eines orientalischen Fürsten. Mitten im Gemach stand ein silbernes Kohlenbecken, in das ein in wallende, reiche orientalische Gewänder gekleideter Mann, unablässig Gebete psalmodierend, Räucherwerk warf. Soltau erkannte in dem Manne Hugo von Mohl. Er sah mit Entsetzen, wie der Wahnsinn in seinen Augen loderte.
Mohl bemerkte ihn gar nicht. Mit wiegenden Biegungen des Körpers schritt er auf und ab, schlug die Arme über die Brust und verneigte sich in die Luft. Soltau konnte sich vor Entsetzen kaum rühren. Wäre er jetzt überfallen worden, die Angreifer hätten leichtes Spiel mit ihm gehabt. Doch niemand beachtete ihn in diesem Moment. Frau von Zemlinska stürzte auf ihren Bruder zu und rief ihm ins Gesicht: „Du wahnsinniger Schwächling! Du hast uns ins Verderben gestürzt, nur um dieser verwünschten Opale willen!“ Soltaus Blick fiel bei diesen Worten auf den weißen Ledergurt, der Mohl schmückte und aus dem glühend wie zwei Tieraugen die geraubten Opale bunte Feuer sprühten. In diesem Moment erhob das Weib die Hand und schrie: „Du Schurke, nimm das für deinen Wahnsinn!“ Ein Schuß knallte, und Mohl sank getroffen, lautlos zu Boden. Das kam Soltau zu sich. Er stürzte auf die Rasende zu und wollte ihr die Waffe entreißen. Doch als hätte sie das geahnt, entging sie ihm mit einem Seitensprung. Schon glaubte er ihr im Zweikampf gegenüberzustehen, da ließ sie zu seinem grenzenlosen Erstaunen den Revolver plötzlich sinken. Sie trat vor ihn hin, und ihr Mund sprudelte wilde Worte hervor:
„Ich weiß – alles ist aus, alles ist verloren! Durch diesen Menschen da, der jetzt tot ist, diesen Schwächling, den ich haßte! Aber Sie hasse ich nicht, Soltau. Nein, ich liebe Sie, so wie ich den andern haßte! – Oh, sehen Sie mich nicht so starr an, ich liebe Sie ja! Ich will weit fort von hier – kommen Sie, fliehen Sie mit mir, retten Sie mich, lassen Sie mich ein neues Leben anfangen! Oh, ich bin ein starkes Weib, ich kann viel erreichen mit einem Mann, den ich liebe! Hören Sie mich, Soltau?“ Erich Soltau stand bei dieser unerwarteten wilden Liebeserklärung sprachlos da. Er vermochte nicht eine Silbe zu antworten. Tausend Gedanken schossen durch seinen Kopf. Da hörte er hinter sich ein Geräusch. Er wandte sich um und erblickte Redberg und Sanders, die ihm zu seiner Sicherheit nachgegangen waren. Sie waren zu spät gekommen, um den Mord des rasenden Weibes zu verhindern, aber ihre stammelnden Liebesworte hatten sie mitangehört. Auch Cecily, die, von Sanders’ breiter Gestalt verdeckt, in der Tür gestanden, hatte sie vernommen. Mit einem bangen Laut drängte sie jetzt an den beiden Männern vorbei und stand im nächsten Augenblick neben Soltau.
„Erich,“ flüsterte sie und schmiegte sich dicht an ihn. Da richtete sich Soltau hoch auf. Mit einer innigen Bewegung legte er seinen Arm um das zitternde Mädchen. „Nein!“ rief er Frau von Zemlinska entgegen, die ihn mit ihren brennenden Augen so unverwandt anstarrte, als sähe sie außer ihm keinen anderen Menschen im Raume. „Nein, das wird nie sein!“ Das Weib vor ihm schrie laut auf: „So bin ich nichts mehr auf der Welt! Alles ist zu Ende!“ Und ehe Soltau und die anderen einen Schritt tun konnten, knallte die Schußwaffe in ihrer Hand zum zweiten Male dröhnend auf, und mit zerschmetterter Schläfe fiel das schöne Weib zu Boden.
Fast ein Jahr war seit diesen Ereignissen vergangen. Der Überlebende der Verbrecher, der Diener John, büßte seine Beihilfe zu der Tat im Gefängnis. Bei seiner Bestrafung war ihm die Fürsprache für Brandorffs Leben als mildernder Umstand angerechnet worden. Vom Falle Brandorff, der so viel Aufsehen erregt hatte, war es still geworden. Rechtsanwalt Sanders saß in seinem Bureau und arbeitete. Er war etwas älter geworden, einige Haare wurden schon leise grau, Fältchen spielten um seinen Mund. Es klopfte an die Tür.
„Darf man eintreten?“ fragte eine Stimme. „Ah, du bist es, Erich!“ rief Sanders, ohne den Kopf zu wenden. „Komm nur herein!“ „Aber ich bin nicht allein, Sanders!“ rief Soltau. Sanders wandte sich schnell um: In der Tür stand in reizender Verwirrung Cecily Brandorff. „Lieber Sanders,“ sagte Soltau, „darf ich dir meine Braut vorstellen? Wir haben soeben das Aufgebot besorgt, und ich hielt es für unsere Pflicht, unseren ersten Besuch dir abzustatten!“ Und mit komischer Feierlichkeit stellte er vor: „Herr Rechtsanwalt Sanders – Fräulein Cecily Brandorff – bald Cecily Soltau!“ Doch Cecily unterbrach ihn: „Nein, lieber Sanders, wir sind nicht nur gekommen, um Scherze zu machen, sondern auch um etwas sehr Ernstes zu erledigen. Sie sollen nämlich nicht nur unser Trauzeuge, sondern auch unser Notar werden.“
„Was ich hiermit feierlich annehme,“ erwiderte Sanders lächelnd. „Schön,“ sagte Cecily ernst. „Wir möchten Sie um etwas bitten. Sehen Sie, ich möchte Erich nicht heriraten, ehe ich nicht weiß, dass diese Unglückssteine, die Opale, die meinem armen Vater das Leben gekostet haben, ganz aus unserer Nähe verschwunden sind. Ich würde sonst als Erichs Frau nicht eine ruhige Stunde mehr haben. Hier nehmen Sie sie und stellen Sie die Steine dem rechtmäßigen Eigentümer zu!“ Und im Bureau des Rechtsanwaltes strahlten die indischen Riesenopale zum letzten Male vor Europäeraugen auf in ihrem mächtigen Glanze, der mit seinem schillernden Funkeln von den bunten Leidenschaften der Menschenseele, ihrem Glück und ihrem Unheil zu sagen schien.
Ende.
Quellenhinweis: Deutsches Literaturarchiv, Marbach.
"Gli opali indiani" è stato tradotto in italiano da Roberta Visone della Bottega dei Traduttori.