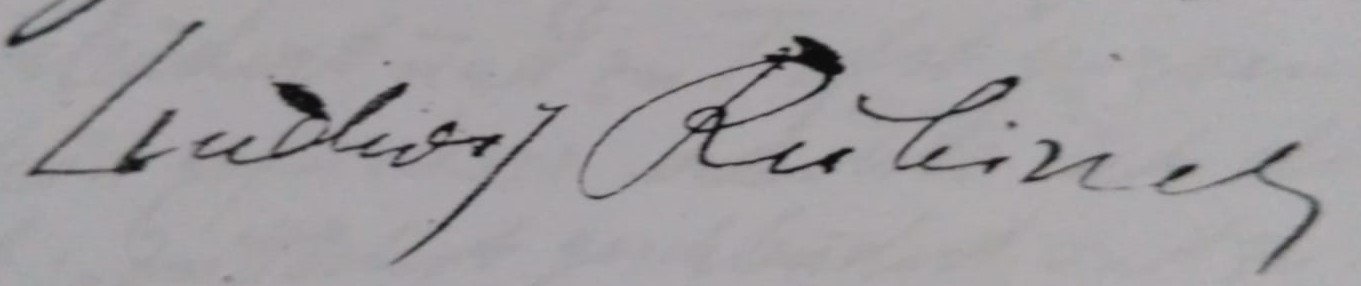Rubiner als Kritiker
Die Änderung der Welt
Das Geistige
Ein Geburtstagskind bekam eine Torte. "Was für eine Torte hast du da?" fragten seine Freunde. Das Geburtstagskind machte sich so klein, bis sein Auge genau auf dem Niveau der Torte war. "Ich sehe", sagte es, "ein Ding mit Bergen und Tälern, und gerade so hoch wie ich selber." - "Aber was ist drin?" fragten die Freunde. "ich will Konditor werden, dann werden wir alle das wissen!" antwortete es. Diese Mitteilungen erregten bei den Freunden durch ihre sachliche Unbeteiligtheit Staunen und Bewunderung. SIe machten sich alle so klein wie das Geburtstagskind, und einige entschlossen sich still zum Konditorberuf. Da kam aus dem Nebenzimmer ein neuer Spielkamerad. Ziemlich taktlos stürzte er sich gleich auf die Torte, schnitt sie schnell an und aß. "Ah, Marzipantorten schmecken doch wunderbar", sagte er; allzuviel hatte er von dem Geschenk nicht übriggelassen. "Was hast du gemacht!" schrien alle entrüstet, "wir wollen doch wissen, was in der Torte drin ist!" - "Verzeiht, meine Freunde", versetzte der Täter, "ich glaubte, man erkennt es durch Essen."
Aller Jammer der Welt rührt daher, daß die Menschen gewohnt sind, sich als bloße Naturwesen anzusehen. Das Naturgeschöpf ist dem Naturgeschehen unterworfen; alles sei im großen Strom, die Menschen - Naturprodukte strömten mit. Der Naturbetrachter sieht die Welt vom vorhandenen Material aus an, und er bezieht die Fakten auf den Menschen nur als auf ein Anwendungsobjekt. Der Mensch steht für ihn auf derselben Stufe wie sein Material. Diese Naturphilosophie der Genrekleins meint, alles stehe auf demselben Niveau; alles sei gleich gut. Die Absicht dieses Infantilismus ist: Indifferenz. Sollte nicht, am Ende, die relativistische Naturansicht aus dunklem, eingesipptem, noch nicht abgestoßenem Bequemlichkeitsgefühl kommen? Aus der Trägheitsvorstellung, man lebe auf dieser Erde als auf einer flachen Scheibe? Eine Vorstellung, die jeder Schüler berichtigen kann. Aber eine Berichtigung, die noch nicht ins Handeln übergegangen ist. Die Naturansicht des Menschenlebens - die Gleichsetzung mit allem, was ist; die schiefe Güte, die alles in Ruhe lassen, nichts ändern will; die falsche Gerechtigkeit, die jedem Ding, seine Sondergerechtigkeit zubilligt; der Relativismus; die Standpunktlosigkeit: dieses alles ist eine schlechte, träge, ungewußte, unradikale Geographie.
Der Aufenthalt auf der Erdkugel ist unendlich unbeschränkt; wir fallen nirgends über den Rand. Der Standpunkt steht uns frei. Wir haben also zu wählen. Wählen wir das Allernächstliegende: überhaupt einen Standpunkt. - Aber die Tatsache, daß wir überhaupt einen Standpunkt haben, ist unendlich folgenreich. Die Natur, die wir jetzt außer ihr ansehen, ist das Notwendige. Das nur Notwendige. Aber die Wahl unseres Standpunktes, die Tatsache eines absoluten, unbedingten Ausganges für unser Zurechtfinden im Leben; die neue Perspektive, das Geistige, dies ist nichts Notwendiges mehr. Das Geistige ist ein Plus. Ein Überfluß, ein unerhörter Luxus der Welt. Es ist wie die Koda in einer Beethovenschen Sonate: alles Notwendige des Musiksatzes ist da, alle Durchführungen sind gemacht, alle Themen sind erklärt, gewendet, und ein Schulmeister würde Schluß machen. Da taucht, einige Takte vor dem Ende, überraschend eine neue Musik auf, neu irgendwoher aus einem Unerschöpflichen geholt, und nun untrennbar vom Werk, doch das Werk steigernd. Ein Plus, ein Unnotwendiges, Unmechanisches, Unselbstverständliches; ein Willenswesen, Aktionswesen, ein unglaublicher Überfluß des Schöpferischen.
Das Geistige ist die Koda der Welt. Einen Standpunkt haben, heißt: Es kommt darauf an, zu wissen, daß man außerhalb steht. Einzig, unter dem Notwendigkeitsgebundenen dieser Erde, steht der Mensch außerhalb, überraschend ein Überfluß. Die geistige Betrachtung geht vom einzig dastehenden Menschen aus.
Dem mechanischen Geschehen fehlt der archimedische Punkt Außerhalb, um die Welt aus den Angeln zu heben. Der Mensch hat ihn. Er hebe.
Das Wesen des Menschen ist: an der Welt heben. Seine erste Tätigkeit geht auf Änderung der Welt. Sein Hebel, das reinste geistige Werkzeug, ist: der Wert. Der Mensch wertet - er ändert. Einer kam einmal funkelnagelneu geboren in die menschliche Gesellschaft und fragte bescheiden: "Was ist wertvoller, die Venus von Milo oder ein Pfund Fleisch?" Die Gesellschaft bestand aus reinen Naturbetrachtern, Objektfanatikern, schlechten Geographen; Standpunktlosen, und antwortete: Man könne nicht inkommensurable Größen vergleichen.
Aber geistig - menschenwürdig, standpunkthaft hebelartig - ist gerade die Wertung des Inkommensurablen. Man stelle die Frage direkter, beziehungsvoller, lebenrührender: Was ist wichtiger, eine Kathedrale oder ein Menschenleben? Da stehen wir auf einmal ganz scharf außerhalb unendlich, bloß gegebenen Materials der Natur. Jeder Mensch weiß die Anrtwort auf die Kathedral-Frage seines Lebens. Es ist wichtiger. Mit dieser Antwort wird die Welt von neuem geändert.
Wie tief in Wahrheit die Anständigkeit, die Kameradschaft, die Menschlichkeit im Menschen sitzt! Die Entscheidung zum Werten, der Entschluß zur Rettung der Welt:
Wir beantworten wirklich jene Gewissensfrage, und wir alle bejahen in ihr das Menschenleben. Auch in der unausrottbaren Hoffnung, es werde wirklich doch unsere Entscheidung ein Menschenleben erhalten. Und wir geben diese Hoffnung selbst dann nicht auf, wenn wir ahnen, daß der Frager betrügerisch fragt, daß er unsere geistig ehrliche Antwort nur mißbrauchen will, und daß er die Menschenleben genauso mißachtet wie die Kathedralen.
Aber der Geistige darf nicht vorsichtig sein. Denn schweigen, unter dem Vorwande, das Reden könne mißbraucht werden, heißt sich verleugnen, auch für den Moment, da die Stimme des Menschen aus den Leibern seiner Freunde und Kameraden hörbar wird erschallen.
Entscheidet euch
Die Beurteilung von Werten verschiedener Art ist den Menschen darum peinlich, weil sie alles auf einmal besitzen möchten (die Venus und den Braten). Werte sind zur Wertung da. Wenn Ihr geistige Wesen seid, so seid Ihr Partei. Ihr habt nicht Euch genießerisch, relativistisch, besitzgierig um die Wertung zu drücken.
Entscheidet euch!
Sieht man aber ein? Der Wert kümmert sich nicht um den Besitz. Der Geist hat nichts mit Besitz zu schaffen. Nur der bloße Naturbetrachter findet überall Objekt, Aufzulesendes, Materie, Dinge, die man haben und festhalten kann, Besitz.
Besitztum ist das ewige Mißverständnis des Naturmenschen; Anhäufung, Addition des nur Notwendigen, in der todbringenden Vorstellung, durch Anhäufen werde man einen Turm errichten, einen höheren Gesichtspunkt gewinnen, der dumpf geahnten Herrlichkeit des Außerhalb, des Standpunktes, des Wertes, näherkommen. Gradweise, entwicklungsmäßig, von selbst. Aber Besitz umschließt nur immer höher mit den objektiven Molekül-Mauern der Natur.
Die Mythologie des Besitzes hat Nuancen. In der "Offenbarung Johannis" empfängt Johannes eine Buchrolle, die er essen muß; dadurch wird er in den Stand gesetzt, neue Weissagungen zu empfangen und zu geben. Eine große Naivität der Besitzes-Ideologie; das Sicheinverleiben. Aber es gibt auch die Umkehrung dessen, ein invertiertes Einverleiben: die Einfühlung.
Oder die animistische Umkleidung des Besitzes: Macht. Machtglaube ist ein Attribut von atavistischem Zauberglauben. Der Magiegläubige meint, die Erreichung von Macht ändere sein ganzes Wesen. Aber Besitz ändert nichts. Aberglaube von Toren ist die Vorstellung, amerikanische Milliardäre seien in ihrer ganzen Lebensfähigkeit anders als andere Menschen. "Die Kaiserin", sagt der Schmied in einem Märchen von Gogol, "saß auf goldenem Thron und aß goldene Knödel."
Die Schätzung des Interessanten oder des Originellen ist eine Form von Besitzglauben (dagegen rein geistig, über alles herrlich und wertvoll ist das Originäre, das Ursprüngliche, das aus erster Hand Kommende). Nicht originell, nicht interessant ist das Schöpferische. Die Erfindung, das von Grund aus Neue, die Schöpfung steht außerhalb des Besitzes. Das Schöpferische ändert die Welt und zersprengt immer gleich wieder sich selbst. Es ist da, um unablässig wieder ganz von vorn anzufangen. Eine schreckliche, hoffnungraubende Idee für alle Machtgläubigen. Aber Hoffnung ist selbst nur ein Trick, ein Marschsignal (gegenüber der Gewißheit).
Eine Verwechslung: die Menschen setzen gern Schöpfung und bloße Sichtbarkeit gleich. Aber die Entdeckung, die bloße Aufdeckung, des noch nie Gesehenen ändert die Welt nicht. Hochschätzung des Visionären, die Geschauten, des Augensinns, der Entdeckung: ist Besitzaberglaube.
Ihm gegenüber steht die Zeugung, das Geschaffene, die Erfindung.
Für den Geistigen hat Besitz gar keinen Sinn. Er wertet. Er ändert unablässig. Wie sollte er auf die Idee kommen, etwas festhalten zu wollen? Sein Hebeldruck zur Änderung der Welt ist nicht Besitz, sondern die höchste Immaterialität, das stärkste nur Innensein: die Intensität. Alle Änderung der Welt ist Projektion des Geistes auf die Welt. Wir, Geistesmenschen, stehen vor der Urforderung dieses Lebens: Verwirklichung. Der Weg, den wir der Intensität aus uns heraus geben, ist der Weg der Verwirklichung. Unser erster Gedanke bei unserer Geburt ist: verwirklichen wir. -
Verwirklichen Wir!
Schöpfung beginnt.
Feuerbachs Einwand, Gott sei vom Menschen selbst gemacht, ist einer der dümmsten Einwände. Denn im Gegenteil. Ist es so, dann gäb es kein strahlenderes Stück von Projektivität des Geistes, von Produktivität des Menschen. Aus uns einen Schöpfer schaffen - Gipfel der Verwirklichung.
Geistige Herkunft
Wir sind allgegenwärtig geboren. Im Moment unserer Geburt kommen wir zu allen Menschenleben der Erde in Beziehung. Noch in diesem Moment hätten wir die ungeheuer vielfache Möglichkeit gehabt, an irgend jedem andern Punkt der Erdkugel geboren zu sein. Also eine Möglichkeit, alles zu sehen, alles zu wissen.
Was wir erreichen müssen, ist immer wieder die Besinnung auf unsere ungeübte Fähigkeit, die durch unser notwendiges Erdenleben erstickte Fähigkeit: allgegenwärtig, allsehend, allwissend zu sein. Nicht die Fähigkeit gilt es zu erlangen - das ist vorbei und unmöglich. Aber die Besinnung wiederzugewinnen, daß diese Fähigkeit hätte dasein können. Die Besinnung, das heißt: die Neuschaffung eines Ersten Tages unseres Erdenlebens. Unser Tag der Geburt, wieder gezeugt zu einer Zeit, wo wir schon längst in die schmachtenden, isolierenden Beschränkungen eines Privatlebens gezwungen sind. Abere gerade das enge Bett unserer Gewohnheitsbeschränkung, in das nun die Welt unseres Neu-Adam-Seins strömt, verhilft uns zu dem herrlichsten und tiefsten Stigma des Geistes: Wir sind nicht mehr allgegenwärtig, allwissend, allsehend: doch am Tage unserer Besinnung werden wir allwollend.
Damit hat jeder von uns die Verantwortung für jeden Menschen der ganzen Mit-Erde auf sich genommen. Jeder von uns die Verantwortung für jeden andern!
Und hier wird eine alte Schiefheit zurechtgerückt, das Mißverständnis von der Gleichheit aller Menschen. (Auch die treuesten Anhänger werden verlegen.)
"Gleichheit aller Menschen", das würde ja nichts Wesentliches vom Menschen mitteilen. Die Annahme einer Gleichheit würde sofort hinter die Geburt der Menschen einen ewigen Ruhepunkt setzen. Da wäre also nicht die Aussage einer Wissenschaft (Wissenschaft wird heute nur noch von der Blüte der Schwachköpfe abgelehnt), sondern höchstens eine Klassifikation aus einer primitiven "Histoire naturelle". Dieses Moment des ewigen, befriedigenden Stillstandes nach der Geburt - die Folge seiner Gleichheit aller Wesen - , der wäre eben in ungeheuerlicher Weise eine Angelegenheit der reinen, faktischen Natur. Und nicht im mindesten eine Angelegenheit des Geistes.
Siehe da, die Bemerkung hier ist nicht etwa eine geistreiche Spekulation, sondern eine Beobachtung: Denn bei allem Lebenden auf dieser Erde - mit Ausnahme des Menschen - besteht jene natürliche Gleichheit der Wesen, und danach ihre ewige, befriedigte Ruhe und Stille. Die werden geboren, fressen, schlafen, begatten, sterben. Fertig. Wie natürlich!
Aber der Mensch, einzig, ist verknotet bis zu Schmerzen der Wut, auch bis zum maßlos zustimmenden Glücksgaloppieren des Bluts mit jedem einzelnen, fremdem, gliechzeitigen irgendwo dortigen Menschenwesen. Wir alle, Menschen, tragen gegenseitig unsere Verantwortung. Wie geistig!
Nicht Gleichheit aller, sondern Verantwortlichkeit aller!
Aber ganz anders als die bloße Feststellung von rohen Naturtatsachen, nur vermischt durch den Gebrauch desselben Worts, ist die Forderung "Gleichheit!" Diese große Völkerparole ist in Wahrheit der Ruf nach Menschenähnlichkeit.
Der erste Tag
Alles, was gewesen ist, ist falsch. Jeder Grad bis zu diesem jetzigen, ersten allerersten Moment des Seins ist Anhäufung, Sandsack, Verhau; Hindernis außerhalb jedes Wertes, Aufenthalt. Trägheitswiderstand gegen die Besinnung auf unsere Existenz aus unserer geistigen, geistigen Herkunft. Wir kommen aus dem Geist und sind in einemmal da. Jeder Tag, den ihr bis heute gelebt habt, war zum tausendsten Male Tod, nutzloser Tod. Nutzlos wie jeder Tod.
Wär das Gewesene nicht Irrtum, Wertlosigkeit, Kasemattentum, so wär es nicht vergangen.
Zerstört das Gewesene!
O wie namenlos noch nicht dagewesen ist alles, was ist. Wie unglaublich oft noch nicht dagewesen ist diese Welt. O Glück, da die Menschen tausendmal ihren ersten Tag haben.
Weiß man auch, daß die Erde barst! Inseln schwollen aus dem Meer, feurige Schwerter schweiften: an dem Tage, da Euklid fand, daß das reine Denken des Menschen und die Wirklichkeit - unerhört - sich decken können; bewiesenermaßen! O erster Tag der geometrischen - Prädestinationslehre. Erster Tag des Euklidismus. Erster Tag des ersten Beweises. Erster Tag des Belauerns, wie eine Denkfolge zur Wirklichkeit schleicht. Wie phantastisch vorzustellen die Erschütterungen der Erde vor Adam Euklides. Erster Tag. Schöpfung.
Dagegen: die bloße Deskriptionsrolle Kants, der versteht und beschreibt, daß jene angebliche Wirklichkeit im Denken enthalten ist. Der Unterschied etwa wie zwischen dem Apostel Paulus und Exzellenz Piefkes "Wesen des Christentums".
Bitte nicht rückwärts mißverstehen! Die Euklidwelt ist tot. Da heut die ganze euklidische Geometrie von jedem Schüler schnell gelernt werden kann, steht Piefke unserer Zustimmung näher als die Apostel.
Ihr Herzen, wahre aufrichtige Herzen, meine Herzen, zuallererst müßt ihr flache Rationalisten sein, flache Rationalisten! Sonst existiert ihr nicht lebend, zeugungsfähig, gegenwärtig. Sonst steckt ihr an modrig Gewestem, seid Rezipienten, Reproduzenten, Kostümstücke, mysteriöse Historiker. Nur gewöhnlich, unoriginell, ohne Tiefe und Geheimnis begreifend, daß ihr günstigerweise gerade jetzt den Moment zum Leben erwischt habt, nur so flach rationalistisch - so brutal zeitgemäß allein - könnt ihr schöpferisch sein. Ganz Anfang. Ganz ersttätig. Ganz Adam.
Seid Adam!
Erlebnis
Erfahrung? Begriff der Erfahrung: trauriges Kapitalistentum der Ahnungslosen - zu glauben, durch langes Leben könne man Gewißheit kaufen.
Man soll auch dies nicht verschweigen: die Ideen unserer Zeit vom Erlebnis sind Besitzaberglaube.
Besitzglaube ist Furchtsymptom. Erwartung des Verlierenkönnens. Stärkste Neigung zur Einmaligkeit (Einmaligkeit = Originalität). Es kommt aber nicht an auf Einmaligkeit, es kommt an auf Erstmaligkeit.
Seid zum erstenmal!
Ein sehr großes Erlebnis
Im Jahre 1882 flog durch vulkanische Eruption die Südseeinsel Krakatao in die Luft. Viele hunderttausend Menschen wurden von der Flutwelle getötet. Eine Risenwolke feinen Staubes bleib in der Luft, umkreiste mehrmals die Erde und brachte die tiefen farbigen Dämmerungserscheinungen hervor, die von jener Zeit bis Mitte der neunziger Jahre in der ganzen Welt sichtbar waren. -
Es ist mir immer klar gewesen, daß die Farbenwolken des Krakatao in innigster Beziehung stehen zu den neuen Malerfarben, den bunten Worten, den Neobildern, den Nuancen dieser Jahre.
Das ist ein Erlebnis, ein tellurisches. Objektiv, real, nicht abzustreiten. Ist das nun groß genug? Und alles, damit einige Malerateliers mehr gebaut werden? Ja? Alles, damit unser Sicherheitsgefühl in Europa steigt, einige Bilder mehr an den Wänden hängen, einige Bücher mehr erscheinen, Loïe Fuller unter Beifall Farben-Variété macht, die Fabriken bunte Blusenstoffe in die Welt setzen, Genießer vom "Farbenfleck" reden?
Darum? Diese flach teleologischen Fragen sind notwendig, solange wir noch an das Erlebnis glauben.
Und als die Malerfarben wieder blasser wurden, die Gedichte schilderungsfreier, da: ein europäischer Krieg, um das Erlebnis zu erneuern? Kameraden, ewiger Weltboykott diesen Teleologen! (Meyerbeer mietete sich ein Hausorchester, weil er sich Klangkombinationen nicht denken konnte, sondern sie praktisch erleben mußte. Wer aber hat sich den Weltkrieg gemietet? Wir, zum Teufel, wir leben nicht für Schilderungen der Komponisten, Maler, Lyriker oder Romanciers!).
Nieder das Erlebnis
Die sogenannte Intuition (man weiss: umfassendste lyrische Begründung vom grossen Praktiker der Einfühlung, Bergson) ist Begriffsmanscherei. Für feine Genießer, Connoisseurs, Mitmacher: eine Hilfsvorstellung zur Rechtfertigung ihres Schwammdaseins. Das ewige Aufsaugen fremder Wesen, und von fremden Wesen ewig Sich-aufsaugen-Lassen, beides steht auf demselben vakuumhaften Plan der traditionellen Idée fixe vom Besitz. Nicht eintauchen! Nicht aus fremden Munde reden! Einzig von Wert ist: Mitteilen, Überreden, Aussagen. Überzeugnis ablegen von unserer Gewißheit zu sein.
Gewißheit, zu sein. Geboren zu sein. Einfach genug nur: zu existieren. Diese Gewißheit ist die tobendste, brisanteste, unaufhaltsamste Umwälzungsenergie; rasender als alle Sprengstoffe, blutiger, vernichtender, fatumhafter als alle Weltkriege. So durch alle Minen der Erde hindurch zerstörend, wie nur Schaffendes sein kann.
Anmerkung. Nur wer überhaupt den Mut hat, jeglicher Phänomenologie - als bloßer naturaler Gegenbenheit - die Möglichkeit zur Welterkenntnis von vornherein abzustreifen, nur der hat das Recht, gegen den bedeutenden Philosophen Bergson zu sprechen. Aber boykottieren wir endlich diese Geschäftsschreier, die den Philosophen Bergson, wegen Franzosentums, anheulen: "Schopenhauer-Plagiator!" - "Rousseauit!" - So, und Nietzsche hatte wohl nichts mit Schopenhauer? Und Goethe war wohl kein Rousseauit?
(Kostspieliges Erlebnis)
"Wie finden Sie die Gedichte von Agnes de Blumenau?"
"Höchst begabt!"
"Wissen Sie, das Mädchen ist so entsetzlich arm, daß sie Prostituierte wurde mit dem jämmerlichsten Straßendienst."
"Aber ist denn nicht der Schriftsteller Robespierre mit ihr sehr befreundet?"
"Ja, aber er hilft ihr nicht."
"Warum nicht?"
"Er hat einmal gehört, auch zur Prostitution müsse man talentiert sein. Nun meint er, zum Talent müsse man auch prostituiert sein."
(Noch kostspieliger)
Es gab Dummköpfe, die die Frechheit hatten, den Krieg als Erlebnis zu empfehlen.
Kunst
Es ist bezeichnend für die verräterisch böswillige Dummheit unserer Zeitgenossen, daß sie, anstatt die einfachen wirklichen Absichten einer Mitteilung zu beurteilen, zu werten und mit oder gegen zu wirken: Daß sie statt dessen die Mitteilung viel lieber "verstehen" wollen. Standpunktlosigkeit, billige Konvertitenart, Schöne-Psychologie-Treiben um jeden Preis. Ein Beispiel. Liberale Schriftsteller vermitteln uns, aus lauter Verständnis, den Dichter Kleist. Aber Kleist ist die letzte Rettung des Adels aus seiner Agonie; der Nachtschweiß zusammenkrachender Junkerschlösser zeugt ihn. Der Literat rettet den Adel. Wäre nun etwa Kleist in seinem geschauten, und also doch gewünschten junkerlichen Feudalstaat heute Staatsmann, so wären jene liberalen Schriftsteller längst mit einem gelben Stern auf dem Rücken ins Ghetto gesteckt. (Freilich - für rankende Dichter, gottselige Bestrahler von beglaubigten Weltkonjunkturen, für die gäb es kleine Gnadenstellen.)
Die übliche Ausrede gutwilliger Psychologen ist, man müsse solche "Tendenzen" unberücksichtigt lassen. Es handle sich allein um das Dichtertum eines Dichters. Tiefes Mißverständnis! Dichter sein kann ja kein Ziel sein, sondern nur allererste Voraussetzung. Dichter sein bedeutet nur das Notwendigste: daß der Mann imstande ist, seine Ziele glaubhaft genau darzulegen. Sonst würde man sie ja gar nicht erkennen. Wenn jemand spricht, so kommt's darauf an, was überhaupt er zu sagen hat.
Nicht blindlings haben wir den Tanz des Derwisches zu billigen? Ein Schamane tanzte vor seinem Stamm mit schäumendem Mund. "Seht, wie bedeutend er schäumt!" sagte der Psychologe.
Philosophie der Diebe
Jede Kunstbetrachtung aus der Kunst heraus nimmt als ganz selbstverständlich Besitz von bereits Vorhandenem, Festgelegtem. Künstlertheorien sind Methoden, eine Erbschaft anzutreten. Der Diebstahl als Genußmittel.
Verwirklichung in der Kunst ist ja nie wahre Schöpfung, sondern nur das In-Übereinstimmung-Bringen des Ausdrucks mit der Absicht. Und das gilt jenen Kindsköpfen schon als das höchste im Leben Erreichbare. Dabei anzumerken die rein zeitliche Einseitigkeit, die Kunst auf "Ausdruck" festzulegen. Ausdruck ist ja nur die invertierte Einfühlung. Der "Ausdruck" der Kunst (Expression) ist nichts Geistiges, sondern immer noch an die Besitzvorstellungen gekettet. Eine Besitzentleerung. Zum Besitz für andere. Diese Kunst kommt nicht los vom Umkreis des Besitzes. Sie steht nicht außerhalb. Sie wertet nicht. Sie ist ungeistig. Sie bestätigt immer nur die Welt. Sie ändert sie nicht.
Die Flucht in die Kunst
In prophetischer Ahnung hat sich alles, was vor dem Tode stand, in die Kunst geflüchtet (wie Künstler vor dem Tode gern in den Katholizismus). Denn die Kunst - dies wird hier ganz besonders deutlich - ist nichts Abgesondertes, sondern eine politische Reaktionsform. Wie tief ging die Ahnung der Franzosen - sie schufen sich vor dem Kriege verzweifelt in Bildern ganz unvergängliche Paradiese. Ehe ihre Landschaften durchwüstet wurden. Der merkwürdigste Fall ist Spanien, zur völligen politischen Untätigkeit verurteilt. Spaniens Prophet ist der Antikünstler, der Kubist Picasso. Seine Bilder sagen, daß Macht nichts ist und daß man ohne Macht, ohne Mittel, ohne Realität - allein aus dem Geiste - ungeheure Reiche verwirklichen kann. Die Werke Picassos sind messianische Weissagungen, denen das Volk fehlt. Gesetzgebung, der die Vollstrecker fehlen. Tröstungen über ewig Versunkenes.
Bemerkung. Vor dem Krieg schon, unbeeinflußt durch Naturgewalten, ging es, bewußt für den Geist, gegen die Kunst. Seitdem hat, mit entliehenen schnell verstümmelten Begriffen, phlegmatisch alberne Spießerfrechheit die Gelegenheit zu emsiger Verwechslung benutzt, und gegen irgend unbeliebte Kunstwerke mobilisiert. "Seid Politiker!" heißt aber: Wendet eure Intensität auf Verwirklichung, sonst passiert euch was! (Ist nun auch.) Seid gerade gegen die höchste, beste Kunst. Gegen den erhabenen Vorgang, der euch absorbiert. Der euch zur seligen Urzelle macht: Der euch - fürchterlichster aller grauenvollsten Wertlosigkeitstode - der euch isoliert!
Die feudale Behäbigkeit von Jahrhunderten ist schuld, wenn jeder Dümmling einen Malersmann, also einen Tenor, einen Reizling, genial: geistig! nennen darf. Ganz große Künstler, Antikünstler schon, sind Politiker mit umgekehrtem Vorzeichen. Warum sind sie nicht lieber Politiker mit direkter Aktion?
Ihre Tätigkeit ist geistige Tätigkeit. Aber das ist an sich zu wenig. Der Weg von der verstoßenden, menschenzüchtenden Tendenz des Politikers bis zu den Ahnungen der Prophetie (dem Bild des Künstlers, dem Gegenbild der Politik) - dieser Weg verschluckt ganz die Intensität. Die Intensität, die allein die Stromleitung unter allen Menschen herstellt. Die Wirksamkeit der Aufforderung. Die Sprengfähigkeit der Handlung.
Geistigkeit allein macht auch nicht glücklich.
Ohne die Verwirklichung seid ihr Schemen.
Wir brauchen keine Messiasse. Seid Politiker.
Seid Handelnde!
Das Was ist
Die unglücklichsten Menschen sind heute die, die in der Welt einen spannenden Roman sehen. Sie haben nie genug zu lesen; sie wollen schließlich aus Verzweiflung ihren eigenen Roman lesen. Das heißt, sie wollen die Welt mitmachen, statt sie zu machen.
Man müßte gerade diese Menschen immer wieder aufklären, einfach über ihre groben Irrtümer aufklären. Denn wenn gerade sie öffentlich werden, dann sind sie allem Wertvollen gefährlich. Sie sind ja stets unsicher, ob sie sich zum revoltierenden Dichter entschließen sollen oder zum freiwilligen agent provocateur (aus lauter Verständnis für den fremden Typ). Von hier drohen Schmuckstücke des Aufruhrs, Rebellions-Krawattennadeln oder Gedichte, dekorative Revolutionen; Reifenspiel ästhetischer Streiks. (Bunter Krawall statt politischer Ziele. Oder: Spectator schreibt ein Aufruhrdrama.) Eine verbrecherische Künstleransicht vom Leben: Menschen sollen verhungern, Menschen sollen niedergeschossen werden, um - unbeteiligt - noch im Sterben lebende Bilder zu stellen!
Man sieht, wie sehr es auf das bloße "Was" ankommt. Mildere Töne: Skepsis ist fruchtbar. Aber Verzicht auf das "Was" ist zur Vornehmheit verdammt. Man kann sich eine Gewißheit nicht dadurch verschaffen, daß man eine fremde annimmt. Menschen, die für frühchristliche Mosaiken, Exotenplastik oder gregorianische Kirchenmusik himmeln, unterscheiden sich nicht von Humpen-Sammlern. Wenn einmal irgendeine Ferne ursprünglich war - der Amateur der Ferne ist es nie. Der Nur-Methoden-Mann; der Bloß-Bedeutungs-Rechercheur, der feierliche Form-Erläuterer: dieses albernste, weil tatenloseste aller Geschöpfe, Primitivus Symbolicke ist ein Schwindler!
Die Geschichte einer Wirkung: Calvin sagt, das Abendmahl bedeutet nur den Leib Christi; er war vornehm, symbolisch, von der Skepsis des bilderreichen Künstlers. Die Härte, Klarheit, Ethik seiner Reformation viel stärker als die Luthers. Gegen Luther Calvins Erfolg gering. Der Riesenerfolg des Protestantismus bei dem dicken, groben Luther (wenngleich schauerlichem Kompromiß- und Demutsmacher), der mit schweißiger Mönchsfaust das Pult schreiend schlägt: "Das Abendmahl ist der Leib, ist, ist; nichts von Bedeutung; es ist wirklich der Leib!" Der sich den groben Inhalt wahrt. Die Wirkung ist beim Inhalt. Man nennt das: an etwas glauben. Es kommt aber auf das Was an.
Symbolische Handlungen
Symbolische Handlungen sind nichts wert. Eine Handlung, die Versprechungen macht, ist keine. Sollen wir etwa den Riesenreif des Ungetanen, das Vakuum des Nichtsausgeführten aus unseren Einzelwünschen ergänzen? Theorie des Fresko. Der Schwindel der Geste. Es bleibt das Vakuum. Das Nichtgetane, die bloße schöne Geste des Tuns, enthält nicht etwa irgendeine geheime, in ihm ruhende Energie zu Taten! Keine Immanenz. Allein in der vollen, beschränkten, getanen Handlung ruht die Energie-Immanenz zu Neuem.
Die symbolische Handlung, die Geste, bleibt die Intensität des Tuns schuldig. In der Geste liegt nicht die Intensität des Sprengenden, sondern die Zufriedenheit des Schauenden. Der Schauende schließt ab und ist zufrieden. Das weltberühmet Wort jenes Franzosen, der im Café von einem Bombensplitter getroffen wurde, "qu'importe, si le geste est beau", dieser Leitsatz der Symbol-Politik ist infantile Verschleuderung des Wichtigsten an Kunstaustellungsgefühle. Der Atavist meint zu besitzen, was zu schauen ist; was von allen zu schauen ist, meint er, sei aller Besitz. Er glaubt, der Besitz aller sei aller Glück. Und denkt, der Ruhepunkt des Glücks ändere die Welt. Denn nicht anders als wir alle will auch er ändern. Aber wie niggerhaft fetischistisch, wie ahnungslos, wie atelierfreundlich ist die symbolische Ansicht: nur das Schaubare, nur das Bild, nur das fürs Aug' fertig Gerahmte sei Realisierung.
Das Sinnenhafte, das Bildliche, das Vergleichsmäßige, das "Wie" einer Handlung, das Augenmeßbare - dies ist alles nur fürs Publikum da. Wäre das ungeheure Maß an Mut des einzelnen, das zur Schau in Publikumsarbeit verschwendet war, in Intensität umgesetzt worden, so wär etwas geschehen. Abet wenn die ganze Welt etwas sieht, so ruht sie um die Handlung selbst. Sie ruht, nur ruhend, beruhigt über ihre Unruhe, auf einer gigantischen Tragödien-Kuriosität.
Der Franzose, der eine Bombe ins Pariser Café warf, hat dadurch nicht alle Kapitalistencafés zum Schließen veranlaßt. Die Ermordung eines Erzherzogs beseitigte nicht die Kriegsgefahr zwischen Österreich und Serbien. D'Annunzio, der Triest im Aero überflog, eroberte die Stadt nicht für Italien. (Deswegen bleibt D'Annunzio doch der mächtigste - und ausgenutzteste - Anreger der heutigen Literatur. Und man denke: wenn dieses Mundstück seine Oden nicht für, sondern gegen den Krieg gekehrt hätte - wie unsterblich stände Europa da!) Symbolische Handlungen schaffen nie etwas in der Absicht der Handlungen. Nur Staunen über das blutige Augenspiel. Es bleibt beim Schaustück.
Tolstoi, ohne Armfuchteln, so unsymbolisch, daß er aus Nachgiebigkeit noch kurz vorm Tode seinem Weiberhause entlief, Tolstoi hat mehtr getan.
Bedeutung
Im Augenblick, wo eine Handlung noch etwas bedeutet, etwas anderes als sie selbst, hat sie ihre Triebkraft verloren. Sie kommt schon aus der Skepsis an ihrem Werte. Sie wird schon begonnen - nicht weil die Intensität keinen andern Auspuff mehr findet -, sondern weil alle mal gelegentlich aus Beschäftigunglosigkeit in Handlung machen. Die Geschichte der Handlung hört auf, es beginnt die Geschichte der Bedeutung. Die Bedeutung soll durchaus ihre Existenz rechtfertigen; sie soll sich von allen anderen Bedeutungen unterscheiden, sie wird überaus vornehm.
Hier erscheint die Originalität: die gemimte Rolle, als sei etwas geschaffen aus Intensität. Der Ausdruck tritt auf, man besorgt durchaus unterscheidende Merkmale. Und nun soll jeder ausnahmslos Beifall klatschen können. Etwas ganz Großartiges und Massives wird um das bißchen Geste herumgeknetet. Jeder, ja jeder soll sich Wichtiges denken können, was ihm gefällt. Der Zodiakus wird berühmt, die Frühlingspunkte sausen vorbei, die Sonne wird vom grünen Mond verschlungen, Planeten (keiner hat eine Gewißheit, man ahnt was dumpf) werden auf alles bezogen, die Milchstraße wird ausgebreitet. Irgendwo kömmt ein Messias. Höchster Typ der Bedeutung: ein Mythos wurde kalfatert. Wo nichts mehr lebend übrigbleibt, wo alle schimmligen Bedeutungshäute vom durchfressenen Gerippe der Tatenlosigkeit abfaulen, stets da kommt man uns mit dem dreckigen Schwindel vom Mythos.
O Babylon, Babylon.
Dreitausend Jahre sollen vergangen sein wie nichts. Wir sollen immer noch ahnen, raten, Geheimnisse verwalten. Nein. Wir geruhen nicht mehr unsere Ahnenseele zu bemühen. Wir waren nicht, wir werden nicht sein. Wir sind. Wir sind. Wir sind. Oder, zum Donnerwetter, wir existieren überhaupt nicht.
Eine Handlung ist sie selbst. Wir lassen sie uns nicht religionsverstiftern. Wir brauchen sie nicht zu verstehen. Es gibt nichts zu verstehen.
Wir wissen, daß die Handlung aus uns kam, und wir wissen immer, wohin sie geht. Wir wissen, wozu sie da ist.
Ein "Wie" hat die Handlung nicht, und keine Art, in der sie sich von einer anderen Gruppe Handlung unterschiede; die Handlung hat keine Erklärung. Die Handlung, dieses Selbstversändliche, ist in ihrem armen Wege (aus uns zum Ziel der Realisierung) ganz und gar in sich. Sie ist nichts mehr, als sie tut.
Nicht die Handlung ist zu verstehen. Nicht wir, die handeln, sind zu verstehen. Sondern der Standpunkt, von dem aus wir handeln, das Geistige - dies ist zu verstehen, zu erklären, bringen anderen Menschen mit allen Mitteln.
Der Zentralpunkt unseres Lebens wird hell. Es beginnt das Reich des Absoluten. Und dieser ungeheuerste Dynamikblock der Welt wird sichtbar: der Wert. Dann sind wir für den Geist Eiferer, Überzeugter, Belehrer, Beredner, Umtreiber, Umwender; verzweifelt, hochmütig, klotzig, schmeichelnd, ergeben, beweisend, erschütternd: Wir Änderer. Für den Geist allein sind wir das Ordinärste und Erhabenste, das man ausdenken kann; das Kümmerlichste, Lächerlichste, und die fürchterlichste Triebkraft an dieser Welt: Wir sind Partei.
Lassen wir das ewige Verständnis. Die gallerte Bedeutung zerfließt zitternd. Kümmern wir uns um unseren Standpunkt.
Seien wir Partei!
Änderung der Welt
Je geringer in Europa die Freiheit wurde, um so mehr geriet sie in Mißkredit. Wir wollen uns doch nicht selbst täuschen: Wichtiger ist die Freiheit selbst als ihre Definition. Jeder Mensch weiß in Wahrheit, was für ihn Freiheit ist. Weiß er es nur unklar? Das schadet nichts. Selbst in dieser Unklarheit kann er diesmal handeln. Innerhalb der vergangenen hundert Jahre ist aus dem großen Programm nur die Liberté uns geblieben. Bleiben wir zumindest bei ihr. Seien wir mutig genug, hier Spezialisten zu sein, Schuster, Klotzköpfe: arbeiten wir an der Freiheit. Es ist genug zu tun!
Zum Beispiel: die Erfolglosigkeit der internationalen Sozialdemokratie im Internationalismus kommt von der Beruhigungslehre, die sich auf Marx stützen wollte: die menschliche Gesellschaft gleite durch gradweises "Hineinwachsen" in den neuen Sozialismus. (Und nie zu vergessen: Alle Prophetie, alle Beschreibung im Marxismus ist schon lange vor dem Krieg falsch gewesen. Doch alle Forderung in ihm eine unermeßliche ethische Leistung!)
Ein furchtbares Sympton ist die Vernachlässigung der untersten, elendsten Gesellschaftsschicht. Der Unorganisierbaren. Der ganz Unbedingten, die nichts zu verlieren haben, der stets außerhalb Stehenden, zu jeder Änderung Bereiten, und die die unheimlichste, feinste Witterung für den Änderungsmoment haben. Das ist der Mob.
Man hat den Mob - das wundersüchtigste Gebilde der heutigen Gesellschaft - der Heilsarmee überlassen (weil man selbst nichts Unbedingtes, keine Wunder - hier in der Gegenwart: keine Änderung! - zu vergeben hatte). Das ist irreparabel. Wilhelm Weitling hatte noch ein schärferes Auge für diese Wirklichkeit als seine staatsfrohen Nachfolger, er hatte die Erstmaligkeit des Sehens. Kautsky, dessen Genauigkeit die unheilbare Vernachlässigung merkt, hat eine Hilfstheorie zum Zwecke der nun gebilligten Vernachlässigung des Mobs aufgestellt. Danach sei der Mob ein wenig wechselndes und unfaßbares Gebilde. Aber es ist zu erinnern, daß das organisierte Proletariat dem Kapitalisten vergangener Jahre genau so mystisch unfaßbar war, wie heute der Mob dem Organisierten.
Die Besitzenden haben Tradition. Der Mob hat nur eine: zu sein. Ob er sich "verändert" hat - und bezeichnenderweise sagt dieser fast geniale Popularisator hier nicht "entwickelt" -, kann auch Kautsky nicht wissen. Aber was wir alle wissen könne: die Reaktionsart des Mobs, seine Wirkungsfähigkeit hat ihre putschistischen Formen seit dem Altertum nicht verändert. Schließlich hat der Mob der Juden aus anarchischen Revolten das Christentum gemacht, für wilde, atavistische Gefühlsklänge von volksmäßig versunkenem babylonischen und iranischen Geister- und Prädestinationsglauben; gegen die aufgeklärten Sadducäer. Und die gesellschaftlich und kulturell elendeste Bevölkerungsschicht des endenden Mittelalters hat die Reformation gemacht, gegen die aufgeklärten Humanisten.
Also der Mob ist da und regt sich. So unfaßbar scheint er doch nicht zu sein, die Ruinen der Häuser, die er gebrannt und geplündert hat, sind ziemlich faßbar. Und, sonderbar, wenn die Regierungen ihn brauchen, bekommen sie ihn so sicher zu fassen, daß sie für manche gewünschten Wirkungen nur auf den Signalkopf drücken müssen.
Partei. Partei! Für die Freiheit! Es ist genug zu tun.
Methoden?
Zum Zwecke der Auspressung von Menschenkraft hat Taylor in Amerika ein System ausgearbeitet. In Hunderten amerikanischer Riesenfabriken wird seit langem jeder Arbeiter gemessen, im Detail seiner Arbeit genau beobachtet, kinematographiert, in den Resultaten seiner Arbeit sukzessive kontrolliert. Jeder einzelne von Hunderttausenden.
Beweis: daß man auch in großen Volksmassen wirklich zu jedem Individuum gelangen kann. Der Erfolg des Taylorsystems kommt von seiner Wahrung eines Standpunktes. Es ist der Standpunkt des reinen Nurkapitalismus, unter dessen Druck jene konkrete, doch noch hinreichend allgemeine Arbeitsindividualformel ausgegeben wurde.
Aber zu erstreben ist: Der Ersatz jener Besitz-Macht-Kapitalisten-Abenteuer-Endabsicht durch eine rein geistige Endabsicht. Rein geistig, das sagt, von mächtiger Triebkraft (keine evolutionistischen Surrogate). Etwa auch nur ein winziges Wunschtum Freiheit; ihre Konkretisierung: Unabhängigkeit. Und eine individualisierende Aufklärungsarbeit in den Massen, geschult an der rapiden Riesenformel des Taylorsystems.
Welche Resultate!
Zu Anfang des neunzehnten Jahrhunderts steht die bewegende Politik unter dem Druck der Nationalidee. In der zweiten Hälfte unter der Rassenidee. Am Ende bis in diesen Krieg dominiert die Staatsidee und verschlingt die beiden andern oder speit sie nach Bedürfnis aus.
Ist es nicht höchste Zeit, sich über die völlige Gewesenheit dieser drei Ideen klar zu sein! Mit ihnen kann man sich die Erde immer noch nur so platt wie eine gemalte Landkarte denken. Sie schließen keine Spur der Vorstellung in sich, daß wir auf einer Kugel leben, und daß wir alle gegenwärtig sind; daß unsere Handlungen nicht bloß physikalisch natürliche Linie, Druck und Gegendruck sind, sondern in einem Moment gleichzeitig überall auf der Erdkugel - die ... von ... Menschen ... bewohnt ist ... - wirken.
Merkwürdig, die realen Hilfsmittel der "großen" Politik stammen aus unserer Zeit, aber ihre Absichten aus dem Mittelalter. Das Mittelalter führt die Kriege.
Höchste Zeit, daß die Erdgenossen sich auf ihr Erdentum besinnen.
Tellus = die Erde. Tellurismus = die Erdkugelpolitik. Aber wir können nicht länger warten.
Was sind Sie? - - ich bin Tellurist!
Es geht ja nicht um Gefühle.
Es geht nicht um Sterne, nicht um die Vergangenheit, nicht um Unsterblichkeit. Nicht um Ruhm. Nicht um Unendliches; es geht nicht einmal um die Zukunft. Lassen wir doch das Pomposo. Es geht nur um unsere kleine Erde. Es geht um die gegenwärtigste Gegenwart.
Wir haben ja noch alle versäumt. Wir sind zu vornehm. Wir sind Ökonomiker, Ausbeuter, Ausgebeutete, Entwicklungsgläubiger, Zukunfts-Symboliker. Wir sind ja immer noch Erben.
Wir sind noch nicht Politiker. Muß nicht dies unsere erste, einzige Absicht werden? Direkt sein. Handelnd, ändernd. Hebel sein. Politisch sein!
Wir rechtfertigen uns zu wenig vor unserer geistigen Herkunft. Wir lassen uns noch alles, alles vom Fatum bieten. Wir sind tot - - oder noch zu beruhigt mitten in allem; noch nicht genug außerhalb. Sind wir Gegebenheitsgewebe um uns? Wir sind noch nicht ausgestoßen genug. Handlungen geschehen wider erste, tiefste, entschiedenste Tatsachen unseres Erdendaseins. Wir sind noch zu eifrig gefällig, zu sehr Psychologen, zu verständnissinnig. Wir vergaßen ganz unser eigenes Wissen von uns selbst. Unseren Standpunkt. Unsere Freiheit zu urteilen. Selbst zu handeln, zu hebeln, zu ändern.
Kameraden, stehen wir nicht im großen Bund des Geistes? Sind wir nicht Geschütz und Sprengstoff zugleich? Sind wir nicht freie Flammen, zuckend und heiß genug, Totes zu zerstäuben, Hartes zu schmelzen, diese Welt flüssig zu machen. Sind wir nicht Geistige, um alle feurigen Flüsse in den Bund des Geistes zu gießen!
Mit unserer Geburt bekamen wir die Gabe, die Welt zu ändern. Ändern wir. Ja, bessern wir, ganz simpel. Irgendwo höhnt ein quietistischer Idiot: "Weltverbesserer?" O Freunde! Freunde, die ihr wirklich da seid. Die ihr noch nicht zu sprechen wagt. Freunde! Hier ist unser Ehrenklang, unsere Fahne, der Salut unserer Brüder. Hoc signo.
Seien wir Weltverbesserer, alle. Wir haben es nötig.
Vielleicht wird dann kein Genießer mehr unsere Toten mit ihrem "Erlebnis" überrumpeln. Nieder das Erlebnis! Wir haben genug.
Seien wir Politiker, trocken, hart, listig, gütig, erschütternd. Verantwortlich für alle Menschen unserer Erde.
Und ein Physiker wird uns sagen, daß Flammen nicht nur brennen, sondern auch singen können.
[1916]
Brief an ein Orchestermitglied der Gura-Oper
Mein Herr,
vor einiger Zeit las ich im "Berliner Börsen-Courier" einen offenen Brief von Ihnen, den Sie gegen die Kritik einer hiesigen Musikzeitschrift richteten. Ihr Brief, den ich aus den verschiedensten Gründen für recht interessant halte, war ein wenig nach dem Muster der Schulaufsätze, wie man sie vor vielen Jahren hielt, geschrieben, nur mit umgekehrtem Sinn. Sie wiesen zuerst die Behauptungen des Musikkritikers zurück. Einleitung mit dem Tadel des Autors - machten auf Ihre bekannten Verdienste als königlicher Kammermusiker aufmerksam - Captatio benevolentiae - und schwenkten darauf plötzlich etwas überraschend zum Lobe der Gura-Oper ein, die Sie engagiert hat.
Schluß mit der Bitte um die Nachricht des Lesers. Man kann nicht sagen, daß Ihr Brief gerade von einem geschickten Polemiker stammte, und darum will auch ich mich nicht auf eine Polemik mit Ihnen einlassen. Ich habe kein anderes Bestreben, als mit Ihnen eine kleine Weile auf der schönen Basis einer gemeinsamen Verständnislosigkeit zu stehen. Mit andern Worten: denken wir mal ein bißchen aneinader vorbei!
Die Kritik, gegen die Sie sich so scharf wendeten, stand in den "Signalen für die musikalische Welt", ich habe sie auch gelesen, ich muß sagen, sie gefiel mir sehr gut, und ich werde Ihnen auch gleich sagen, warum. Der Kritiker schrieb über eine schlechte Wagneraufführung, und er setzte nicht nur das bloße Urteil hin, sondern er beschrieb die musikalische Struktur dieser Unzulänglichkeit. Er sagte dabei etwa: "Diese Baßtrompete erging sich in ihren eigenen Phantasien." So ungefähr. Und da will es das Geschick, daß Sie diese Baßtrompete spielen, gerade Sie, ein alter erfahrener Kammermusiker von Namen.
Und Sie wollen nun diesen Anwurf nicht Ihrer Baßtrompete in die Schuhe schieben lassen, denn Ihre Baßtrompete fußt auf den vielfachen Erfahrungen, mit denen Bayreuth ihr unter die Arme gegriffen hat.
Ich glaube nun, daß Sie sich in einem beklagenswerten Irrtum befinden, wenn Sie annehmen, der Kritiker der "Signale" habe gerade gegen Ihre Baßtrompete eine Lanze eingelegt, selbst wenn keine andere im Orchester sitzt.
Es ist schwer, Ihnen begreiflich zu machen, wenn in jener Kritik von den "Phantasien der Baßtrompete" die Rede war, daß es sich da wieder um Sie noch um Ihre Baßtrompete noch überhaupt um ein bestimmtes Instrument handelte. Ihr Herren Musiker wollt es nie einsehen, daß Ihr uns, die wir vor dem Podium sitzen, vollkommen gleichgültig seid. Wenn wir merken, daß einer von Ihnen falsch spielt, hassen wir ihn nicht einmal, sondern uns widert nur der Typus der Patzers an.
Ich bin vollkommen überzeugt, daß Ihre Baßtrompete ihren Part durchaus exakt gespielt hat, und ich glaube sogar, ohne den betreffenden Kritiker befragt zu haben, er meint dasselbe.
Aber bedenken Sie doch, es handelt sich ja gar nicht um Sie, weder um Ihre Virtuosität noch um Ihr Instrument noch um Ihre polizeiliche Legitimation, weder um Ihre Familie noch um Ihre Taschenuhr noch um Ihr Ansehen. Niemand, der diese Kritik las, sagte sich: "Aha, die Baßtrompete erging sich ... das ist ja Herr P. so so!" Niemand. Auch der Herr Kapellmeister Stransky oder der Herr Direktor Gura ist uns Zuschauern nicht mehr als eine Türklinke. Wir schätzen ihre Persönlichkeiten weder hoch noch gering, wir schätzen sie überhaupt nicht. Sie sollen uns zufrieden lassen mit ihren Persönlichkeiten, wir wollen einen Eindruck.
Noch mehr, er wollte den Eindruck nicht nur haben, sondern ihn sogar wiedergeben. Bitte, mein Herr, seien Sie ihm einmal dafür dankbar! Die Herren Künstler, wenn sie nicht gerade gelobhudelt werden, beklagen sich ja immer darüber, der Kritiker gebe so von oben herunter ein beliebiges Urteil ab, ohne irgendwelche Gründe anzuführen. Gründe? Gründe können es unmöglich sein, wenn festgestellt wird: "Fräulein Enghals hat das Fis im drittletzten Takt der Coda detoniert gegeben." Das kann man glauben und bleibenlassen. Die Gründe des Kritikers können nur aus seiner Darstellung des Eindruckes hervorgehen.
Darstellung - wissen Sie, was das ist? Jedenfalls nicht etwas, das vor Gericht eidlich beglaubigt werden kann. Die Darstellung des Kritikers ist, mein Herr, Zusammendrängung aller Empfindungen der Masse im Zuschauerraum. Sie ist ein Bild, gefunden von einem Begnadeten, dem die Gabe verliehen ist, das, was alle im Parterre fühlen: zu denken.
Sie ist - bitte suchen wir uns endlich zu verständigen - ein Vergleich. Ein Vergleich, der erstrebt, die Geschehnisse aus Ihrer Kunst zu erzählen, wie man von Geschehnissen des Lebens spricht. Erfahrung in der Kunst umgesetzt in Erfahrung des Lebens.
Vielleicht stimmen Sie jetzt mit mir darüber überein, daß die Bedeutung des Kritikers, auch des harmlosesten Zeitungskritikers, zu allen Zeiten nicht in der Befriedigung oder dem Ärger des Künstlers über seine Endurteile liegt. Auch nicht darin, wie man früher selbst von klugen Leuten hören mußte, das Publikum auf etwas besonders Gutes oder Schlechtes aufmerksam zu machen. Diese Werte mit Tadel oder Lob sind doch nur Angelegenheiten der Sensation. Vielmehr sorgt der Kritiker dafür, daß das Publikum die Angelegenheiten der Kunst genauso empfängt wie Angelegenheiten seines Lebens und daß es sich mit derselben Entschiedenheit und demselben Willensaufgebot zu ihnen zu stellen hat.
Wenn der Kritiker, mein Herr, Ihre Kunst nicht mit irgend etwas aus der Erfahrung des Lesers vergleichen würde, dann wüßte der Leser gar nicht, wie wichtig Sie sind. Indessen weiß ich wohl, es ist Ihnen lieber, nicht verglichen zu werden. Ihr Herren Künstler wollt am liebsten lesen: "Außerordentlich hob sich in dieser Tristan-Aufführung der Herr Kammermusiker P. hervor. Seine prachtvoll sonor klingenden Töne, die besonders in den schwierigen Lagen ..." - Aber sagen Sie mir doch, woher es kommt, daß ich hier Dinge reden muß, die für jeden meiner Leser schon längst selbstverständlich sind; nur die Herren Musiker haben immer noch keine Ahnung!
Vielleicht jedoch sind wir jetzt so weit, daß Sie einsehen, wie der Kritiker der "Signale" die "freien Phantasien der Baßtrompete" gemeint hat. Er meinte natürlich nicht Ihre Baßtrompete oder das Fagott eines Ihrer Kollegen. Sondern er vermittelt seinen Lesern die instinktive Erkenntnis, daß Ihr Orchester wackelte, darum, weil es in seinen Grundlagen wackelte. Seine Grundlagen, mein Herr - bitte fühlen Sie sich geschmeichelt - , seine Grundlagen sind jene tiefsten Instrumente, denen Sie anzugehören die Ehre haben.
Sie und dieser oder jener Kollege können sehr wohl traumhaft sicher gewesen sein - tut nichts: Durch Beziehung auf Ihr schönes und gewaltiges Instrument dringt dem Leser etwas von den mächtigen Fundamenten des Orchesterklanges in die Phantasie. Ich glaube, wir sind einig: Wenn der Kritiker von den freien Phantasien der Baßtrompete sprach, so wollte er Sie persönlich sicher nicht treffen, sondern er hat dem Publikum durch ein einziges kleines Sätzchen den besonderen Lebenseindruck eines etwas wirren Orchesterabends Ihrer Sommeroper vorgeführt.
Diese Sommeroper verteidigen Sie nun aber im Schluß Ihres Briefes, und ich muß sagen, ich habe das sehr töricht gefunden. Sie sind doch ein Mann mit Erfahrung, und Sie wissen doch, wie ärmlich und gebrechlich es wirkt, wenn einer öffentlich Apologien eines bedenklichen Institutes singt, der dort durchs Honorar an die kontraktliche Meinungsbeschränkung eines Angestellten gebunden ist.
Sie werden mir entgegnen: Dieses bekannte kontraktliche Verbot, sich öffentlich über Angelegenheiten Ihres Theaters zu äußern, hat der Direktor Gura in diesem bestimmten Falle aufgehoben. Aber gewiß, ich glaube Ihnen das nicht nur blindlings, sondern ich bin sogar der Ansicht, daß Herr Gura Sie höchst freigebig mit seiner eigenen Meinung über seine Sommeroper unterstützt hat. Es ist ja längst bekannt, daß Herr Direktor Gura eine außerordentlich gute Meinung von seiner Sommeroper hat, eine so gute sogar, daß in Ihren Premieren Zischer rausgeschmissen werden. Dieses war der erste kühne Aufschwung zur Schmiere.
Ich will aber Ihrem Direktor Gura gern bestätigen, daß seine Zeltzirkuspraxis originell ist: zur Erhöhung der gedrückten Publikumsstimmung Siegfried-Wagner-Soupers zu populären Preisen. Waren Sie, mein Herr, schon mal in Amerika? Da gibt's kleine Wandertheater. "Heute abend: Die Jagd auf den Höllenklub. Jeder Besucher erhält ein Cotelette miz zwei Kartoffeln. Der Autor trägt selbst die Speisen aus!" Wir haben bis jetzt geglaubt, der Herr Direktor Gura wolle mit seiner Sommeroper den Typus "Wagner-Schmiere 1913" geläufig machen. Wir haben ihn unterschätzt: er meinte Siegfried-Wagner-Schmiere.
Erklären Sie mir nur, wie können Sie, ein feiner und geschätzter Musiker (also doch wohl ein Mann von künstlerischem Empfinden?), wie können Sie die üble Unfertigkeit der Gura-Vorstellungen mit den Schwierigkeiten des Materials, mit dem ungeübten Orchester, den zu geringen Proben der Sänger verteidigen? Das ist es ja gerade, was die Berliner ärgert: ungeübtes Orchester, zu wenig Proben.
Ihr habt jetzt da drüben den "Tristan" so lange zu "gewöhnlichen" Preisen dem Publikum vorgespielt, bis er endlich glatt sitzt. Aber warum habt Ihr uns die vielen "ersten" Vorstellungen nicht erspart? Wir hatten das Recht, nur in dieser einen, guten Aufführung zu sitzen! Ihr führt den Richard Wagner auf mit allem Donnerblechgeknatter einer Liebhaberbühne, ganz bedenkenlos. Und kaum hat man Euch die Güte der "Tristan"- Aufführung attestiert, so setzt Ihr erhöhte Preise an. Es gibt ja im Sommer immer noch genug Leute, die im Winter nicht in die Oper kommen!
Sehr geehrter Herr Kammermusiker P., Sie haben den Wagner nicht bloß unter Richard Strauss, unter Muck, unter Blech mitgemacht; Sie saßen auch in Bayreuth im Orchester, sie bliesen noch unter den alten Dirigenten der ersten Wagnerschule - Sie sollten sich doch ein bißchen genieren, den Schwierigkeiten eines Sommeropern-Wagners Blümchen zu pflücken. Also, ich finde, dieser Teil Ihres Briefes schickt sich nicht recht für Sie. Wenn ein altes Mitglied der Königlichen Kapelle mit solcher Mühelosigkeit öffentlich irgendeinem Sommerdirektor zum Munde redet, dann muß uns die Königliche Kapelle komisch vorkommen.
Ob Ihre Kollegen vom Opernhaus nun gerade Ihre Meinung vom Vorstadt-Wagner im Tiergarten teilen: weiß ich nicht. Sagen Sie selbst, war das richtig von Ihnen? Ich verstehe Ihre Feindschaft gegen den Kritiker der "Signale", auch wenn sie unsinnig war. Ich habe in diesem Punkte es nicht für nötig befunden, mit Ihnen zu polemisieren, sondern Ihnen nur erklärt, worauf der - mir Fernstehende! - hinauswollte.
Ich will Ihnen gerne rasch die Summe ziehen: Ihre und die Person Ihrer Kollegen, Ihre Mühen und Empfindungen sind dem Publikum und dem Kritiker völlig gleichgültig. Denn so herzlos sind wir, wenn wir Publikum sind! Wir wollen einzig und allein den künstlerischen Eindruck, und der Kritiker will wieder einzig und allein den Eindruck dieses Eindrucks geben. Der Leser findet sein Urteil in den Vergleichen des Kritikers.
Hier gibt es keine Polemik, sondern nur eine Erklärung. Wenn Sie die verstanden haben, dann werden Sie finden, daß in ihr übrigens auch schon die selbstverständliche Ablehnung Ihrer Verteidigung des Gura-Rummels, der ja in diesen Tagen sein Ende haben wird, enthalten sein muß.
Mit der höflichsten Distanzierung der Gegensätze Ihr, unbekannterweise, sehr ergebener Ludwig Rubiner.
Rosenkavalier
Bevor sich das Theater verdunkelte, stieg mein Misstrauen gegen Richard Straussens neue Oper rasch immer mehr. Es wuchs schwindelerregend, als die Lichter erloschen und das Vorspiel beginnen sollte; und es wurde so schmerzhaft wirr, dass vor mir in der dunklen Loge der noch matt leuchtende Halbkreis der vier Ränge wimmelnd und beängstigend in die Höhe schnellte, wie ein Turm von Babel in Silber und Gold auf dem Bild eines alten Venezianers.
Und noch in der letzten Sekunde des Wartens wurde ich boshaft. Ich war überzeugt, komische Oper bedeute bei Richard Strauss ein knackendes, wackelndes, stampelndes Orchester, in das der Sänger verzweifelt wotanhafte Textworte hineinintervallt. Ich ersparte mir keine Bosheit. Und ich fragte mich: Angenommen, durch irgend eine wunderbare Fügung sässe hier im Parkett der Dresdener Hofoper ein Mann, nun, aus Houndsditch. Was spürte der vom "Rosenkavalier".
Ich bekämpfte ein unbekanntes Stück Luxuswelt mit Gründen, denen es unmöglich gewachsen sein kann.
Über die bisher bekannten Werke von Richard Strauss zu sprechen ist mit ein wenig farbender Reporterphantasie nicht schwer. Glaubwürdiges über den "Rosenkavalier" zu sagen ist fast unmöglich. Jeder von uns hat ein bestimmtes Klangbild in der Phantasie, wenn bisher der Name Strauss genannt wurde: die zerteilende, verästelnde Orchestertechnik von der subtilen Prägnanz eines modernen Fabrikbetriebes, und gleichzeitig mit dieser Geschicklichkeit primitiv kindische Barbareien, musikalische Holzhauerkultur; grobe Eindeutigkeiten von thematischen Beziehungen, plumpe, psychologische Anzüglichkeiten einer schildernden Musik aufs Wort des gesungenen Textes. Alles gelegentlich akzentuiert von einem ungewohnten Klang, an dem vielleicht eher die Seltenheit als die Neuheit reizte. Ein Mann, der in seiner Kunst nicht Zusammenhang, sondern Verschiedenartigkeit sucht. Der, als Künstler, den farbigen Inhalt jeder einzelnen Sekunde des Lebens für unendlich gross hält, für ewig wertvoll und für unwiederbringlich. Ein Abenteurer des Moments.
Und vom "Rosenkavalier" musste ich ganz überrascht sein. Seine Kunst liegt auf anderen Lebensgrundlagen. Aber wird man mir glauben?
Die Formen der Musik sind von den Formen des realen Lebens so unendlich verschieden, dass sich jede Beziehung auf die Wirklichkeiten des menschlichen Gefühlslebens nur durch die höchst geistige, umsetzende und übertragene Deutung in musikalische Formen äussern kann. So hört man im "Rosenkavalier" Anklänge an jeden Stilausdruck, den die Oper des neunzehnten Jahrhunderts gekannt hat. Aber gelöst und einbezogen in das leuchtende Atmen der Strauss'schen Harmonisierung wirkt die Verschiedenartigkeit der Stilformen auf uns nur noch rein menschlich und persönlich, etwa wie der natürliche Ausdruck einer grossen Lebenserfahrung. Die vielen Male, in denen hier der Gang der Singstimmen in die Tonika ausläuft, rufen immer sofort bei Strauss den Eindruck einer merkwürdigen Höflichkeit hervor, fast von Verbeugung und Verbindlichkeit der Stimmen untereinander, des gegenseitigen Platzlassens. Und jedesmal wenn diese Musik in eine ältere Stilform gleitet, dann erscheint eine Atmosphäre von merkwürdig neutraler Gefälligkeit, die Luft eines Verkehrs in Traditionen. Und diese Ensembleszenen verbreiten um das Werk die eigentümlich unpersönliche Herzlichkeit, die in der spielerischen Magie der alten komischen Oper lebt.
Diese Musik drückt schwebend, leichthin, gleichmutig aus, wie überpersönlich das ganze Leben ist, wie voller Takt gegen die Umwelt; wie gleichgültig der einzelne Moment: Kultur. Darüber strahlen zeitweis sanft und weit geschwungene Melodienbrücken, wie noch kein Komponist so riesig sie gebogen hat. Aber wird man mir glauben? Solche Bändigung hat niemand von Strauss erwartet. Und die Musik hat nun auf ein Rokokostück Hofmannsthals zu gelten.
Man verwirre die Angelegenheiten der Bühne nicht: der Text einer Oper hat gar nichts mit den seelischen Bedingungen des Dramas zu schaffen. Sein Stil ist nur aus dem Material gewonnen (Material gegeben vom Zusammenwirken der Scene und der Musik). Der Operntext ist Kunstgewerbe der Dramatik. Hofmannsthal hat aus dem Kunstgewerbestück des "Rosenkavaliers" weder Kunst noch Handwerk zu machen gewagt. Handwerk ist es, wenn die Handlung ins Rokoko verlegt wird; in der sicheren Voraussicht, dass die Marquisenbegeisterung, die in der Literatur schon abgewirtschaftet hat, nunmehr in weitere Kreise des Publikums gedrungen ist.
Handwerk ist die saubere Leistung reinen Philologenfleisses, ein Dialektstück zu schreiben. Kunst ist die Anlage des Stückes in den Personentypen der romanischen Komödie.
Aber der Ochs von Lerchenau fällt aus diesem Stil: dieser Rokoko-Kandaules, dem es gleich ist, ob seine Braut scharmuziert, wenns nur mit einem Adligen ist - das ist schon ein Mensch. Indes weder dieser Mensch, noch die Typen äussern irgend einen Willen, der zum Mittelpunkt des Stückes würde. Die ganze Handlung entwickelt sich allein aus der Verlegenheit aller Personen in jeder Situation. Und in diesem eigentümlichen Zug, der zum allerschlechtesten Handwerk gehört, zeigt Hofmannsthal, dass in ihm wirklich unausrottbar etwas lebt: ein unterdrückter Romandichter mit Milieutheorie.
Ach, es war schon lange vor dem "Rosenkavalier", da wollte ich eine "Grabrede auf Hofmannsthal" halten. Ich wollte an ihm das Gesetz für die Dichter zeigen: gehen zu müssen, wie man einst gekommen ist. Ich wollte auf eine ergreifende Art davon reden, wie dieser Dichter des Moments einen schrecklichen Tod gestorben ist, den Tod der Leere: nicht erkämpfen zu können, was er nicht mitgebracht hatte. Aber lassen wir das.
Vielleicht glaubt man mir mittlerweile, wie bedeutend die Musik von Richard Strauss ist. Behindert durch allerlei negative Handlungen des Textes wird diese Musik vom schwebend leichten Flug nur zum ermüdungslosen Dahingleiten gemindert; aus feuriger Grazie entbindet der Text eine gewisse liebliche Schwerfälligkeit. (Und die Dresdener Hofoper macht das mit dem hellen, springenden Willen des Lustspiels auf der Bühne - den Hofmannsthal nicht kennt; einer Beweglichkeit der Darstellung von fast romantischem Takt. Der selbstverständlichsten Einheit von Bühne und Musik - wie eine Zusammengehörigkeit der Instrumente im Kammerquartett!)
Aber was geht das uns an, ob die neue komische Oper gut oder schlecht ist, ob gewisse Kritiken geschwindelt haben, oder andere ungerecht sind? Über Musik wird zuviel geschrieben. Aber in Deutschland erschöpft sich die Kritik über Werke der Musik im Austeilen von Zensuren, und so muss man immer wieder die primitivsten Grundlagen der Musik zu entwirren suchen. Immer wieder, obgleich man weiss, dass die Musik den Deutschen verdummt, und die beste Musik am meisten. Und dass die deutschen Musikliebhaber schmutzig, trüben Auges, hartherzig und taktlos sind.
Doch wieviel muss diese Musik bedeuten, wenn sie, hinaus über die leuchtende, sanfte Wollust des Einzelnen, ihre Formen noch von der Kultur unserer Zeit sprechen lässt! Denn mehr vermag die Musik der Oper nicht. Auch die Sprache dieser Formen wird zu unserer Zeit nur innerhalb ihres Kulturkreises laut. Und für einen Mann, etwa aus Houndsditch haben diese Formen der Musik erst lange Jahre später Verständlichkeit und Bedeutung.
Kultur, Musik und Pfitzner
Das Glück und Unglück der Künstler ist, dass ihr Daimonion und Schaffendes droben in einem himmlischen Jerulasem wohnt, wo nichts mit den Angelegenheiten des Menschen zu tun haben muss. Welch ein Fall, wenn die Schöpfung des Mannes auf seine eigene menschliche Form stösst, in der er geht, tanzt und fühlt. Und welches ungeahnte, überzeitliche Glück der Nationen, wenn in dieser imaginären Stadt zwei ganz getrennte Persönlichkeiten - der Musiker und sein Stoff - sich wirklich begegnen.
Dann gibt es auch Himmelsquartiere, deren Strassen Labyrinthe sind, man findet den eigenen Weg nicht wieder, man begegnet niemandem, nur drüben fern hört man das Geräusch und die Rufe Fremder. Dies ist die Tragik des Künstlers. Und das ist auch die Tragik Pfitzners, dessen menschliche Konflikte rührend und sympathisch sind, aber nichts gegen jene tödlichen, deren Quellen in ihm selber liegen.
Pfitzners Musik ist Glanz, Strahlen, Feuerwerk und Klugheit - deren er sich tief schämt. Aus der Scham, dass ihm alles so virtuos und prasselnd gelingt, kommt die Hemmung. Die Hemmung des Genierens, umgewandelt in musikalische Form wird zu Themen, die für Pfitzners Ohr volkstümlich, nach deutscher Romantik, märchenhaft klingen.
Pfitzner ist erschüttert, zerrissen, ein Verstörter vor lauter angeborener Leichtigkeit. Er hat mit diesem höchst persönlichen Konflikt soviel zu schaffen, dass ihm nicht viel bleibt, auch etwas für die Musik zu tun. Das ist herzergreifend: er kann erfinden wieviel er mag - es klingt nie neu, sondern immer wie Spezialistenarbeit mit Brillanz über lang Bekanntes. Glauben wir nicht an die deutsche Romantik Pfitzners, lassen wir uns nichts von der Märchennatur einreden - welche übrigens nicht unbedingte Erfordernisse für eine Kultur sind.
Aber bei ihm geht es bunt exotisch zu: Er ist eine Tschaikowsky-Seele und will Kunstwartbilder komponieren. Diese "Rose vom Liebesgarten", deren ersten Akt Oscar Fried in Berlin spielte, führt in ein Haus mit verdumpfender Atmosphäre. Im Garten Zwerge aus Terrakotta vor Märchengrotten aus Kunststein, in den Zimmern vlämisch-imitierte Möbel, auf dem Paneelsofa ein Kissen "Nur ein Viertelstündchen", auf den Etagèren Barocknymphen aus Porzellan - im Nebenzimemr, schon versteckt, aber doch im Nebenzimmer der Trompeter von Säkkingen hinterm Schrank.
Bräunlich graue Musik von Carl Löwe, ein Eindringling spielt mal ein Thema von Brahms, dass die Pianinolampen wackeln. Und über alles breitet sich das zähe Licht der Orchesterfarben Richard Wagners. Es ist Musik aus der Gründerzeit. Pfitzner, der seine moderne und stark neurasthenische Virtuosität verheimlichen will, zwingt sich zu Werken, deren "Tiefe" und Gefühlsform um fünfundzwanzig Jahre zu spät kommt. Da aber die deutsche Musikkritik in Bemühung, Einsicht und Stil um mindestens dreissig Jahre hinter unserer Kultur zurückgeblieben ist, so kommt er immer noch früh genug.
Samt dem musikdramatischen Text, dessen Gestabreimtes man am treffendsten auf Sächsisch deklamiert hören würde, und in dem Elfen, Kobolde und die unvermeidlichen Hüter diverser Symbole aus Hans Thomas Gemälden eine grosse Rolle spielen. Warum führt man dies nicht auf? Wie unverständig, diese Musik ist durchaus hoftheaterfähig. Sie hat eine fabelhafte Virtuosenbrisanz mit der Waldhornsehnsucht nach dem Jägerhemd. Während man gegen den "Freischütz" viel haben kann, und ihn doch nicht zu den Bildern von Ludwig Richter rechnet. -
Welch lächerliche Verwirrung, Chaos der Trottelei, Unglück der deutschen Kritik: Schon sind wir aphoristisch auf dem Sprung, Richard Strauss als Reaktionär vor neuen musikalischen Formerkenntnissen zu erklären, und mit Pfitzners volkstümlich gehemmter Buntheit muss man sich immer noch auseinandersetzen. Ist das etwas Neues? Menschen mit musikalischem Takt im Leibe wissen es längst. Man muss es öffentlich aussprechen, damit die zaghaft Erkennenden sich nicht von dem Jubelgebrüll der verschwommenen Psalmodisten erstickt fühlen. Es war nötig, dass Frieds Mut in Berlin die Klärung herbeigeführt hat.
Davor spielte er Busonis bescheidene Bühnenmusik zu Gozzis Turandot. Vorstadt in einem unwahrscheinlichen Süden - nicht Venedig, unbereister. Verquetschte Häuschen mit gelbem Lichtschein in riesiges Blau, Laubengänge aus Stein. Irgendwo unsichtbare Felsen, Steinbrüche. Ochsenkarren, drinnen liegt ein Kerl und singt, lang auf einem Ton. Die zwei Räder knarren. Noch zwei Töne, dann ballt sich das blaue Schimmern zusammen, wirft sich zwischen die Töne: hinauf, unerwartet ein Ganzton. Intervall des Unbedingten, Hinausfliegenden.
Gläserne Unendlichkeit. Dazu knarren die Räder des Karrens. Im Zimmer unter funzeligem Ölschein spielt einer auf den gelbgeschlagenen Tasten Bach, aus dem brüchigen Rest der Töne plinkert dünn eine strenge Passacaglia, draussen singt der Mensch im Karren und die Räder krachen. Dies ist etwas von Busoni; unexotisch und gerad so unchinesisch wie der Gozzi selbst. Töne aus einer südlichen Heimat, so tief heimatlich, dass sie märchenhaft phantastisch klingen. Zuletzt fassen sich im Dunkel die Menschen an den Händen und springen mit Lichtern durch die Nacht im Kreis auf und nieder, an den Wänden schiessen die Schatten durcheinander.
Pfitzners Protzengemüt und Busonis Kultur, wer wüsste davon in Berlin, wenn nicht Oscar Freid den Mut hätte, alle paar Wochen für unbekannte Musik vor einem gemieteten Orchester zu stehen. Das Gefühl hineintauchen zu lassen in jede Stimme der Partitur, zugleich den Geist hinaufpeitschen zur bereitesten Überlegenheit über die Mathematik der musikalischen Form. Jeden Orchestermenschen immer von neuem zu formen nach seinem Bilde, ihn zu füllen mit dem Blute des Dirigenten. Das Ergebnis: Zwei Abendstunden leuchten. Der Hörer tritt in die Nachtluft hinaus, alles ist vergessen ...
Pelleas-Sinfonie
Menschen mit grossem Verantwortlichkeitsgefühl sind von der Musik auf der Hut. Diese Kunst ist zu grossartig, sie erreicht zu viel, sie gibt das letzte zu schnell. Auf die müheloseste Art kann man vorm Orchester sich auflösen in einen beziehungslosen Molekülenkomplex, zurückverwandeln sich in eine ahungsvolle Urzelle, helles Licht auf dunklem Grunde sehen: So flink wie ein Neger in den Moment der Extase schlüpfen - um deretwillen vielleicht ein Riese Dostojewski Epileptiker sein musste, vorm Erschiessen stand, in Sibirien war, und die Welt um sich in eine polyphemische Höhle verwandelte.
Die Musik schenkt uns zu viel: Rasend fahren wir hinab in einen finster zitternden, undurchdringlichen Urgrund, in dem sich alles löst. Aber wenn dies vorbei ist, erwachen wir daraus mit erstorbenen Augen in grünlichen Gesichtern.
Doch gibt es ein paar Werke der Musik, in denen wir Menschliches spüren: Wenn der Komponist die Fahrt verlangsamt, uns ringen lässt um das letzte Geschenk. Eine Pilgerfahrt von Kämpfen uns auferlegt, unseren Willen wach jagt. Auf dem Wege, den die Musik unserem Willen aufzwingt, fühlen wir, scheinbar ganz nebenbei, dass eine unsichtbar ungeheure, noch unbekannte Körperlichkeit um uns erschaffen wird. Alle grosse Musik hat dieses Raumgefühl. Aber wir können nur übertragen und umschreiben: Die Mauern der Aussenwelt versinken, der innere Saal ist offen.
Arnold Schönbergs Sinfonie zu "Pelleas und Melisande" setzt an mit dem Thema einer finsteren Unwirklichkeit; ungreifbar unsicheres Schattenbild von Themen, die einst irgendwo in der Musik gelebt haben. Was in der fassbaren Welt der Musik vielleicht ehemals nur Accent war, spiegelt sich hier von dunklen Schleiern umflossen, als Brücke, ausgestreckt in Traumlänge, für die kantig jähen Traumstrassen von Tönen.
Darnach können wir noch aufstehen und aus dem Konzertsaal gehen. Aber kaum wir bleiben, ist uns alle Freiheit genommen. Das Orchester baut sich zur zitternden Finsternis einer dunkel schwankenden Mauer - so wachsen Häuser im Traum. Davor liegen wir, wie irgend ein kleiner formloser Knäuel, hilflos, regungslos, seelenlos. Die Stimmen teilen sich, öffnen sich uns; wir werden aufgeschluckt winzig klein und nichtig, und wir müssen den Weg der Instrumente machen, ganz vor uns verschwinden, augenlos hinabtauchen in tiefe Gänge.
Durch Stimmkreuzungen, über Barrikaden dissonanter Noten müssen wir die Bahn erzwingen. Mit dem Orchester aufwachsen aus unbekannten, undurchsichtig steinernen Regionen der Bläser, als Streicher schleichen in weiten kreisenden Schleifen einer fremden moluskenhaften Vegetation. Schrill fliegt ein Riegel auf, heiss stürzen wir rasend hinunter in ein dunkles Land mit unglaubhaften langen Sprüngen des Träumenden. Marschtakt strömt in alle Instrumente, wilde, schnelle auf-und abfliegende Zackigkeit, luftig in ungreifbaren Zerrungen; wie Marschmusik, die uns nur ihre Abbilder in die Entrücktheit eines Fiebers sendet.
Dies stösst alles zusammen, schlingt sich in klammernder Wut um einander, die Stimmen saugen sich fest, alles stockt, schwillt an, zerplatzt in trüben Erschütterungen des Hasses. Strahlende Ruhe, darinnen wogt eine Tiefe wie in der Flamme der dunkle Kern. Die Dunkelheit schwillt auf wie ein grosses Maul, schreiend stürzt alles hinab in die schwarze Nacht. Zu Ende scheint eine bleich finstere Unwirklichkeit im schwachen Licht. Ungreifbar unsicheres Schattenbild von Themen, die einst irgendwo in der Musik gelebt haben. Der Weg, der uns zu Anfang hinabtrieb, führt aus dem Abgrund des Inneren wieder zurück in die Wirklichkeit der Aussenwelt.
Diese Sinfonie ist keine Illustration zu irgendwelcher Dichtung. Maeterlincks Pelleas gibt den Titel der Musik, nicht ihren Inhalt. Das Drama wird nicht beschrieben, sondern genannt als Name für eine bestimmte Seelenverfassung, die zur Form der Musik geworden ist. So, wie man sonst ein Stück etwa "Scherzo" bennent. Der Komponist deckt auf, dass ein seelischer Zustand, der seiner Musik verwandt ist, bereits in unserem Bewusstsein lebt: Flackernde Schattenbilder der Aussenwelt, Hinabtauchen in unterirdische Dunkelheit und Katastrophen aus dem winzigsten Eingriff der Wirklichkeit in dieses Spiegelleben.
Die Struktur von Schönbergs Werk folgt nur den psychologischen Bedingungen der Musik; und nicht denen einer Dichtung. Das Stück ist auch keine "sinfonische Dichtung", sondern eine sinfonische Phantasie, und sein Titel "Pelleas und Melisande" zeigt nur auf den imaginären Ort, an dem der Komponist Schönberg und der Dichter Maeterlinck sich in einer Atmosphäre gemeinsamer Wünsche begegnen, doch nicht in gemeinsamen Formen der Lebensvorgänge.
Mit Debussys Pelleas-Musik, Deutung der Wollust des Versinkens in den zeitlichen Einzelmoment, hat Schönbergs Rhapsodie technisch und geistig garnichts zu schaffen.
Es ist ein Werk des grossen Kontrapunkts. Alles ist aus einer Grenzmöglichkeit der Stimmführungskunst gedacht. Jedes Thema, dessen Gemütsschwingung wir als vetraut hören und dessen Bauart wir als "musikalisch" kennen, wirkt in dieser Musik wie eine feste und massive Wirklichkeit: auch jedes Motiv mit erotischer Betonung wirkt so, jede Notenfolge, die unserem Ohr als "Melodie" gilt.
Diese Musikrealität, menschlich, psychologisch - sentimental - kontrapungiert gegen die starren, harten, schroff daliegenden Stimmführungen einer inneren, drohend unbekannten Welt. Bewegliches, Fliessendes, gegen ewig Bleibendes. Jede Katastrophe in Schönbergs Werk kommt aus dem Andringen der Realität gegen jenes stete, jenseitige Wandern der Stimmen auf den Gängen des Inneren. Derart ist die Möglichkeit, im Kontrapunkt zu fühlen, auf die höchste geistige Perspektive gerückt. In dieser Organisation zweier Riesenstimmführungen, deren jede mit einem ganzen Heer von Einzelstimmen gegen die andere arbeitet, liegt die stärkste Tat Schönbergs.
Dennoch kommt aus dieser Organisation auch das Todesurteil über die Musik. Ihr Wert lebt und stirbt mit dem absoluten musikalischen Wert jener beweglichen Themen, die bei gewohntem Bau der musikalischen Melodie uns als Realität erscheinen. Tonformen, die uns hier nicht ganz neu entgegentreten, müssen innerhalb dieser Musik das Gefühl einer sentimentalen Theaterei wecken. Phrase wird hier für uns alles, dessen Gemütsbeziehung in uns der Komponist voraussetzt.
Ein paarmal gibt's längere Strecken aus "Tristan" zu hören. Das bringt groteske Effekte aus einer ganz anderen Welt massiver Wirklichkeit hervor, ähnlich wie nachts in der phantastischen Luft einer grossen Stadt das Aufleuchten eines Reklametransparents. Es sind Schwächlichkeiten eines Mannes, dessen Wille (vor acht Jahren wurde das Werk geschrieben) noch grösser war als seine Kraft. Aber wir rächen uns, indem wir merken, dass wir willenlos von der Musik mit uns spielen liessen. Vielmal entgleiten wir dem Orchester in die lächerliche Unbequemlichkeit des Konzertklappsessels.
Bleibt die beispiellos überlegene Macht der geistigen Organisation zu bewundern, die uns immer wieder zurückringt.
Schönbergs Sinn für die gänzliche, schon atomistische Unabhängigkeit aller Stimmen von einander hat technische Beispiele erst wieder bei den grossen niederländischen Komponisten des XVI. Jahrhunderts. Er gibt uns wieder die ganze geheimnisvolle Beziehungslosigkeit der Übereinanders, Umeinanders der Stimmen. Das Glück, nach Verzweiflung und Pilgerschaft auf einen Moment zu stossen, der nur wie durch erhabenen Schicksalsfall eine Harmonie weist - die Beziehung aller Stimmen auf einen gemeinsamen Akkord.
Diese Wanderschaft mit ihrem grossen Gefühl eines neuen, unwirklichen Raumes des Inneren - dies einzige menschlich Hohe der Musik - schafft uns Schönbergs wildester Mut zum dunklen Knirschen des Kontrapunktes.
Bei dieser mächtigen Auflösung unserer geheimen Gefühlsmathematik werden wir ganz "zu nicht". Diese Musik ist eine schneidende Guillotinierung unseres Wirklichkeitsgefühles. Nur ein Vages, Schwebendes bleibt, im Zerfall des Blutes, das Leben des Inneren. Wir werden ganz zu Ich. Dieser Mann reisst die gigantisch und undurchdringlich um uns geschichteten Mauern der Aussenwelt herunter, wie irgend die Schalen einer Artischocke. Winzig springen wir heraus, um schnell masslos zu wachsen!
Schönbergs Musik fühlt hinein in uns, sie breitet ihren Willen in unserem Inneren aus, zwingt uns ab von der Welt, macht uns zu Einzelnen, zu beziehungslosen Ichs.
Aber drüben in einer anderen Sphäre des Lebens gibt es noch eine ganz andere Musik der grossen Einfachen. In der bannt ungeheuere Intellektualität die Schwingungen aller der getrennten Stimmen in eine einzige geheimnisvoll strahlende Linie. Diese Musik ist unser Objekt, in sie hinein deuten wir, fühlen wir, werfen wir unseren Willen. Hier sind wir nicht mehr preisgegeben.
Wir fühlen eine neue Aussenwelt. Wir sind nicht mehr beziehungslose Ichs, sondern viel Teile einer gleich empfindenden Masse. Diese Musik der Zusammenfassung, der Kraft - der Heiterkeit sozialisiert uns. Vor einem Jahrhundert war sie die: Mozarts.
Doch mit solchen Feststellungen sind nur die äussersten Pole von unterschiedenen Kunstgefühlen umschrieben - nicht moralische Werte gegeben. Denn die Unterschiede zweier getrennter Lebensformen gehen auf die Struktur, aber nicht auf die Intensität des Erlebens.
In der italienischen Oper
Da der junge Honorius zum Opernhaus aus dem Restaurant kam, so zog er um neun Uhr mit vollem Bauch und heiter an den lustigen Mailänder Cafés vorbei, in denen eine Menge Menschen mit leerem Zittern des Gesichts und nervösen Falten sassen. Hier, um die Ecke war die kleine Theatergasse. Plötzlich sauste ein blauer Schattenblock herab, nur in der Ferne wackelte gelblich eine Bogenlampe. Nun musste er eilig und scheu zum Theater schleichen, geduckt, um noch ganz in dem kleinen Licht zu gehen.
Es war eine ungeheure Zaghaftigkeit. Einen Moment klopfte das Herz sehr stark. Er war allein. Sollte er hinein in diese Trauer? Aber er konnte nicht mehr zurück in die Schattenhaftigkeit dieses unsichtbaren Gefängnishofs. Es ging nur noch zu dem Bogenlicht, dahinter schwarz ein schmaler Mensch in die Eingangstür stieg.
Drinnen drückte er sich an grauen Winkeln vorbei, blickte in schmale, lange Gänge, die plötzlich in mysteriöse Kurven sich verloren, und er ging langsam und mit hoffnungslosem Blut durch kalte Kreuzungen enger getünchter Korridore. Menschen mit nervös versunkenen Mienen rauchten Zigaretten, die Hände tief in die Hosentaschen gestopft. Hinter einem niedrigen, krummen, fettig gemalten Gelass, in dem er schon auf sich verzichtete, ausgepumpt von jedem Taktgefühl, jeder Fähigkeit, Menschen ins Gesicht zu sehen, bammelten rote Baumwollportieren. Er schlug sie zurück und zog moderigen Staub ein. Dahinter, im Theater, läuft ein brauner, kragenloser Kerl mit Apfelsinen durch die leeren Parkettreihen. Hier gab es keine Beziehungen mehr. Ein paar schwarze Röcke sitzen im rötlich halben Licht so einsam umher, wie Schachfiguren im Endspiel, in lässig gebückter, hoffnungsloser Haltung.
Mitten in dem roten Halbrund des Theaters, unter den niedrigen Logen, stand Honorius in einer ungeheueren, unüberwindlichen Isolation. Schmale, schmutzige Lichtstreifen lagen auf den leeren, roten Sesseln, wie für die Ewigkeit. Ein paar vorsichtige alte Frauen im schwarzen Kleid sitzen in leeren Logen, mühevoll repräsentativ gradgespannt. Vor dem Vorhang standen die Sessel mit den grünen Lampen für die Musik. Hinter der Bühne, weither, abgebrochen unverschämtes Klappern eines Klaviers, jemand amüsiert einen falschen Walzer herunter. Gewiss tut er das mit verdrehten Augen für eine Sängerin, die unterdes mit verzücktem Kichern sich von einem kleinen, fixen Choristen ins Weiche kneifen lässt. - Wie allein war Honorius, in dem verstohlenen Krachen der Parkettsessel.
Die Musiker mit runden Gesichtern und schmatzend vom Essen, wickeln die Instrumente aus. Ein dünner, sägender Ton schnellt auf aus diesen ungeordneten Reihen schwarzer Röcke, fast mitten im Publikum. Abgezupfte Intervalle klinkern Ornamente darum, nun schwimmt das ganze Orchester in weiten, trüben Quintenwellen auf und ab. Die Lampen sickern grün auf, in die erste Geige setzt sich eine Dame im weissen Kleid, sie hat eine schwarze Schmetterlingsschleife im Haar und Falten um einen sachlichen Mund. Sobald sie ihre Geige stimmt, heult das Quintenwogen des Orchesters auf, wie zur Zigeneurmusik.
Ein paar Reihen im Parkett sind gefüllt. Dazwischen ziehen sich die leeren, wie rote, schwarzgeränderte Raupen. Vor dem Orchester steht ein ganz kleiner, knochiger, schwarzer Mensch in zerknitterten Lackstiefeln, mit dem riesigen, missgestalteten, stoppeligen, faltigweichen Gesicht eines Unbeherrschten, Abgewandt-Ahnungslosen. Dieser Kapellmeisterzwerg mit den ungeheuren Zweioktaven-Händen kennt sicherlich nur eine Realität, seine Eitelkeit.
Das Theater wird jetzt ganz hell von einem rötlichgelben Licht, das Licht schwebt über die lustigen roten Sessel, um die Krümmungen der roten Wände, breit über den lustigen roten Vorhang und verschwindet in den roten Logen hinter braunem Schatten und den weissen Löchern der Fracks. Herren im Parkett nehmen träge ihre Hüte ab, ein Junge springt mit Lärm durch den Mittelgang und ruft die Abendzeitungen aus. Nur eine Geige im Orchester stimmt noch. Drüben in einer Rangloge, erscheinen, weiss zitternd, die breiten Federn eines Damenhuts. Der Kapellmeister richtet sich aus seinem Knick auf und schlägt ans Pult. Eine dunkle Fröhlichkeit durchbrannte Honorius. Es war - Masse.
Mit einem Ruck zucken die Geigen auf und stellen das Haus in einen hellen, weiten Lichtersaal. Unter kleinen, gelben Flammen kreisen nackte Schultern lustig und schnell vorbei. Dazwischen springt schlank mit gelösten Gliedern ein bunter Kerl auf, herausgeschleudert aus dem Wirbel gegeneinander schwingender Luftsäulen der gelben Trompeten; alles fällt in starre Maske. Still, keine Sinnlichkeit! Pause. Sie huschen weiter. Drüben, unter steifer Neigung schwarzer Röcke, fährt der bunte Fleck empor, nach ihm hascht helles Haar und gepudertes Fleisch. Vorn eine langgezogene Serenade, aber gefühllos tanzt ein Paar dazu.
Die Holzbläser führen in sanften Sprüngen durch kleine Türen und schmale Gemächer, dunkle Tapeten schwankend hinter Kerzenflammen, und Paare drin ironisch lächelnd in Verlegenheit. Durch schmale Rundgänge läuft es, in denen Küsse und Entwischen verklangen, und irgendwo hinter den Wänden lärmt eine Tanzmusik auf altertümlich ausgebreiteten Sextakkorden. Laut herein stürmt auf den kurzen Strichen der Geigen der Zug der Frauen, duftend eilen sie durch die raschelnden Gänge mit zierlich kleinen Fackeln in den erhobenen Händen. Das grelle Messing der Trompeten: Da steht der Bunte unter ihnen. Hinein in die Lichterhelle des Saals, die Männer tanzen plump heran. Begehren wird zum Puppentanz, Eifersucht hüpft im Vierschritt.
Der Bunte fliegt über alle, bleibt bei keiner. Lacht, droht, befiehlt - Komm Pedanterie, Holde: ein wenig Kontrapunktgestampf, würdige Umkehrungen, höchst spitalmässige Gegenbewegungen. Dass den Stimmen die Knochen klappern! Hallo, schnell, kürzt die Stimmen, brecht die Themen ab, eh sie sich verschlingen könnten! Hört ihr das Geschrei, die Floskeln der Verwirrung?
Im flackernden Durcheinander aller Töne gewöhnlichsten Gebrauchs. Lärmend atemloses Ineinander zum Schluss der Ouvertüre, wenn die Stühle in den Logen gerückt werden, und alle mit dem letzten eiligen Atem der Spannung "Bravo!", schreien. Der Kapellmeisterzwerg dreht sich um, und legt die riesige Knochenhand auf sein dreckiges Hemd. Das Theater ist voll von lachend Erregten. Vorhang auf.
Ein schräger Raum brach ins Leben herein. Man sass auf einmal in der grossen Höhlung eines mächtigen grünen Kristalls mit abgedunkelten Strahlen. O welch herrliches Gefühl des Aussersichseins, wenn auf die Dekoration eine Stadt gemalt ist, die ganze Stadt, die ganze. Alles muss drauf sein, o Meisterstück der Weltperspektive. Ha, der Chor tritt aus der Kulisse, mit Laternen: es ist Nacht. - Und geben die vier Kulissen nicht die köstlichste Sicherheit? Rechts und links auf jeder ein Haus gemalt; sie stützen den genau geründeten Halbkreis des Chors; sie sind gerad und parallel aufgepflanzt; dies ist die Ordnung der Welt - auf dass die gemalte Unermesslichkeit der Stadt im Hintergrund nicht Chaos dünke. Aber jetzt haben die Akteurs ihre Arien! Das Licht knippst auf, Licht, solang sie singen - man sieht sie besser so, in der Nacht.
Der Chor fällt ein, es wird dunkel. Nun ja, die Menschheit singt, das hört man in der Nacht. - Stellt sie nur recht geordnet auf, diese Menschheit! Wir unten im Parkett sind selbst Masse; hütet euch, wehe, wenn wir uns oben wiedererkennen. Wenn wir nachdenklich werden, wenn wir Einzelne werden. Das gibt Verwirrung! - Aber, singt der Solist, so muss Licht sein; es ist sein inneres Licht (wie auf den alten Bildern mit irdischem und heiligem Licht). Wir wissen ja schon, dass es Nacht ist. -
Cipollina war anders als gestern, die Maria Matesi. Sie zierte sich, dieses Zwiebelchen. Es war beinahe ein Kampf. Sie hatte kleine, länglichschmale, flinke Augen. Aber dann wurden sie starr und rund wie Butterblumen. Sie sang, am Abend drauf, die Partie der Rosina mit der gleichen Vollkommenhit wie die Matesi. Wieder war es der Ablauf einer vollkommenen Maschinerie. Honorius war auf kurze Zeit ins Stehparterre getreten. Der Polizist neben ihm reckte die Zunge aus offenem Maul und heulte ächzend aus heiserem Rachen. Hatte der sie auch gehabt, wie die andern Männer hier?
Was geschieht, fragte Honorius, wenn ich heute hier sterbe, mitten unter den Leuten? Sicherlich nichts Besonderes. Nicht einmal eine Störung gibts. Man wird das gar nicht bemerken unter den fünfhundert Leuten, die hier im kleinen Teatro Filodrammatico sind, und auf die jene Bühne wirkt, als sässen sie zu Fünfzigtausend da. Wir sitzen hier alle in einer neuen ungewohnten Sphäre. Um uns ist eine unbekannte Luft, so durchsichtig, daß wir uns selbst nicht mehr sehen. Die Arie der Sängerin umschliesst uns. Die gläsernen Himmel ihrer Fiorituren, die unfassbar umschwimmenden Wolken ihrer Triolen, das unsichtbare Vogelschwirren der Cadenztriller sind nun unsere Welt. Wo blieb die Wirklichkeit? Unsere Körper sind vernichtet.
Wir schweben. Die Kugel unseres Lebens läuft irgendwo anders, fremd von uns, weiter. Die Solo-Arie des Tenors bei den Lampen der Rampe ist nun ein Unabänderliches. In dieses Schicksal kann kein anderes dringen, es ist sein eigener Raum. Hier kann nichts neu werden, nichts schwinden, nichts wachsen, es ist ein Raum; nie kann dieser Sänger anders handeln. Aber dies dreht sich erst, zeigt uns neue Curven, neue Aussichtslinien, neue Schrägungen, wenn ein anderer Sänger kommt, mit seiner schicksalhaft praedestinierenden Arie. Ein Schaukelspiel der Lebensebenen. - O, nun sechs Leut' auf einmal, jeder starr an seinem Fleck. Vermischt sich alles im Sextett? Nein - Wunder unsrer neuen Sinne! Auf und nieder steigen alle diese Vorbestimmungen, diese fremden bunten Seelenräume schweben um einander. Empfindungsspiel strahlender Flüssigkeiten, auf und ab schwankend. Eisgetränke der Körperlosigkeit. Opernbühne, glitzerndes Büfett der Empfindungen. Höchste Kunst, gesiebt durch das Nutzgewerk höchster Colportägigkeit. -
Dies alles versteht man nur in Mailand. Ich habe da eine Sängerin gehört, sagte sich Honorius, die die schwierigsten Staccati machte, dass er klang, wie der Streich einer vollen Geige. Den nächsten Abend eine, die eine Flöte war. Ihre Namen sind in Europa unbekannt; ihre Fähigkeiten selbstverständlich, in Mailand. Sie waren meine Geliebten, und ihre Augen wurden weit. Aber ich habe mich nicht zu wundern, vor mir waren viele, und nach mir kommen die andern.
Übrigens, die Koloratur, ist nicht die Logik der erfahrenen Frau? Ihr müsst ja schöne Arme und Schultern haben, ihr müsst!
Während Honorius zur Nacht weit vom Bett ans Fenster trat, sich auf dem Marmorboden zu kühlen, fiel ihm bei: Warum denken die Leute immer ans Sterben im italienischen Land. Welch ein Unsinn. Wir vergessen immer unsere tierische Eitelkeit. Nun bin ich bei der Dritten. Sie hat ihren Namen anglisiert. Schön. Morgen Abend, im Theater, wirkt das fabelhaft; wie sie so mager ist, und in der Atmosphäre ihrer Koloraturen ihre langen Beine unter den Röcken so infam gleichgültig löst, als ging sie spazieren.
Und hier, bei mir, ist sie - ein Fähnchen, ach, eine kleine Flagge gar. In keinem Lande der Welt gibt's das, es ist geradezu umgekehrt. Sonst sind die Sängerinnen auf der Bühne grotesk plumpe Fregatten und erst in ihrer Wohnung aufreizende Damen. Hier - sind sie in ihrem Bett nicht eher erschöpfte Gelehrte? Ah, es liegt eben daran, dass in Mailand der Gesang nicht eine Angelegenheit des Gemüts ist. Singen ist hier ein Funktionieren. Was gebt ihr? Intuitionen? Ihr verabscheutet sie. Individualitätsleistungen? Nein, ihr würdet mit jeder Deklamation ausgepfiffen. Also?
Ihr arbeitet für die zweitausend Menschen im Parkett und auf den Rängen, für alle gleichzeitig. Ihr arbeitet. Die Antriebskraft für eure Maschinerie ist der Organismus eurer Arien. Warum sperren wir die Mäuler auf nach euch, wenn ihr auf der Bühne steht? Weil ihr Funktionen seid, jede bestimmt für uns alle. Intellekt, Ge ... füh ... le ...? nein, hier stürzt alles gleich von der Bühne uns ins Blut. Irgendwo lag mal ein Wert unserer Handlungen - - -? Aber Ihr gebt die wildeste, erhitzteste Phantasmagorie des Genusses. Sängerinnen, Angelegenheit der Verdauung, euer Triumph sind unsere angeregten Bemühungen in den Logen. Ihr Kunstgewerbe der Geschlechtlichkeit! - Doch dies versteht man nur in Mailand, wo das Sterben dicht neben dem Soupieren liegt.
Als Honorius sich wandte, sah er im gelb bewegten Dunstoval des Kezenlichts die stacheligen Schatten ihrer Achselhöhlen. Sie tastete nach dem grünen Opal der Limonade. In diesem Moment begriff er, dass jeder Mensch für ihn eine neue Katastrophe der Erkenntnis war.
Am nächsten Abend kam Honorius mitten in das lustige rote Licht des Theaters. Das Orchester sass schon da, fast mitten unterm Publikum, und man hörte das trübe Heulen der stimmenden Instrumente. Heute sprach der Kapellmeister ihn an. Honorius sah auf die eingesunkenen Lackstiefelspitzen des Zwergs und beging eine Dummheit. Er fragte: Warum muss man bei dieser herrlichen Musik der Lust immer an ein widerwärtiges Ende denken, an eine schreckliche, grünliche Fäulnis, an abfallende Gliedmassen, an die stumpfen Nadeln eines fürchterlichen Foltertodes?
Hier glitt etwas über das schiefe Gesicht des Zwerges mit den Knochenhänden. Honorius sah Erkennen. Aber es war natürlich nichts. Eine verbindliche Ausrede. Honorius gewahrte den Blick: Ja, wenn man sich mal mit diesen Fremden einlässt - sie sind taktlos! - Übrigens war wohl auch dieser Blick falsch verstanden. Höchstvermutlich hatte seine Frage als Kompliment gegolten.
Als der Chor im steifen Halbrund stand, und wieder die Solisten ihre trommelnd gehackten Rhythmen ins Blut brannten, bei dieser notwendig ewigen Wiederholung stets derselben Worte auf sarkastisch stakkatierten Vokalen - da fiel ihm ein: Diese komische Oper hat ja einen Komponisten!
Nie war etwas geheimnisvoller, als dass diese Musik einen Schöpfer hätte. Konnte man daran je denken, vor diesen Formen, wo alles Typus war, Art und Struktur so unveränderlich und eine Welt von vollkommenster Irrealität? Wo einer nichts mehr war und nur unter allen andern ein Etwas. Aus strengstem Zwang der Kunst stieg hier das kristallene Spiel einer schwebenden Seifenblase auf, die grad beim Anschaun in nichts als ein letztes Spiegeln zerging. Dies konnte - - nur - das Werk - - einer äussersten Skepsis sein. Der absolutane Skepsis vor allen Dingen, welche nicht schwebende Form sind. -
Überall spürte Honorius nun diesen Schöpfer, der nur an eine einzige Realität sich noch kalmmerte, an die Phantasien des Hautgenusses. Dieser Mann musste im Leben herumgehen, zerstört von Hoffnungslosigkeit, und eilig belebt vielleicht nur durch Frauen und Diners.
Honorius dachte einmal an Mozarts komische Opern, aber da erschien sofort, wie die Courtine eines Theatertransparents, der weisssilberne Wolkennebel einer priesterhaft altertümlichen Feierlichkeit.
Ah, nur solche letzte Konsequenz, solche Vernichtung aller, Einzelnen, solchen Mord aller Psyche und solche glühenden Feuertänze der Komik zu verkreuzen, zu durchknoten, musste dieser Italiener bedingungslos aufrührerisch sein. Nur ein Unbedingter, nur einer, der das Leben in den letzten Negation fühlt, war imstande, diese ungeheuerliche Isoaltion der Kunst auf die Helligkeit eines Traumlachens von zweitausend Menschen - von zweihunderttausend Menschen zu erzwingen - diese mächtige Vernichtung zur entrückten Heiterkeit der Menge ...
Geschrei des Orchesters, Floskeln der Verwirrung. Flammendes Durcheinander aller Töne gewöhnlichsten Gebrauchs. Der Taktstock ist nur noch eine hellzitternde Fläche. Lärmen, atemloses Ineinander zum Schluss, wenn die Stühle schon gerückt werden, und alle mit der eiligen Angst der Spannung, zu spät zu kommen, "Bravo!" schreien. Der Kapellmeisterzwerg legt die riesige Knochenhand auf sein dreckiges Hemd.
Honorius ging langsam über das Schattenblau der dunklen, sehr geraden Strassen, vorbei an grauen, breiten Fassaden, zum Bahnhof. Im roten Fackellicht musste er einer Kolonne von Strassenarbeitern ausweichen, die eben abgelöst wurden und sich mit krummen Rücken aufrichteten. Vor ihnen stand ein altes Männchen in Flicken, mit grau zerfetztem Bart, und rief mit dünner Stimme und müde seine Zeitung aus: "Der Schrei der Menge!" Es war ein gealtertes, tonlos pfeifendes Vogelstimmchen, dieses mühsam wiederholte: "Grido della folla!"
"Müsste es nicht heissen," dachte Honorius in seiner etwas pedantischen Art, "der Schrei für die Menge"? -
Gedichte des jungen Ernst Blaß
In diesem Winter erschien bei Richard Weißbach in Heidelberg das Buch "Die Straßen komme ich entlang geweht"; in einem lustigen Einband von bläulich-grünem Uni, der Farbe eines Bogenlichtschattens, und ein Freund mußte dabei unbedingt an das Rosa von städtischen Abenden im Sommer denken. Die Gedichte wirken geradeso. Vielteilig, Vortstellungen auflockernd, geordnet, überlegen; zuletzt tröstlich.
In ihnen hat Blaß alles mit so natürlicher Lebendigkeit organisiert, wie es vor zwanzig Jahren bei den Franzosen Verlaine tat; und ich meine, man darf nicht Angst haben, einen solchen Vergleich auszusprechen. Blaß hat - vielleicht für immer - bestimmte Grenzen von Angst und Bürgertum. Aber in der leichten Selbstverständlichkeit, sich durch Trümmer unseres Denk-Jargons dichterisch mitzuteilen, erinnert er mich wieder an das Zivilisationsgehirn Verlaine.
In seinem ersten Buch sagt er Dinge, die wir alle wissen. Aber das ist außerordentlich wichtig! Da unsere Zeitgenossen, um zu Versen sich zu zwingen, das Verschweigen unseres Lebens für notwendig halten.
Er sagt nicht sehr viel mehr als Dinge, die wir wissen; man streift in diesem Buch ordentlich durch ein schnelles Jahrzehnt von allen Arten des Denkens, Schauens, Naturaufnehmens. Die letzt vergangene Generation, die Menschliches in Straßen und Häuser hineingesehen hat und Menschen wie die Objekte einer Nature morte anordnet (man wird an Seurat denken, den heroischen Impressionisten) - diese Generation der Mischgefühle lebt noch stark in Blaß.
Aber dann taucht in seinen Gedichten etwas Neues auf, ungewohnt bei Versemachern. Nichts von Melodie oder poetischem Dictionnaire, sondern etwas mächtig Menschliches. Er gibt offen - noch mehr, er gibt bewußt: Wertungen. Er läßt fühlen, daß unsere Umgebung von Welt, auf der wir leben, nicht nur im bloßen Dasein existiert. Und wäre das nicht heute für uns was sehr Schönes? Ein Dichter, der weiß, was in anderen Menschen, Freunden, Kameraden, Ekelhaften, Gleichgültigen - was in denen vorgeht; wo sie leben. Zu wissen! Dieses Geistige, unsere Sicherheit oder Unsicherheit, unsere moralische Einstellung zu den Sachen und zu den Menschen spricht Blaß aus. Er äußert mit Weisheit Invektiven.
Doch: fast alle Gedichte stehen in den Sprach-Formen einer homogenen Gesellschaft. Einer Gesellschaft mit Voraussetzungen, wo Verständigung sofort durch den rhythmischen Ansatz eines Verses erfolgt (und wo man sagt: aha, das muß ein Sonett werden; oder: Oh, Terzinen!). Mit großer Meisterschaft in "Kultur" - Formen. Diesen verdammten Kulturformen. Und was mach ich mir aus Meisterschaft?
Viel wichtiger - nein einzig wichtig - sind Blassens ganz neue, schwebende, tiefe Verse; die aus Wertungen gekommen sind. Ganz aus dem Geistigen. Ohne den letzten Farbenschwindel vor sich selbst: ohne Ironie. Da gibt es eine große, neue, neue Einfachheit der Form. Einfachheit, die nicht Verdummung bedeutet; sondern hier geht es auf so allerletzte Dinge unseres Sprechens und Fühlens, daß ihre Mitteilung an alle Menschen freisteht. (Denn für das "Originelle" oder "Interessante" sind in Ewigkeit bloß gewisse Cercles mit Gewohnheitseinstellung der Denkschraube zu haben.)
Vielleicht findet das Wissen um Werte, das Wollen, das Geistige immer nur eine einzig denkbare Mitteilungsart, ohne Ablenkungsmöglichkeit. Aber vielleicht ist das die Mitteilungsart - für alle. Ohne zivilisatorische Voraussetzungen, ungesellschaftlich, auf Instinktbahnen. Unter einem Begriff, der so aufgebraucht war, daß er uns schon ganz neu und mit voller Macht erscheint: der Verständlichkeit.
Und das ist wohl schon ethische Wertung; außerhalb der billigen technischen Angelegenheiten einer Kunst. Es ist Zeit dazu!
Vier Zeilen aus dem Gedicht dieses Blaß "Vor ein paar Monaten" (aus solchen Versen lese ich eine ganze Zukunft des anständigen Menschen in uns):
"Ich will in mein Zimmer gehn und mich darauf besinnen,
Wie ich vor ein paar Monaten zu dir stand - :
Wir kamen immer freundlich zusammen,
Mein Herz starrte dich an, unverwandt."
Gerade wenn man noch sagen will, wie gut diese einfachen grammatischen Sätze sind und wie bedeutend das Atemholen vor dem Worte "unverwandt", wie unsrig das ist, gerade da findet man solche Mitteilung nicht mehr nötig. Das auszusprechen ist überflüssige Erklärung. Diese Dinge merkt jeder selbst. Das ist Blassens Schönheit.
Hier finde ich ihn - einen unbeeinflußten, arbeitenden Formulierer in seinem Zimmer - ebenbürtig dem konsequentesten Dichter der mutigsten Gedichte, die ich aus den letzten Jahren kenne: dem Max Brod vom "Tagebuch in Versen". Das ist das kühnste, denn es ist das pathosloseste aller unserer Gedichtbücher in deutscher Sprache. Unglaublich pathoslos geht es von allen Resultaten aus, mit denen wie lebendig um uns zu tun halten; stellt sie auf, wie längst bekannte Häuser und Bäume aus dem Spielkasten.
Und diese neuen Dichter reden so zu Uns (wie der alte Douanier Henri Rousseau in Seligkeit malte): daß die böhmische Frau eines Berliner Trambahnschaffners sie abends, nach dem müden Essen, voller Glück begreifen kann.
Aufruf an Literaten
Appell gegen die Internierung von Otto Gross
Ich bitte Sie, meine Kameraden, meine Blutsbrüder, meine Gegner, meine Feinde: Seien Sie nur dieses Mal nicht vornehm! Halten Sie hier mit uns zusammen, Mann, der nur Gedichte macht, berühmter Romanschriftsteller, Kriminalreporter auf Zeilenhonorar; alle, denen Tinte und Feder einmal das Ehrgefühl gestärkt haben. Nicht weil Sie schreiben und weil es einen Schreibenden betrifft. Sondern weil Sie schreiben können, öffentlich sich äußern ... Und wer soll zu der Öffentlichkeit sprechen, wenn nicht Sie?
Schreiben Sie nicht gewählt oder schön, überlegen Sie nicht lange. Seien Sie nicht feige, man könne Ihre Worte in fünfzig Jahren altmodisch finden oder unkonzentriert. Haben Sie keine Angst, irgendein Satirenmann könne eine Ungeschicklichkeit, die Ihnen hier erwischt, notieren! Schreiben Sie; wozu sind Sie denn da! Pathetisch, rhetorisch, mit Lärm, ganz gegen Ihre Gewohnheit; auch wenn Sie sonst den vornehm Zurückgezogenen markieren.
Machen Sie diese Sache öffentlich, benutzen Sie alle Mittel, die Ihnen einfallen, von den direkten bis zu den schmierigsten! Laufen Sie auf die Zeitungen; lassen Sie sich nicht durch die weltmännische Ablehnung des Redakteurs verblüffen: der Mann tut nur so; in Wahrheit hat er Angst! Laufen Sie zu den Verlegern. Alarmieren Sie die Zeitschriften, auch solche, die erst in fünf Monaten erscheinen. Teilen Sie Faustschläge aus; lassen Sie sich auslachen; es sei ja nicht so wichtig - - oder es sei ja ein privater Fall - - oder so etwas komme ja alle Tage vor.
Und dann spucken Sie dem zweideutigen Kerl, der das sagt, ins Gesicht! Machen Sie sich jede Gelegenheit zum Schreiben. Schreiben Sie. Schreiben Sie. Denn Sie können ja nichts anderes. Tun Sie, was Sie können; schnell! Regen Sie endlich die Menschen auf. Gebrauchen Sie ganz gemeine, ordinäre Ausdrücke, damit Sie einen Prozeß bekommen - und dann sagen Sie: ich habe wirklich mit Absicht diese Worte gesetzt, damit ich einen Prozeß bekomme und die Sache noch öffentlicher mache.
Helfen Sie, daß alle Menschen unter uns ein Zittern ankommt, eine Sorge, ein Frost - - daß die gallertartige Idee sie ekeln macht: eines Tages können zwei Kerle, die noch nach dem Verkehr mit Polizeihunden riechen - können zwei Kerle mit Revolvern in den Taschen sich in ein Zimmer schleichen. Und die Tür zumachen. Ihren Freund nicht mehr herauslassen. Niemandem zu ihm Eintritt geben. Drin der Mensch wehrt sich gegen den Griff und den Stoß dieser klobigen, auf Verbrecher eingelernten Fäuste.
Und kein Unbeteiligter sieht zu! Ihr Freund wird einen Tag lang von zwei Militäranwärtern eingesperrt, in seinem eigenen Zimmer. Dann transportiert. Transportiert! Gefangenentransport (kein russischer Katorga-Sträfling!) durch Deutschland, wo man deutsch spricht, in einem Viehwagen. Festgehalten, "bewacht" von frechen Militäranwärtermuskeln. Ihr Freund? Ja? Nein Sie, Sie selbst! Ihnen geschieht das. Sie sind nur so teilnahmslos, weil Sie glauben, das könne nicht Ihnen widerfahren! Jeden Tag, jeden Tag!
Sie arbeiten eine Idee aus, eine kleine Idee, vielleicht eine, die Ihnen ganz alltäglich vorkommt. Sie arbeiten daran, längere Zeit; an jeder Idee arbeitet man längere Zeit. Sie äußern sich, ohne es zu wollen oder mit Wissen. Nicht wahr, Sie werden sofort mißverstanden! Und dabei sind Sie nicht eine Spur von Märtyrer. Sie sind so kühl wie noch nie - aber was? Man hält Sie für äußerst reizbar. Ist das nicht so? Nun, denken Sie den Fall, Sie seien wirklich reizbar, empfindlich, beunruhigt durch Ablenkungen? Ihre Umgebung hält Sie - und Sie sind wahrhaftig kein Märtyrer - für verrückt. Und Ihre Umgebung ist guten Willens.
Aber: Wenn Ihre Umgebung bösen Willens ist? Wenn Ihre Idee ungewöhnlich ist, mißverständlich? Wenn Ihre Umgebung bösen Willens ist?
Männer mit Fäusten, die Macht über Sie haben, "transportieren" Sie im Viehwagen durch Deutschland; reizen Sie, mißachten Sie körperlich, behandeln Sie als Kranken. Als gefährlichen Kranken. Denn Sie kommen ins Irrenhaus.
Irrenhaus klingt wie ein alter, schlechter Melodrameneffekt. Aber Irrenhaus, das gibt's! Das gibt's für Sie! Wirklich noch. Es ist kein aufpolierter Strindberg. In dieses Irrenhaus werden Sie geschoben, nach München, Berlin, Prag, Graz, Wien, Freiburg oder Zürich.
Das geht mit größter Leichtigkeit, Ihre Verwandten brauchten es nur zu beantragen.
Sie haben vielleicht nicht verschwiegen, daß Sie Ihre Verwandten für Trottel halten, oder Sie sind ganz einfach Neurastheniker - es gibt wohl wenig unter uns? -, haben Ihren Verwandten gedroht; oder - Ihre Verwandten sind durch Ihre juristische, materielle, kapitalsteilhaftige oder auch nur öffentliche Existenz geärgert. Man schiebt Sie durch Deutschland ins Irrenhaus.
Machen Sie doch endlich Lärm, seien Sie beunruhigt, beunruhigen Sie die andern. Es handelt sich um Sie, um Sie, um Sie!
Der deutsche Schriftsteller hat einen fürchterlichen Ekel vor sich selbst, er ist gewohnt, sich zu verachten und seine Kameraden zu verachten; er nimmt jeden lumpigen Ingenieur, Kaufmann, Bankmenschen, Maler, Musiker, Soldaten ernster als sich; er hält sie im Gegensatz zu sich für "Lebensmenschen", nur weil sie seine alten, abgelegten Ideen nachsprechen. (Und in Frankreich kenne ich einen Dichter, der wirklich gestohlen hat und der freigegeben werden mußte, weil alle Menschen, die in französischer Sprache die Feder führen, für ihn eintraten!)
Ich weiß, ich weiß: Wäre hier ein Dichter, ein Romanschriftsteller, ein Zeitungsmann niedergeknüttelt worden, Sie, meine Freunde, Dichter, Romanschriftsteller, Zeitungsmenschen, würden sich sehr verlegen zurückziehen. Er gehört ja bloß zu uns!
Darum, nur um Sie zu überreden, unterschob ich, der Fall könne jeden Tag Ihnen selbst widerfahren.
Aber es ist ja gar nicht nötig, Sie zu überreden. Otto Gross, der in seiner Wohnung gejagt, verschlossen, gefangen wurde, den man soeben zuchthäuslerisch durch Deutschland ins --- Österreichische (österreichische ---) Irrenhaus transportiert hat, Dr. Otto Gross ist kein Schriftsteller. Der Mann ist nur ein Gelehrter. Sie brauchen sich also nicht zu genieren. Sie dürfen nunmehr nicht schweigen. Sie haben sich um die Angelegenheit zu kümmern!
Dieses infernalische, widerliche Molluskenschicksal, vor dem wir alle zittern müssen - und jeder Vernünftige hat vor dem Irrenhaus eine maßlose Angst - konnte in Deutschland einen bedeutenden Gelehrten treffen!
Ich habe das Recht, von der Bedeutung und dem Wert des Dr. Otto Gross zu sprechen, denn ich war sein Gegner. Gross ist Psychoanalytiker; es ist eine Kleinigkeit für Dumme oder Böswillige, rein formelhafte Ergebnisse der psychoanalytischen Forschung so zu drehen, daß sie (gewöhnlich dienen sie nur zu Herrenwitzen) in die Gesetzesgegend der "Anreizung zu strafbaren Handlungen" zu gelangen scheinen.
Aber das kann man mit jeder Disziplin der Forschung: Als Lionardo da Vinci den Taucheranzug erfunden hatte, sprachen Zeitgenossen die Besorgnis aus, so ein Taucher könne unter Wasser heimlich Schiffe anbohren und Menschen ermorden. Die russischen Bauern glauben noch heute, die Cholera komme von den Ärzten. Man kann jedes Fachwissen als "gefährlich" erscheinen lassen. Aber, welche teuflische Falle, wenn der Psychoanalytiker am Ende noch ein stark nervöser Mensch ist? Und man hat mir das von Gross bestätigt. Was für eine Kleinigkeit, mit ein bißchen Borniertheit und Übelwollen den Menschen schnell als "gefährlichen Geisteskranken" zu maskieren!
Ich, sein wahrer Gegner, weiß nicht, was für Gegner Gross im Privatleben gehabt hat; ob Frauengeschichten, Klatschsachen oder verletzte Eitelkeit dahinter stecken.
Wenn Ihre Idee ungewöhnlich und mißverständlich ist; und Ihre Umgebung bösen Willens?
Man teilt mir mit, die Veranlassung zur Verhaftung von Gross habe sein Vater gegeben, der Strafrechtspsychologe Prof. Hans Gross. Ich kann nicht wissen, ob das wirklich wahr ist. Aber angenommen, es sei wahr, so beweist dies ...
So beweist dies nur, daß Behörden, die bei den offiziellen Diners ihre Hochschullehrer unter den schäbigsten Leutnant placieren, der je Rekruten beschimpft hat, - daß diese Behörden jedem Wink derselben Hochschullehrer folgen, wenn es gilt: Verhaften, Mißhandeln, Abschieben, Internieren.
Seien Sie, deutsche Schriftsteller, seien Sie laut, tappsig, klobig, lärmend. Seien Sie populär. Nur keine Angst. Seien Sie populär bis zum Speien.
Ein Hochschullehrer, Dozent der Kriminalpsychologie, der seinen Sohn, einen Gelehrten, ins Irrenhaus sperren läßt? Gibt es das? - Aber wenn es das gibt - was hindert, anzunehmen, daß Vater Prof. Hans Gross dumm, mißverständig, bösartig ist? Was hindert, anzunehmen, daß Vater Gross voller Milde, voller Verständnis, voller Liebe ist; daß er in tiefer herzlicher Zärtlichkeit meint: nur eine kleine Fahrt in ein nettes Sanatorium. Aber, wenn es klug, gerührt, innig gedacht ist, dann ist es doch dumm, mißverständig, bösartig gehandelt !
Dr. Otto Gross und ich sind Gegner. Wir haben uns hier, in der "Aktion", bekämpft, und nicht um Mißverständnisse oder Wortdeutungen oder bürgerliche Gemeinheiten; auch nicht der polemischen Übung wegen. Wir haben uns um die ersten und schrecklichsten Dinge bekämpft, die ein menschliches Gehirn erregen können. Wir haben uns beide mit den härtesten, den feinsten und den häßlichsten Mitteln, die durch Leidenschaft und Glauben verletzend und boshaft werden, angegriffen. Jeder von uns beiden hat als selbstverständlich dem andern von vornherein die ganze Existenzberechtigung bestritten. Gross und ich sind in allen Angelegenheiten des Geistes - und das sind unsere Leidenschaften - Gegner: jeder wünscht innerhalb des Kampfes sehnlichst, der andere möge nie auf dieser Erde gewesen sein.
O wäre ich imstande, volkstümliche Lokalanzeiger-Artikel über Gross abzufassen!
Ich hatte es zu tun mit dem Typus meiner Gegner, einem Gelehrten im Maximum der heutigen wissenschaftlichen Intelligenz; hinter dem Gegner stand als Privatmensch Psychoanalytiker Dr. Otto Gross. Ich hatte zu schaffen mit dem Dr. Gross als Kopf. Mit dem ins Irrenhaus Transportierten als Kopf ! Und gerade mit ihm, mit Gross, mußte ich streiten (ich, ich: es handelt sich nicht um "mich", aber ich bin nun einmal dabei beteiligt), weil er überall, wo ich angriff, in seinem System bedeutend war!
Ein Irrenhäusler?
Spricht man denn solche Worte von seinem Gegner, wenn man ihn nicht schätzen gelernt hat!
Dieser wertvolle Mensch wird behandelt wie der ausgerückte Tiger in der Kinematographenjagd. Ein bekannter Gelehrter. Nicht mehr jung. Ein Denkender.
Und Sie fühlen sich noch sicher? Sie zittern nicht für Ihre nächsten Freunde? Sie schreien nicht laut. Sie schäumen nicht? Verachten Sie doch jede Stunde Ihres Lebens bis zum Dezember 1913, in der Sie nicht von den hundert Wiederholungen wußten, die dieser tierisch fürchterliche Fall täglich im Umkreise Ihres Lebens hat. Denken Sie, welches Glück, daß Otto Gross ein Auffälliger ist; so hören Sie und viele andere schnell von seinem Schicksal. Sie können es ändern. Sie brauchen sich nur zu regen.
Aber von wieviel gleichen Vorgängen erfahren Sie nichts, denn da handelt sich's um unscheinbare Köpfe. Sind Sie wirklich ein tiefer Philosoph, ein großer Satiriker, ein überlegener Dichter, wenn Sie antworten: "Was geht das mich an, das Leben läuft auch so weiter!"? Oder sind Sie da nicht vielmehr ein ganz schmieriger Lumpenkerl!
Von wieviel Menschen in Deutschland wissen Sie nichts (in Deutschland, nicht in Rußland), die geknüppelt, geknebelt, erstickt, paralysiert werden! Von gewöhnlichen, miittelintelligenten, wenig sympathischen Massenexistenzen, die Ihnen viel zu durchschnittlich sind, als daß Sie sie je beachteten.
Aber Sie, seien Sie nur dieses eine Mal durchschnittlich. Seien Sie unvornehm. Seien Sie populär. Lärmen Sie so laut von Ihrem Entsetzen und Ihrer Erschütterung wie in der Sylvesternacht, wo Sie sich unbeachtet dünken, weil alle lärmen. Seien Sie sicher: auch hier geht's gleich los. Sie müssen nur mitmachen.
Das Blut ist Ihnen ins Gesicht gestiegen. Schnell, helfen Sie, fechten Sie. Wehren Sie sich! - Oder, Sie stehen bei jenem Geohrfeigten, der auf die Frage, wie er sich gewehrt habe, antwortet: "Ich schwieg höhnisch."
INTERNATIONALE GESELLSCHAFT FÜR SEXUALWISSENSCHAFT
In der Gründungssitzung, am 16. November, beschuldigte der Vorsitzende, Nationalökonom Julius Wolff, die wirklich harmlose Biologie, Metaphysisches in die Sexualwissenschaft eingeschmuggelt zu haben. Die neue Gesellschaft werde, sagte er, damit endgültig aufräumen, werde sich an die Tatsachen halten, sie systematisieren.
Wenn kraft der unerhörten Dämonie der Dinge die Hände der so nach den Dingen Greifenden leer bleiben, merken die es, von allzu nah irrlichtelierenden Zielen hypnotisiert, doch nicht. Daß das Normale der Hauptgegenstand der Untersuchungen sein werde, sagte der Vositzende ferner. Aber er meinte nicht die Person, deren vollkommen kontinuierliche Existenz ihrem ganzen Sinne nach Norm ist, sondern meinte den von Generation zu Generation, von Jahr zu Jahr sinkenden Wasserstand aller Menschen, deren einziges Merkmal nur mehr der Mangel jeder Kontinuierlichkeit ist.
Der Vorsitzende verwies dann auf die günstige Konjunktur der Gesellschaft inmitten der heutigen Emanzipationstendenzen und Bemühungen, Schleier wegzuziehen. Und man hat wirklich schon so viele Schleier weggezogen, daß man die eigne Hand nicht mehr vor Augen sehen kann.
Später gab der Berliner theologische Ordinarius Reinhold Seeberg der Superiorität selbst des allegorischsten Gottes über jene Naturwissenschaft vom Staate Gestalt: er sprach, zum Teil ohne es zu merken, von Person und Abgründigkeit.
Schließlich wählte die Gesellschaft zu Vizepräsidenten Herrn Seeberg, den Sanitätsrat Moll und Professor Hans Groß (Graz), der genau acht Tage vorher seinen Sohn Dr. Otto Groß gewaltsam hatte in eine Anstalt schaffen sehen.
Dieser Arzt Dr. Otto Groß hat durch jede Behandlung Sexualität als eine der konzentrischen Sphären der sich wandelnden Kräfte erkannt.
UFF ... DIE PSYCHOANALYSE
Oder: Außerhalb einer Erwiderung auf die Gegenworte von Otto Groß.
Herr Cox, der geübte Kanalschwimmer, erlebte an Bord eines Ozeandampfers einen Schiffszusammenstoß. Bevor er ins Meer sprang, zog er seine, in Paris gefertigten Lackschuhe aus; er wußte aus Erfahrung, daß unter solchen Umständen auch die reizendsten Schuhe für dieses Weiterleben hinderlich sind. Nach der Rettung - großer Protest der Pariser Schuster: und übertreffe ihre Fußbekleidungsindustrie nicht nur an Güte, sondern bekanntermaßen auch an Modernität alles je Dagewesene.
Die Psychoanalyse ist ... man bloß eine Technik. Mein "Gegner" will gar nichts davon wissen, daß es für diese Industrie nur auf ihr Erzeugnis, den plumpen, nackten Heilerfolg ankommt. Sie ist, meint er, etwas für sich Bestehendes. Ein Selbstzweck. Aber nein, aber nein ... ein Selbstzweck? Sie ist Alles. Unsere ganze Zukunft ...
In jedem technischen Betriebe gibt es Geschickte und Ungeschickte. Arbeiter und Vormeister. Dr. Groß, der wirklich klug ist, hat die manuelle Arbeit längst nicht mehr nötig. Er ist was ganz feines: er ist Zwischenhändler.
Doch darum die Technik (von der man "innerlich" - lebt) für den Grundantrieb unseres Daseins auszugeben ... das ist doch nur noch zum Annoncieren in den Zeitungen. Oder Selbstbeschwindelung.
Ganz abgesehen von der Ahnungslosigkeit, daß Kämpfer unter uns, das abgeklapperte L'art pour l'art längst als Verschleierung der Talentlosigkeit nachgewiesen haben. Wirklich, warum sind die Psychoanalytiker so ahnungslos? Sogar der große Freud mußte sich fragen lassen, warum er als Kunstbeleg den nie existiert habenden Feuilletonromanproduzenten Wilhelm Jensen zitiert, und nicht den Dichter Johannes V. Jensen.
Oder. Da alle Aufrichtigen einig sind, daß Flaubert neue Menschen gezeugt hat, mit Tinte und Feder noch nicht Gesehen für immer in die Welt pflanzte - schreibt Psychoanalytiker Dr. Reik ein witziges, gut gearbeitetes Buch, das man liest wie etwa den "Roland von Berlin"; und "weist nach", daß des Flaubert "Heiliger Antonius" nichts als ein Kommentar zu Flauberts verdrängtem Geschlechtsleben sei. Dies kann man natürlich mit der "Bovary" auch machen, mit Balzac, mit Poe, zum Schluß sogar, wenn bis auf Homer die ganze abendländische Literatur psychoanalysiert ist, kann man es mit Meyers Konversationslexikon machen. Ahnungslos; ahnungslos. -
Bemerkung: Es ist klar, in allem von Menschen Gezeugten und in allem vom menschlichen Geist Erfundenen wird "die Wissenschaft" sich erst recht selbst wiederfinden. Mein Satz bleibt bestehen: eine volle Männergeneration später trampelt die "Wissenschaft" den Mitteilungen des Geistes (beispielsweise der Kunst) nach. Die kleine Psychoanalyse ist nur ein harmloses Lämmerhüpfen. Viel tollere Dinge konnt ich, zu diesem Satz, in der theoretischen Physik ersehen; also dem von subjektivem Einfluß angeblich unabhängigsten Gebiet des symmetrischen Denkens.
Die Apothekertechnik: Sage mir von wem du träumst und ich sage dir mit wem du nicht geschlafen hast. Ein vorzügliches Rezept. Ein ... Rezept. --
Ich kann mich um die Dialektik, aber nicht um den Dialekt meiner Leser kümmern. Dr. Groß macht Diskussion durch kleine Falschlesungen. Ich schreibe von den "Gesetzgebenden" der Zeit; er meint, ich könne wohl nur (etwas plauschiger) von den "Gesetzgeberischen" gesprochen haben. Dies bedeutete natürlich eine aufgeregte, vergebliche Mühe, Gesetze zu geben.
Während in Wahrheit einige von Uns heut wieder Gesetzgebende sind, das heißt: fähig, die menschlichen Ahnungen vom Inhalt und Glück unserer Zeit in unverlierbaren Vorstellungen zu fixieren ( .... bis zum nächsten Gesetzgeber).
Dr. Groß macht Diskussion. Aber sie ist unmöglich. Er redet aus einer anderen Welt. Im besten Fall aus der Welt der Quantitäten, des Nebeneinandersetzens, des Messens. Die Sprache der "Wissenschaft". Die Sprache einer unendlich vorwärts und rückwärts in die Länge zu ziehenden Welt. Eine - historische Sprache: die des "Fortschritts". Und die Sprache des Fortschritts ist für seine Welt sehr gut. Aber wo soll aus ihr eine Verständigung mit der unerbittlichen Welt des Glaubens an den Geist möglich sein?
Das ist gerade so, wie etwa der Wettstreit zwischen einem Füllfederhalter und einem Flötensolo. Gewiß, in diesem Konzert hat die Flöte gar nichts mit dem Fortschritt zu tun. Jedoch ein guter Füllfederhalter ist sehr nützlich (ich selbst habe einen amerikanischen). Aber wird, durch billige Massenverbreitung ausgezeichneter Füllfederhalter, die Welt zwischen Plato, Stirner und Bergson "besser" schreiben?
Zu merken: dem Psychoanalytiker kommt es im wichtigsten (seinem tiefsten) Fall auf die Natur an. Uns, die wir die Menschen an den Geist erinnern, handelt es sich um den Menschen. Um diese einzige, gläubige Inselexistenz, die - - will. Im Lexikon nachzusehen, wie groß die Bevölkerung der Erde ist.
Inselexistenz des Menschenwesens umflossen von der Natur.
Dr. Groß teilt mit, die Psychoanalytiker erstrebten, die Menschen aus ihrer Einsamkeit zu retten.
Ja, für wen schreibt man denn, wenn ein so intelligenter Gelehrter noch so sprechen darf, ohne daß der Drucker heiser wird? Die "Wissenschaft", die Psychologie, die Analyse individualisiert doch gerade. Die Psychoanalyse verprivatisiert ja. Der harmloseste Klient des Psychoanalytikers ist im Handumdrehen ein Seelen-Partikulier.
Die Entgrenzung der Menschen ist nur möglich durch Bewußtmachen ihrer Existenz als geistiger - ja, unnatürlicher! - Wesen.
Einige Leute in Deutschland schreiben seit mancher Zeit geradezu Selbstvernichtungen, um die hörenden Menschen dieser Erde aus ihrer Isolation zu befreien: Einstein und Ich, jeder aus einer anderen Gegend her, jeder mit anderen Fähigkeiten. Wir haben zuerst mit Mißtrauen (denn wie jeder anständige Mensch fürchteten wir die "Freundlichkeit" des Anderen), dann mit Erstaunen gesehen, daß wir "Diagonalen" waren. Daß wir uns im Hauptpunkt trafen (und wenn wir uns sonst noch so sympathisch waren oder noch so wenig ausstehen konnten). Im Hauptpunkt: Befreiung durch die beispielhafte Erinnerung an die absolute Existenz des Geistigen.
Und dann kommt ein Analytiker mit seiner Psychologie an, und redet von - - Kunst. (Da ich sagte, daß die Wissenschaft in ihren Antrieben eine Generation hinter der Kunst herläuft.)
Ja, ist denn so ein Mann nicht verpflichtet zu merken, daß Wir auf das Metier der Kunst pfeifen, und sie den Herrschaften vom Künstlerberuf überlassen?
Wenn ein Mensch mir etwas zu sagen wünscht, so weiß ich im schlechtesten Fall schon alles voraus. Es kommt aber darauf an, daß wir etwas gemeinsam tun. Nicht auf Umquatschung des Nichtgetanen.
Der Psychoanalytiker meint: Wozu habe ich mein Seelenleben, wenn ich es nicht an den Mann bringen kann?
Der Analytiker kümmre sich ums "Seelenleben". Und rede Uns nicht in unsere sacrae conversationes hinein. Wir überlassen das Seelenleben den Patienten der Psychoanalyse. Wir kümmern uns nur um die schrecklichen, kaum berührbaren Elementardinge: daß Menschen nebeneinander Raum einnehmen und ihren Raum verlassen, ändern, verwandeln müssen. Daß sie leben oder sterben wollen. Und daß sie das je vergessen konnten!
Techniker bleib bei deiner Klinik.
Hat denn Cox, Meisterschwimmer, Zeit mit den Pariser Schustern zu diskutieren?
Intensität
(Zu meinen in der "Aktion" erschienen Aufsätzen "Der Dichter greift in die Politik" und "Brief an einen Aufrührer".)
Intensität ist Symptom für das bewußte Handeln im Geist. - Man fragt mich, ob auch Intensität nicht am Ende eine Formidee sei. - Aber es gibt kaum etwas, das von Mitläufern der Schule des dekorativen Denkens, oder auch von Künstlern, nicht als Formidee gedreht werden kann.
Zunächst: es ist natürlich nicht eine Formidee. Doch selbst wenn es eine wäre? Unsere Aufgabe (die der Gesetzgebenden und Kämpfer) fürs Leben ist es, die Dinge aus einem Plan des Daseins (aus ihrem vegetativen, genusshaften Fürsichsein, ihrer "Wert"-losigkeit) in einen anderen zu heben; sie die Brandmarken der Wertung durchmachen zu lassen. Man kann sich "Verhalten" (existere) als eine Ebene vorstellen und "Bedeutung" als eine andere. Wir zwingen die Ebenen, sich zu schneiden. Die Schnittlinie ist der Ort "Wert".
Der Zustand jeder denkbaren Kategorie ist, mit linearen Begriffen ausgedrückt, lediglich flächenhaft. (Daher die dekorativen Gehirne, z.B. dekorierende Künstler, mit der bloßen Beschreibung der Kategorie schon das Letzte ausgedrückt zu haben glauben.)
Lassen wir selbst den "Wert" zu einer neuen Kategorie werden, indem wir ihn zum Durchmesser eines unendlich großen Kreises machen - also wenn wir die beiden Ebenen "Verhalten" und "Bedeutung" umeinander drehen! - , so ist das neuentstehende Gebilde keine Kategorie mehr. Es ist räumlich, dreidimensional. Schon dieses neue Wesen fällt nicht mehr unter die "Formidee", weil seine Konstruktion sich in unendlich viel möglichen Bewegungen ändern kann.
Aber ganz frei, unabhängig von den Gebilden der Fläche und des Raumes - himmelshaft unvergleichbar, gottartig bestehend und allein - ist das Agens, der Antrieb, das Zwingende für sie Bewegung und Schneidung jener Ebenen. Innerhalb dieser Analogie steht das absolut Freie, Außen-Seiende, das Treibende, das Geistige = für Intensität.
Außerhalb des vorstellbaren Schemas einer neuen (doch endlich notwendigen) Scholastik unserer Zeit müßte man sich in der Vorstellbarkeit der faktenmäßigen Wirklichkeit so ausdrücken: Intensität = Platzen vor Geistes-Gegenwart.
(Doch in Zukunft ist noch zu zeigen, worauf Intensität beruht.) Auch für allen anderen Fälle ist es wichtig, daß wir nachweisen: Überhaupt nur die Möglichkeit von Formideen anzunehmen, ist schon ein Irrtum. Nicht einmal jene oben angesetzte Konstruktion ist in Wahrheit auszudenken möglich. Es ist zu vergleichen, daß alles, was in der Welt über "Form" gesagt wurde, nie Darstellung, sondern vages, mit Lyrismus verbrämtes Gerede ist. Während "Wert" etwas ungeheuer Bestimmtes und Eindeutiges blieb.
So elementar eindeutig, daß die meisten Menschen sich (vor sich selbst) genieren, daran zu denken. Darum arbeiten alle romantischen Köpfe mit dem Begriffe "Form", denn Form wäre ja ein Zustand (man vergleiche von Plato bis auf die Absickerung in den Jahrbüchern der Freunde des Dichters George).
Es gibt aber keinen Zustand. Der einzig mögliche Zustand wäre das Eingedrungensein des Menschen in Gott. Dies ist ganz unmöglich, denn Gott ist eine ganz freie, absolute, d.i. unabhängige, nicht passive Existenz. (Der halb gnostizierende, halb rationalutilitarisierende Scherz, Gott für reziprok dem Menschen zu halten - dünnstes Wässerchen: Feuerbach ist natürlich ganzer Unsinn. Gott als wechselwirkendes Wesen wäre überflüssig zu denken. Aber wer ist dann gezwungen, Bücher in Lexikonformat über ein Nichtvorhandensein zu verbreiten? Das war eine triste Verlegenheit!)
Der vollkommenste Fall des praktischen Lebens ist: bis zum deutlichen Bewußtwerden der absoluten, gänzlich für sich abgetrennten, bewegungsfreien Existenz Gottes vorzudringen.
Wiederum ist der Vorgang dieses Bewußtwerdens: Intensität.
Die Anonymen
Seit einigen Wochen dürfen wir wissen, daß Deutschland existiert. In einem Lande, das bevölkert war von industrialisierten Kegelklubs und ihren grad so hochnäsigen Gegnern: schwermütig fettansetzenden Einzelgängern, ist das Wunder da. Menschenstimmen wurden hörbar. Seien Sie irgendwo auf Java in einem fernen runden, einsamen Waldloch; vielleicht kurze Zeit nur allein, aber fühlen Sie sich abgetrennt vom Willen und vom Leben anderer, weit von jeder Hilfe - und finden Sie plötzlich, kaum sichtbar hinter Stämmen und Blättern ein kleines Haus, in dem Leute leben, die schon sehr lange da wohnen, zu Ihnen sprechen und alles rings kennen. Wenn Sie noch Zeit haben, dann heulen Sie los.
Schleusen Sie die letzte Sentimentalität auf, die heut jeder wirklich anständige Mensch hat. (Sie ist noch das Reservoir der Werte, aber morgen gibt's keine mehr!) Seien Sie gerührt, heulen Sie vor dem Wunder der Menschenstimme in Deutschland.
Seit einigen Wochen erscheint in Leipzig im Demeter-Verlag eine Zeitschrift. Sie heißt "Der lose Vogel". "Der lose Vogel" hatte die Aufgabe, in ganz Deutschland einen Satz zum Lesen zu geben, dessen aufrüttelnd erarbeitete, durch Schlagen, Zerren, Brennen, erarbeitete Geistigkeit seit hundert Jahren erwartet werden konnte. Im "Losen Vogel" stand:
Eine ganze kleine Gruppe von Schriftstellern, die mit der Anonymität ihrer Beiträge die Sachlichkeit betonen, möchte gegenüber der heute so beliebten Betonung des Persönlichen, schreibt diese Monatsschrift "Der lose Vogel", in der vielleicht nicht ganz aussichtslosen Hoffnung, dazu zu helfen, daß dieser sogenannte moderne Mensch auf sein Epitheton verzichten lerne und ein Mensch werde, bestimmt durch seine Art und Begabung, aus der, und sei sie noch so gering und eng, zu wirken, ihm und damit dem Ganzen des Lebens von größerem Nutzen und besserem Glücke sein wird, als wenn er sich in eine immer nur oberflächliche Vielseitigkeit und falsche geistige Geschäftigkeit verliert, die ihm zum Toren macht und keinem dient."
in diesen Worten ist nichts mehr zu spüren von dem Zungenschnalzen über die Materie, das das ganze letzte Jahrhundert geschändet hat. Aber dies wäre nichts.
Ist es denn nicht zu merken? Muß es gesagt werden? Die Revolution ist da. In diesem Satz brach ein Heer hervor. Die Menschlichkeit, das Gestaltende, geht gegen die starre, widerstrebende, viehische Gewohnheit; gegen den Weltbauch.
Es gibt keine Materie mehr.
Niemand hat mehr von Bildern zu taumeln. Niemand hat mehr betäubt in Symphonien zu sitzen. Auch der Sieg einer Epoche der Plastik wäre nur Mode. Vielleicht darf's noch erlaubt sein, den rundgehauenen Klotz der römischen Engelsburg als ein Zeichen zu nehmen (letztes Zeichen, daß die Erde besteht). Man darf aber, als erstes Zeichen für den wirklichen und wirklichen Geist, an die Pyramiden glauben.
In der Zeitschrift des Demeter-Verlags herrscht Anonymität. Ist es möglich, ein Wort auszudenken, das nur etwas von dem Umschüttelnden, von aller Seligkeit dieser real erfüllten Utopie mitteilen könnte? Es gilt zu überzeugen, daß ein Jahrhundert, dessen Aufgabe war, uns Eßnäpfe, Einheitsstiefel, Wagnerpartituren herzustellen, nicht mehr als ein Hindernis für den Geist besteht. Wie soll man es mitteilen, wie soll man andere zum Schreck und zum Entzücken bringen? In einer neuen Zeitschrift herrscht die Anonymität: das heißt, es herrscht nach einem Jahrhundert wieder die Verpflichtung und die Beziehung.
Der Tag, an dem einer den Mut wirklich hatte, den Gedanken der Anonymität bis zum Ende zu umfassen, dieser gehört zu den Schöpfungstagen unserer heutigen Geschichte. So ein Moment des Überschwelltseins mit Geist ist nicht auszudenken, er kommt nur einmal vor. Man kann versuchen auf einem Gang durch die Straßen, allein in der späten Nacht, einmal sich jene Schöpfungsstunde unserer deutschen Anonymität vorzustellen, um zu wissen, nach welcher Hyboris aller Sinne, mit welchem Leiden unter dem unaufhaltsamen Druck des akkumulierten Geistes sie zustande kam. Die Zeitschrift der Anonymität ist ein Herz des geistigen Lebens. Hier muß zusammenströmen, was an Kraft ungeleitet und versprengt in der Welt umherirrt.
Diese Anonymität macht tausend Selbstmorde zunicht. Kann etwas menschlicher sein? Nun, hier ist ein Horizont aufgebaut, der jeden Menschen plötzlich seine Verantwortung in seiner Welt fühlen läßt. In diesem Moment gibt es keine Empfindung mehr, die Freude fällt von unserm Fleische ab.
Aus uns wachsen Bäume mit breiten Zweigenkreisen, eine Welt ist da. Hier ist nichts allein. Was bleibt uns - vor dieser Anonymität - als unser Leben beieinanderzuführen! Denn wer innerhalb dieser Anonymität noch in Gleichnissen sprechen würde, wer sich spiegeln und gefallen wollte, wer sich genösse, auf den würden seine in die Welt geschickten Kräfte wieder wirkend zurückprallen. Den würden sie verzerren und verzierlichen, den würden sie vereinzeln. Er wär Einzelner und ohne Halt in dem rings zusammengeschlossenen Kreis Verantwortungsvoller. Das wäre der selbstverständliche Tod. Dies weiß der Anonyme, und das drängt ihm die Kräfte auf die stärkste Sachlichkeit zusammen.
Alle Menschen waren heute musikalisch. Die Musik ist die Kunst, sich auf die leichteste und bequemste Art seinen Verpflichtungen zu entziehen. Hineinzuschlüpfen in Polyphonien: ist ein Weg außer sich zu geraten, ohne für andere dazusein. (Die Musik - die gute Musik, und je besser, desto schlimmer - ist der Weg des Vereinzelns. Die Deutschen sind musikalisch: isoliert!) Musikalisch ist der Gegensatz zu Moralisch.
Die neue Zeitschrift ist ohne Musik, trocken.
Die Zeitschrift der Anonymen ist das neue Manifest der Moral.
Es wird nötig, noch ein paar Worte historisch zu reden. Üble Tagesschreiber werden die Anonymität für einen Trick halten; Weichgehirne denken an eine funkelnagelneue Originalität (in Wahrheit brach hier endlich einmal der Mut der Verantwortlichkeit hervor, die Originalität zu züchtigen). Der Verleger hat kein Geheimnis daraus gemacht, daß der "Lose Vogel" von Franz Blei herausgegeben wird. Darf eine flüchtige Erinnerung genügen? Wenn man heute die alten Jahrgänge der Insel aufschlägt, so ist gleich sichtbar, daß da nicht die violetten Leberknödel des Gründers Bierbaum wirkten, sondern das Formgebende sind die Beiträge Bleis. Heute sieht es so aus, als sei er der Leiter gewesen. Dann: er hat die großen Moralischen nach Deutschland gebracht, André Gide und Francis Jammes; übrigens zu einer Zeit, in der keiner fähig war, ihre Einwirkung auch nur zu spüren.
Nie wird vergessen werden, wie Blei Claudel übersetzt hat. Diese Menschenliebe ist in der Literatur noch nicht gewesen: diese mächtige Überwindung, die Opferung aller persönlichen Genüsse der Sprache. In der Übersetzung Claudels verging kein Satz, der nicht zeigen wollte, da sei nicht "Übertragung", sondern bedingungslose unamüsable Nachbildung eines Undeutschen; Nachbildung, die im härtesten Deutsch bedeuten sollte, daß nicht der Übersetzer lustvoll dichte, sondern daß der fremde Dichter einen sachlichen Inhalt habe. Nie hat, wie Bleis Claudelübersetzung, etwas so drohend und seelenkräftigend gezeigt, daß "Wortkunst" ein genußreicher Selbstbetrug sei.
Wir werden nie vergessen dürfen, daß er uns wieder neu Moral gelehrt hat. Ein Ding, das unter verschwommenen, dicken weichlichen Händen zur komischen Puppe geknetet worden war. Was für ein Mut gehörte dazu, vor Lesern - und im Hintergrund blieben doch unverborgen Künschtler und Literaten - vor Lesern die Verfilzung gefühlvoller Begriffe zu verstören, die Schlupfwinkel zimperlicher Ausflüchte, die das ehrfurchtweckend bebärtete Wort "Ethos" bot, auszubrennen. Es war Mut, daran zu erinnern, daß wir in einer Gemeinschaft leben.
Ein Zufall zeigt, daß Blei vor gerade zwanzig Jahren in einem Züricher Brief an den "Socialist" die Verantwortlichkeit innerhalb der Gemeinschaft verteidigt - 1892, also zu einer Zeit, wo Individualismus gerade was riesig Feines für ausgekochte Jungens war. Dieser Mann hat also die Moral nicht erst in sich "entwickelt"; er hat die Moral. Sie ist das Zeichen seines Typus. Jede Zeile, die Blei in diesen zwanzig Jahren geschrieben hat, ist nur befühlbares Sachargument für eine wertende Metaphysik.
(Nicht seine Schuld ist's, daß Marquisenjäger und Zahnstocherathleten sich auf Unterröckchen und Manschettenknöppe stürzten. Wenn Gentleman-Literaten in Lieferungen die "galante Zeit fürs Volk" entdeckten, so zeigt dies nur von neuem die große Aufopferungsfähigkeit Bleis, der, trotz äußerster Gefahr des Mißverständnisses, Anekdoten als moralische Beweise gab!) Soll noch rudimentär und zufällig hinzugefügt werden, daß es an Blei liegt, wenn der große, furchtbare Pascal in Deutschland einigen nicht mehr Angelegenheiten der Dictionnaire blieb?
Doch dies sind ja alte Zeiten. Es ist acuh alles bloß roh biographisch. Und in dem nur historischen Überblick könnte man auch von der Luther-Rolle Bleis als Übersetzer oder Vermittler von allen Erweckern des Moralischen reden.
Aber nun, welches Glück für uns, die notwendige letzte Folge zu sehen, den Querschnitt dieses Typus zu haben; dazusein und zu leben bei der der Formung aufgespeicherter Kräfte. Mitzuerleben, was man doch nicht mehr zu hoffen gewagt hat: der Geist springt hinein in den steinernen Raum der Sache. Es bleibt auf der Welt davon hallend ein Satz, ein Wort; es bleibt ein Wert.
Mit der Anonymität jener Zeitschrift sind wir geistig geworden, seit hundert Jahren zum ersten Male wieder. Von heut an geht es uns nur darum - wie dem alten Zuschauer der Comédie française, der vorm Fallen des Vorhangs wirklich nicht den Namen des neuen Dichters wußte - , ob unsere Sache agiert wird, die Sache; Menschliches beziehungsvoll. Denn jeder Mensch erlebt einmal den Tag, an dem die Sache aller andern bei ihm liegt. Er soll es wissen. Er soll seine Sache tun. Nur seine Kraft wirkt, seine Lebensgeschichte steckt ganz in der "Sache". Biographie gilt nicht mehr. Name ist gleichgültig. -
Hier begann die deutsche Revolution von 1912. Der "Lose Vogel" ist bisher zweimal erschienen.
Der Kampf mit dem Engel (ins Polnische übersetzt von Stanislaw Kubicki)
Jeder Mensch kennt einmal im Leben das Wissen von seinem ganz Menschlichen: Von seinem geistigen Ziel, zu dem er auf der Erde gehen muß, um sein Schicksal als geistiges Wesen zu erfüllen; in das Schicksal wurde er hineingeboren. Alle Menschen kennen in Wahrheit das geistige Ziel des Menschenlebens. Alle Menschen sind beteiligt an dem Ziel, die Erde zu einem himmlischen Reich zu machen, zu wahren Staate Gottes, in dem jede irdische Verrichtung auch einen geistigen Sinn hat; den Sinn da zu sein selbst für den fernsten Nebenmenschen; aber in dem jede geistige Aktion auch eine ganz reale irdische Handlung ist, und nicht mehr fremd und verurteilt zu parasitär okkultem Sonderleben. Von diesem Ziel des geistigen Lebens wissen alle Menschen, aber sie kennen es oft nicht mehr, weil sie es verschüttet haben und vergessen.
Einmal im Leben steht die Offenbarung des Geistes vor jedem Menschen, wie der Engel vor Jakob. Da geschieht: die Menschen entziehen sich dem Engel! Entweder sie flüchten vor ihm, sie bleiben ihm fern, die Trägheit beharrte, und der Mensch wird Untermensch. Oder sie gehen ganz zum Engel über, sie kennen vor seinem Flug nur noch die Engelwelt, sie vergessen ihre Geburt auf der Erde, die Existenz der anderen Menschen, die Vornehmheit siegte, und der Mensch wird Übermensch. Beides ist nur eine Ausflucht. Beides läßt das blutende Dasein und Leiden der Erde unberührt, und in jedem dieser Fälle siegt weder Mensch noch Engel, sondern das losgelassene, dämonische Element der Natur siegt und bricht in chaotischer Zerstörung gegen den Übermenschen und den Untermenschen gleich vernichtend heran. So wird der Kampf mit dem Engel zugleich ein Kampf mit den Gegnern des Menschen sein, mit den Trägern und den Vornehmen.
Wir aber leben auf der Erde, und die Erde ist unsere Aufgabe. Wir können weder Tier noch Engel werden und wir dürften es auch nicht. Uns ist das Geschick gegeben, Mensch zu sein: Die Mitte der Welt. So bleibt uns nichts übrig, als unablässig zu ringen, daß unsere geistige Welt uns stets als das wahre und erreichbare Ziel der Erdenbahn gegenwärtig bleibe. Wer der Gesegnete des Geistes sein will, muß um den Segen kämpfen. Nicht, um selbst über das Menschliche hinaus zu kommen, müssen wir mit dem Engel kämpfen, sondern nur, um ins kleinste Blutkörperchen hinein das Menschliche ganz erfüllen zu können.
Die Führer und Berater der Menschen wissen das Ziel, zu dem sie führen. Aber ihr Kampf mit dem Engel ist, daß sie unablässig die ganze Erdfülle scheinbar kleiner Realitäten durchzusetzen haben, daß sie, aus dem Geiste, unzählige splitternde Erdhaftigkeiten verwirklichen müssen; daß sie Beamte der Menschheit sind, wo sie ihre Verkünder sein wollen.
Für die Erde, für unsere von Blutkratern zerlöcherte Erde, kämpfen wir mit dem Engel. Aber daß wir bis zuletzt uns nicht entzogen, daß wir uns erhoben zum Aufstand für die Erde, dies schon schließt die Segnung des Engels ein. Wer das Ringen um das geistige Ziel des Menschen zu Ende kämpft, der findet zuletzt, daß sein Ende kein Ende ist, kein ruhender Abschluß. Sondern jedes seiner Worte, jede seiner Taten, jede seiner Körperhaltungen, jeder Teil seiner geistgeleiteten Gliedmaßen geht, als frei und losgelöst von ihm, in die Welt ein, weißflammend und stark unter den Menschen wie tausend neue Engel, die mit tausend neuerweckten Menschen ringen werden.
II Marsch zur neuen Zeit
Es ist nötig, im Namen anderer zu sprechen. Jeder muß selbst entscheiden, und von Stunde zu Stunde neu, ob er in einem "Wir" vertreten sein will. Diese Entscheidung, wohin die Menschen gehen wollen, ist gut. Mancher dürfte sich wohl durch eine angemaßte und allzu künstliche Entscheidung in seinem Fortkommen gehindert fühlen; bei andern wieder kann unter Umständen die Gemeinschaft dasein, doch keine Sympathie zu ihr. In jedem Fall ist schon das Entscheidenmüssen ein fruchtbarer Akt, der selbst bei getrennten Wegen die gegenseitige Lauterkeit verbürgt. Man ist schließlich doch nie allein; so fiktiv ist keine Kameradschaft, daß man nicht ganz genau wüßte, wer in der Welt auf uns zählen will! Mit jedem "Wir" und "Uns" wird, trotz allem, für Freunde und Kameraden gesprochen, die wirklich leben, und die eine Partei der geistig Unbedingten bilden, nicht nur in unserer nächsten Nähe. Aber auch nicht unerreichbar oder unsichtbar.
Die Forderung ist: den Kampf mit dem Engel aufnehmen! Die Forderung bedeutet: Wir können gar nicht menschenhaft konsequent genug sein. Aber der Fordernde muß aus seiner Forderung zuerst die Konsequenzen für sich selbst ziehen. Hyänen heulen ringsum. Wer uns ins Unbedingte schaut, wird angefallen. Wer ins Unbedingte schaut, selbst durch ein Prisma; wem selbst es nur aufs Farbenspiel des Prismas ankommt, auch der Troubadour noch wird angefallen. Frondeure, liebe Brüder, wir müssen zusammenhalten. Auch der Mitläufer meint es mit Euch noch besser als die Hyänen. Wir sind eine kleine Karawane, die Wüste ist groß. Sollen wir die Kamele verachten?
Jede Fronde hat Mitkämpfer. Begabte auf fabelhaftem Schreibtischniveau. - Die weithin spiegelnde Glaskugel auf dem Springbrunnenstrahl fällt immer wieder ins Niveau zurück. Unnötig, sie zu stoßen. Der Mitläufer springt zu uns herauf, er fürchtet, den Anschluß zu versäumen. Aber er fällt noch im Sprung ab; er begnügt sich mit dem Ruf des Gesprungenseins. Nennt ihn nicht Verräter. Er ist keiner. Er spiegelt ja nur. Freunde, Ihr habt recht. Wir können gar nicht endgültig genug, gar nicht äußerst genug sein. Wir können uns das Letzte gar nicht weit genug setzen. Unser aller Ziel, auch das Eure, ist zugestandenermaßen eine Fiktion, die wir selbst uns schufen. Benedetto Croce, der Neapolitaner und ein heutiger Humboldt, in seiner "Historiographie": "Vergessen wir nie, daß erst wir selbst die Tatsachen schaffen!" Der Ton liegt auf dem schaffen.
Feststellungen allein, auch die profundesten, fördern weder Euch noch uns. Es kommt darauf an, daß wir unser Ziel, unsere Tatsache: unsere Schöpfung! bewußt wirklich vor uns hinsetzen. Immer müssen wir glauben - und je deutlicher alles um uns sich neigt - immer sicherer, daß nichts uns helfen wird, wenn nicht eine ungeheure Umgrabung des Bewußtseinszustandes des Menschen vorhergeht. Diese Änderung des Bewußtseinszustandes - die "Änderung der Welt" - aus dem Dumpfen ins Menschliche ist möglich. Also nötig.
Gestehen wir, noch lange nicht haben wir sie mit allen Mitteln vertreten. Zu dieser Änderung können wir nur aus einer ungeheuren, ganz absoluten Liebe kommen, die uns selbst überlegen ist. Jedes Wort, das wir sprechen, dürfte nur das belichtende Transparent einer wirklichen Handlung sein, und müßte eine brennende, doch unendlich selbstverständliche Güte tragen.
Statt dessen findet man nur das Brennen. Man trifft allein die Belichtungen an. Aber: rednerische, schriftstellerische, agitatorische Arbeit ist nichts, das für sich da sein dürfte. Politik der Politik wegen: hat uns bis hierher geführt. - Wir sagen die öffentlichen Worte. O törichte und erdenverfluchte Vornehmheit des Denkers! Wir, die wollen, denken, veröffentlichen: Wir haben das Wollen, Denken, Veröffentlichen den Routiniers, den Dilettanten, den Lumpen überlassen. Wir waren feige. Wir waren fahrlässig. Untätig. Lieblos. Vornehm. Jene wurden verstanden. Wir nicht. Wir haben das gewollt. Diese Clubmen-Feinheit war niedrig von uns. Wenn es eine Sünde gibt, und es gibt sie, so haben wir sie begangen. Wir haben zu Menschen gesprochen, wir haben mit der Schaufel in der Hand am Weinberg ihres Bewußtseins graben wollen: in einem unerhört eingewickelten Denk-Chiffrensystem, in einer Philosophengrammatik, die nur Universitätskathedern verständlich ist; in einem Signalfeuer, das voraussetzte, der Empfänger habe seinen eigenen Privatleuchtturm und sei eingestellt auf das Alphabet dieser Raketensprache.
Aber man denke, welche unermeßlicheGüte dazu gehört: verständlich zu sein, immer wieder geduldig von vorn anzufangen, bis ans Ende lesbar - das heißt doch: menschlich! - zu bleiben. Also? Als Aufrufer - Aufrufer sein! Welche Güte, welches Entströmen der mächtigen Liebe zum unbekannten Andern kann aus dem Leitartikel kommen.
Man denke daran, und man wird uns mit Recht verwerfen. Wir dürfen uns nicht wundern, wenn uns eines Tages der Journalist beschämt. Wenn einer kommt, menschlicher als wir alle, entschiedener auf gefährlicherem Posten und mit tieferer Gefährdung seiner Umwelt, mutiger als wir, und darum wirksamer für Anständiges.
In Kritiken, Briefen, Äußerungen vernimmt man stets nur: Die Veröffentlichung ist schön - ist nicht schön. Ist tief - ist flach. Ist realistisch - ist mystisch. Ist harmlos - ist gefährlich. Aber alle diese Urteile sind nur dumpfes Gerede. Würde jemand eine wirkliche Kritik üben wollen, so müßte sie, unter den vielen möglichen Anleitungen, mindestens so aussehen: "Wenn Sie es ernst meinen, dann gehen Sie zu diesen und jenen Erben Treitschkes und reden Sie ihnen zu. Allein die Tatsache Ihres Erscheinens wird die höchste Verblüffung hervorrufen, und Sie haben schon halb gesiegt. Aber nur halb. Wichtig ist, daß Sie stets bewußt sind, der Teil zu sein, welcher die größere innere Sicherheit hat, und die Gerechtigkeit auf seiner Seite.
Nur nie sich durch die wohlstudierte Freundlichkeit des Anderen gewinnen lassen; nie ausgleiten in Anerkennung des angeblichen Auch-Standpunkts des Andern; nie in Mondänität verfallen, wir die Carriere-Demokraten! Auch nie irgendwelchen spezialistisch sicher hingeschnurrten Antworten ein vermeintlich "höhnisches Schweigen" (das nie wirkt!) entgegensetzen, was nur intrigante Damen tun dürfen, die man im Hauptzimmer abfertigt, und die auf der Hintertreppe Gift spritzen. Vielmehr, wenn Sie den Leuten gegenüberstehen, seien Sie sicher, daß Sie ein neuer, heutiger Typus sind, noch unbedingter, geladener noch mit gutem und bösem Zeitenablauf, noch wissend hingerissener als es ehemals die Urchristen waren. Daß Sie allen Gefahren entgegengehen. Und daß Sie nur eintreten dürfen mit der höchsten Besinnung auf Ihre geistige Berufung. Tun Sie alles, was physisch auf die Menschen wirkt. Reden Sie laut und leise, taktvoll und taktlos. Singen Sie, beten Sie, rutschen Sie auf den Knien durchs Zimmer. Nur zeigen Sie, daß Sie die Person von der Sache nicht trennen!"
Was hat denn Fronde überhaupt für einen Sinn, wenn nicht den, die Menschen zu stellen! Sie zu erinnern, daß sie mindestens so anständige Wesen sind, wie wir selbst. Und daß nur ihre, der anständigen Wesen, Zahl größer sei als die unsrige. Und daß sie preiswürdiger seien als wir, denn sie wurden einfach durch uns daran erinnert, daß sie geistige Wesen, Söhne Gottes seien. Wir aber mußten uns selbst erinnern.
Es gibt, seit Herrschaftsfragen existieren, zwei Ströme des Wollens: Den freiheitlichen, der sich meistens von einer positiven Naturvorstellung tragen läßt, und den konservativen, der fast immer ein göttliches Recht zu Hilfe nimmt. Zuweilen dreht das Verhältnis auch um, wie in neuerer Zeit. Es ergibt sich der immerhin ungewohnte Zustand: Wir Freiheitsmenschen der Fronde berufen uns heute so von Grund aus auf ein göttliches Recht, daß wir als Mittler zwischen uns und Gott nicht einmal die Natur mehr zulassen könne. Dagegen die konservativen Elemente unter den Denkern sind so entsetzt über unsere Naturferne, daß sie uns sogar mit spinozistischen Mitteln angreifen. (Ein merkwürdiges Überskreuz-Verhältnis, das nur erweist, wie sehr es dem konservativen Geist lediglich aufs Bewahren eines irgendwann eingebürgerten Denkinhalts ankommt, auch wenn der einmal selbst revolutionär wirkte).
Mißverständnisse sind grober Unfug. Es gibt keine Mißverständnisse.
Immer noch kann man sich nicht darüber beruhigen, daß wir der Kunst ihr Primat nahmen. Muß es wiederholt werden? Kunst ist ein Ausdrucksmittel. Es kommt darauf an, was ausgedrückt wird. Müssen Beispiele genannt werden, daß nur Inhalt: Dienst an der Sache, gilt? Daß - übertragen auf unsere, völlig andere und neue Welt - nur der politisch-religiöse Homer, nur der politisch-religiöse Dante bleibt! Daß nur die Kirchenmusik, die wahrhaft dienende, existiert. Daß uns der Zeitgenosse der vorletzten Generation, etwa Richard Strauss, ebenso fernsteht wie sein Cousin Paul Lincke! Nur die großen Dienenden können Führer sein! Daß uns die außerordentliche, aber indirekte Malerei Manets anödet, aber daß ein neuer Pisaner Maler vom "Triumph des Todes" unser Mann wäre - allein er würde zum Triumph ganz anderer Zustände als dem Tode führen. Wie erst, wenn die großen Diener in Musik, die Palestrina, Heinrich Schütz, Bach, wenn sie Heutige wären, neu und erstmalig, und, in unserer Zunge, uns leiteten mit zu neu erstandenem Leben aus dem Geiste auf Erden. Wenn sie uns heute sagten, wie jene Musiker den Ihren: so sollt Ihr Euer Fühlen lenken!
Muß man immer wieder zeigen, daß jene Beispiele unserer Gegner, die hohlköpfig gegen uns darlegen sollen, "Gesinnung allein sei nichts, [angeblich], wenn die künstlerische Fähigkeit mangle", - daß jene Beispiele falsch sind! Weil Gesinnung sich nie am Unvollkommenen nachweisen läßt, sondern stets nur da, wo sie bis zu Ende spricht.
Man muß es immer wieder zeigen. Und doch ist es nicht sehr wichtig. Wenn wir immer wieder rufen müssen: "Kunst an sich ist nichts. Der Inhalt ist alles!", so beweise das nur, daß unsere Inhalte dürftig sind. Wären sie es nicht, dann wäre die Diskrepanz nicht möglich. Dann würde der Wert, das Göttliche, Geistige, Heilige (was eben ja man allein "Inhalt" nennen kann!) schon längst das dienende Ausdrucksmittel, seine bloß variationale Anwendung, deutlich bestimmt haben. Ein ganz selbstverständlicher Vorgang würde das sein. - Aber so mußte man erst noch laut rufen. Wonach eigentlich? Nach Herrschaft der Geistigen - oder, nur boshaft, nach Machtlosigkeit der Dienenden?
Indes, wie blind waren unsere Gegner, als sie nicht sahen, daß wir nur schamhaft verschleiert sprachen. Sei es nun enthüllt: Wir, wir gaben der Kunst - indem wir sie aus dem angemaßten Inhaltswert vertrieben - erst wieder den Inhalt. Wir gaben ihr, deren Existenzberechtigung wir verneinten, erst wieder neue Existenzmöglichkeit, neue Geburt, neues Sein, neuen Quell, neue Aufgaben. Wir befreiten sie von der Wiederholung, diesem Totgebären, und führten sie zur Schöpfung. Und frage man einen großen Dichter, einen bedeutenden Musiker, sogar einen Maler von Zwang - sie werden das bloße Tun um der ruhenden Seligkeit des Tuns willen als die sinnlose Behauptung ärmlich leerer Nachahmer erkennen, die übernährte Selbstbetätigungssucht saturierter Erben, wuchernd an übernommenem Kapital. Den wirklichen Schöpfern sind ihre Künste nur Verständigungszeichen. Doch nicht das Zeichen, selbst nicht die Verständigung ist wichtig. Wichtig ist, worüber man sich verständigt.
Wir sind gegen die Musik - für die Erweckung zur Gemeinschaft. Wir sind gegen das Gedicht - für die Aufrufung der Liebe. Wir sind gegen den Roman - für die Anleitung zum Leben. Wir sind gegen das Drama - für die Anleitung zum Handeln. Wir sind gegen das Bild - für das Vorbild.
So weit die kommenden Künstler auch von uns entfernt sein werden, dennoch werden sie nichts ohne uns sein. Sie werden nicht aus eigener Absicht der Person sein können, sondern alles nur aus Inhalt. Und sind sie nur einigermaßen Mensch, dann werden sie auch nicht Künstler sein, sondern Mitteiler, inspirierte Geber, Ausrufer der ewigsten Forderungen von Menschensinn. Auch das kleinste Vaudeville wird ohne uns nicht möglich sein!
Wir sind Wollende und Fordernde. Propheten haben es gut bei uns, weil sie nur unsere Forderungen ins Kommende zu versetzen brauchen. Aber wir selbst sind keine Propheten; wir fänden es unlauter, selbst Prophet zu sein, denn Prophetie, das hieße: unser Wollen als einen bestehenden Zustand zu betrachten. Wir fänden es unlauter, uns mit der Realität von morgen zu begnügen.
Wir sind keine Beschreiber.
Wir sind Rationalisten.
Wir sind die Menschen, welche verkünden, daß das Geschlecht dieser Erde ein geistiges Geschlecht ist. Daß wir Wesen aus göttlichem Strahl sind. Und daß wir uns danach zu richten haben. Wir verkünden, daß wir unsere Abkunft von Gott nicht vergessen dürfen. Und wenn wir sie vergessen sollten; selbst wenn uns die Erinnerung an unsere höhere Existenz schwände; auch wenn unsere Geistigkeit - das ist die Sprache der Wesen göttlicher Geburt - uns nur als eine Fiktion erschiene: Noch dann müssen wir die Würde des Geistwesens Mensch als letztes und erstes Ziel des Lebens vor uns setzen.
Das ist Rationalismus.
Zielsetzen ist Rationalismus.
Kein Ziel setzen ist: Sünde.
Man glaube uns doch, daß wir unsere Erdheit, unsere Tierheit, unsere Natürlichkeit ebensogut kennen wir unsere Gegner. Mußten wir nicht tausendmal den Weg durch unser Dasein zurücklegen, hin zu unserm Unbedingten? Unsere Gegner fordern in lächerlicher Unwissenheit, daß wir bei unserm Dasein verweilen. Daß wir zufrieden seien. Darum so lächerlich, weil sie, die gegen das Fordern sind, unversehens selbst fordern, nur unversehens.
Aber wir versehen uns des Daseins und der Natur, des Bestehenden, des Gegebenen und Seienden besser, als die darin versinken. Denn wir brechen durch im unmittelbaren Aufstand unseres Wesens zum Geist. Das Ziel selbst nur zu nennen ist schon ein ungeheurer Griff in die Welt.
Allein nie dürfen wir die furchtbarste Mahnung in Vergessenheit fallen lassen: Das Dasein selbst existiert nicht; das Bestehende existiert nicht. Wir machen alles erst! --- Unsere stärkste Forderung, die der Rationalisten - und welche uns über das Niveau bloßer erbärmlicher Rechner erhebt - ist die Forderung: Abkürzung der Qual. Ausschaltung des Bestehenden, das sich an uns breit macht, das nur durch uns geschaffen wurde, durch unsere naive Zubilligung seiner Existenz. Es ist grausigstes Hindernis, In-die-Länge-Zerrung der Leiden. Damm vor unserem Vordringen zum Menschentum. Wir fordern Ausschaltung!
Abschaffung.
Wir brauchen die Änderung der Welt. Aber ohne eine Änderung unseres Bewußtseinszustandes aus dem geduldig Dumpfen ins menschenartige Helle wird uns eine einfache formelle Umschiebung der Tatsachen nichts helfen. Die Arbeit an der Änderung unseres Bewußtseinsstandes, diese Gigantenarbeit: uns dem Leben im Urzellenstand zu entreißen, und das Leben im Geiste, das Leben zu Gott uns vorzusetzen; das Leben nicht im Relativen, welches uns fesselt, sondern zum Absoluten, welches uns frei macht -- diese erbitterste aller Tiefbohrungen, diese Umwühlung von Ewigkeit her ist
Rationalismus.
Das schöpferische Leben besteht nicht von allein. Wir müssen es erst schaffen. Rufen wir für uns einen Bruder auf, den unsere Brüder hier über zwei Jahrtausende grüßen werde. Herodot. Er war für uns. Er war für die Menschen da, er war doch wohl, wie wir, Weltverbesserer, Rationalist. Ein Wort Herodots, das in unserm Mund erst Leben und Wirksamkeit haben wird: "Laßt nichts unversucht. Denn es geschieht nichts von selbst, sondern der Mensch erlangt alles erst durch seine Unternehmungen!"
III Die Gegner
Nun, da wir alle so viel durchgemacht haben, darf da noch einer sein, der Menschentum für eine Phrase hielte? Nun, da Millionen Zufriedener wissen, wie Hunger ist, darf da noch einer sein, der nicht jedes Mittel zur ewigen Beseitigung des Hungerns guthieße? Geist ist die Äußerungsform Gottes gegenüber dem Menschen, und die darum eine Gemeinsamkeit für alle Menschen bildet. Geistige sind die Menschen, welche durch diese Gemeinsamkeit vor dem Absoluten sich in einer besonders großen Verantworklichkeit gegenüber den anderen Menschen verpflichtet fühlen. (Im Gegensatz zu allen modernen Mystikern, die behaupten, ein Privatabkommen mit Gott zu haben, da sie aller handelnden Verantwortung überhebt.)
Man hat gegen die Geistigen alles unternommen. Man hat uns bekämpft, man hat uns denunziert, man hat uns zu sehr - zu wenig - radikal, demokratisch, sozialistisch genannt. Man hat uns Verräter geheißen, man hat uns ignoriert, man hat uns gelesen, verlacht, aufgenommen, benutzt. Nur nicht verwunden.
Aber wie kläglich sind unsere Gegner. Diese Blumentöpfchen von Denkern! Da ist das unsichere Schäfchen, das alles mitmeckert, den Frieden und den Krieg, Volkstum und Dynastie: das sich nie entscheiden kann trotz des historischen Kotelettebärtchens, das an einen alten tapfer unbedingten süddeutschen Landesgenossen demokratisch erinnern soll. Es rettet sich stets in die List, aus purer Angst, vors Gericht des Geistes geladen zu werden und seine Ausflucht ist, wohlwollend die Geistigen längst dagewesen zu finden. Aber jener ahnt gar nicht, wie dagewesen wir erst ein Jahrhundert später sein werden! - Heran springt der übliche wilde Kriegsindianer, der dem Staat empfiehlt, uns zu füsilieren. - Aufzug, wankend, des umständlichen Stammlers, der zwecks Empfehlung seiner eigenen, heiser vorsichtigen Postillen, undeutlich Erbittertes gegen uns hustet.
Mit forschem Zinnsoldatenschritt marschiert, einer für sich, der Kulturkonservative, von niemandem als seinem eigenen Entschluß zur politischen Repräsentation beauftragt, trocken, intelligent, und vielleicht nur durch massiv kapitalistiche Umgebung bei allzu dicker Naivität geblieben. Er findet es gewöhnlich unerhört, die bloße Konstatierung dessen, was ist, zu verlassen. Eine Diskussion, die keine ist, denn unser Ziel ist ja gerade die strömende, zeugende Fruchtbarkeit, gegenüber einer Konstatierung des Seienden - welche uns bloß Nehmen, Wucher und Selbstgenuß bedeutete.
Schiefe Köpfe, gute Herzen, achtbare Leute. Sie sind entrüstet. Und selbst wenn sie uns in die Hitze minutenweise den Tod wünschen, so kann man sich immer noch mit ihnen freundlich hinsetzen und ihnen zeigen, wie fahrlässig sie handeln. Wir wissen den Moment, wo sie zusammenbrechen werden und mit stumpfer Miene einsehen, wie sie persönlich fast verbrecherisch gehandelt hätten. Oder steht unseren Gegner, den Erlebnisphilosophen; er denkt begeistert alles mit, wie es auf ihn zustößt, den Krieg, den Frieden, den Waffenstillstand; und er wird sein Lebenswerk schaffen als eine "Philosophie der Conjunctur", tief ehrlich, immer von neuem aus der Bahn geworfen. Er hält es für gut, das Gegebene - das jedesmal ihm blindlings ohne sein Zutun Gegebene - zu bejahen, und aus dem einen Moment, der eben herrscht, die ganze Welt zu entdecken. Er hält das Erlebnis nicht für die Lehre des Lebens, nicht für den Weg, den wir durchs Material hindurch zum Unbedingten nehmen müssen, sondern für sein Ziel.
Er wäre sogar bereit, uns das Erlebnis zu verschaffen - in der Meinung, wir wüßten nichts davon. Die alte schlechte Voraussicht der Nur-Methoden-Menschen, dem andern das Erlebnis verschaffen zu wollen: sie verwirklichen sich im besten Fall als Intrigue! - Und herzu lügen sich die letzten Widersacher: der unschöpferische Schreiber, der Phantasielose, der Talentarme; das grobe ungefügte Handgelenk; der ungeistig Geistgelähmte. Der literarische Couleurfriseur im Renommierschmiß-Stil. Der gebildete Reisebrief-Lakai der Zeitungen. Gasmaske her von den Feuilletonrülpsern des vollgeschlemmten Kajütenbauches aus finnigem Ferkelchenmaul. Die religiösen Reiseredner fürs Hapag-Dessert. Die Antithetiker des Lebens: Zionisten aus Judenhaß. Imperialisten aus barbarossaschem Humpenrittertum. Der ärmliche Passagierpublizist, der die Erde aufgeteilt hat nach Novellenmotiven, Romanstoffen, Journalbriefen, und zähneknirschend sie zeilenmessend absuchen muß, um amtlich nachweisbar überall seinen Bleistift aufgepflanzt zu haben. Die Exoten-Wippchen der nördlichen und südlichen Halbkugel. Und zuletzt die erlogenen Freunde, die mitgehen nicht für die Sache, nicht für den Geist als Unbedingte; sondern um, gut berechnet, in der Gesellschaft der Zukunft gesehen zu werden; um der Gegenwart sich als Vermittlerpöstchen zu empfehlen!
Droschkenkutscher her, Straßenreiniger her, Steinsetzer her, Dienstmädchen her, Waschweiber her; Mob, Unterproletariat, Verzweifelte, Unorganisierte her, die nichts zu verlieren haben; Besitzlose, ganz Besitzlose her! Menschen her! Her zu uns, wir sind für Euch da! Die Zeit geht dem Ende entgegen. Einmal wird der himmlische Horizont wieder an die Erde stoßen, und der Umkreis unserer Augen wird wieder den Glauben sehen, das Wissen von göttlichen Werten. Dann werden die, welche in Europa ihren Mund auch nur ein einziges Mal haben das Unrecht sprechen lassen, für immer in der Jauchegrube des Vergessens ersticken. Aber sie sind keine Gegner. Nur Mitläufer der vergangenen Zeit; Mitwürmer der Verwesung, Mitgerüchte der Auflösung.
Wo ist unser Gegner, der Gegner? Ich vermisse den Teufel. Warum ist er nicht da? Der Inbegriff des Elementaren, zustoßend Erlebnishaften, der geschleuderten Seele, des Isoliertseins! Der Inbegriff der Welt - gegen den Geist! Der Inbegriff des Einzeltums gegen die hohen, südlich lichtbauenden Bogen des Allgemeinen. Wo blieb der Teufel?
Aber der Teufel ist nicht mehr da. Er zerfloß, als wir ihn erkannten, als wir ihn benennen konnten; als wir aussprachen, daß nicht der Sturm, das Getriebene, das dämonische Element, das Wogen der Seele: daß nicht er menschenhaft sei, sondern der Geist. In unserm Kampf mit dem Engel wird zur selben Zeit auch gewirkt die Beschwörung des Teufels. In unserer neuen Zeit des Absoluten ist der Herr des Relativen nicht mehr Feind. Und von ihm blieben nur dünne, erstarrende Blutstropfen zurück: die Tänzer, Sänger, Schauspieler; die Künstler, die Reizbetäuber. Unwissend ihrer selbst, im Absterben. Der matte Bleichblut-Tod einer zusammengefallenen Luxuswelt.
Ihr, die Ihr uns geistig Freund seid, Ihr könnt den Einzelnen nicht trennen von den wenigen Anständigen des heutigen Tages, von Kameraden, mit denen man sich nicht zufällig zusammenfand. Und wenn es mit rechten Dingen zugeht, dann werden wir Genossen die mitlaufenden Amtskandidaten überreden, das Amt fahren zu lassen, und sich um ihre ewige Seligkeit zu kümmern, die da ist: ihre Haltung vor dem Auge der Ewigkeit. Wenn es aber mit unrechten Dingen zugeht, dann müssen wir versuchen, sie recht zu machen. - Herodot: "Laßt nichts unversucht!" - Und wenn sich herausstellt, daß jene bei unrechten Dingen verbleiben wollen, daß sie nur die Oberhand suchen, daß ihnen die Sache gleichgültig und nur der Streit wichtig ist; daß ihnen das Vergnügen künstlerischer Schlußfolgerungen lieber ist als der Ruf der Menschlichkeit; daß sie nur bloße Themen behandeln (Schriftsteller), und nicht Handlungen vertreten; und daß sie auch nur über ihre Themen denken, schreiben, drucken, reden, ohne im geringsten ihren persönlichen Leib mit ihren Worten zu identifizieren ...
Wenn also sich herausstellt, daß jene nur ruchlose Betrachter sind, anstatt Zeuger zu sein - dann ist damit nur ein gravierender Beweis gegen uns selbst geliefert. Dann ist der Beweis geliefert, daß wir selbst nur zu vornehm, zu eitel, zu lau waren. Daß wir selbst nichts getan haben, um irgendeinen Menschen von der Würde des geistigen Lebens zu überzeugen. Daß wir nicht überzeugen, weil wir selbst kein Beispiel geben. Daß wir ohne persönliches Beispiel nicht Führer sein können. Und daß nur die Führer das Recht, die Fähigkeit und den Standpunkt zu einem Lebensurteil über andere haben (auch wenn sie darauf verzichten). - Ein Urteil, abgegeben aus Hochmut, ist gar nichts wert, es ändert nichts. Zwingend ist nur ein Urteil aus Liebe.
Die politischen Parteien haben für den Mann, der ihr Programmatiker ist, einen wilden Ausdruck von der Rennbahn: sie nennen ihn "Einpeitscher". Es kommt aber zuerst nicht darauf an, Meinungen einzupeitschen, sondern sie zu vertreten. Es kommt zuerst darauf an, seine Meinung selbst zu sein. Es gibt kein Privatleben. Es gibt nur den öffentlichen Menschen. Entweder wir sind öffentliche Menschen - oder wir sind nichts. Entweder wir sind öffentliche Menschen - oder wiederum wird in den nächsten hundert Jahren alles niedergestampft, niedergeschossen, niedergebrannt, was wie bisher nur gelernt hat, die Person von der Sache zu trennen. Entweder wir sind öffentliche Menschen - oder wiederum hundert Jahre bleibt das geistige Leben, die Sache - ohne die Person - nur ein Zungenschlag, ein Demutsspiel für alte Damen.
Entweder wir sind öffentliche Menschen - oder wir bleiben Suppenesser, Schläger, Vergnügungsreisende mit verschmitzten Denkreservaten, und schließlich Gerippe, deren Existenz nie über eine, von Komplikationen begleitete Stoffwechseltätigkeit hinaus gegangen ist. Glauben wir aber: es gibt schon öffentliche Menschen! Es gibt schon Führer. Also wird es auch in allen Ländern der Erde bald mehr gegeben. Jeder Mensch ist geschaffen, ein Führer zu sein. Jeder Mensch ist unersetzlich. Der öffentliche Mensch kennt die Unersetzlichkeit des Bruders. Der öffentliche Mensch führt uns zum Leben im Geiste. Aber Leben im Geist ist zuerst Leben auf der Erde, wirkliches Leben, Lebendigsein im Fleisch. Und nur wenn wir zuerst selig sind über die Existenz des Nebenmenschen, werden wir dem Nebenmenschen Führer sein.
IV Der Führer
Der Führer ist überall von dem großen, bebenden Völkergeschöpf umgeben, das unaufhörlich seine Gestalt und seine Substanz ändert. Immer liegt es zitternd um ihn. Er ist kein besonderer Mensch, er denkt einfach, er ist nicht merkwürdig und schön. Er hat schon den faltigen Schauspielermund, er hat den kurzen wichtigen Schritt, der über viele Tribünen geht. Er weiß längst, wie er seinen Augen kommandieren kann, und er muß auf neue Register der Erregung sinnen wie der Akrobat auf neue Trapezsprünge. Er merkt bei allem, wie er der Mitmensch seiner Genossen ist, und er ist jede Sekunde darauf gefaßt, daß aus der ungeheuren Menge, zu der er spricht: einst ein Bruder aufsteht, der noch zum ersten Male und unabgenutzt den Mund öffnet. Und der ihn zu einem Häuflein Asche verwandelt, weil in seiner Hand die wahren Blitze Gottes ruhen. Doch bis dieser Augenblick eintritt, wird er selbst, mit allen Mitteln, mit der abgenutzten Wahrheit, mit dagewesenen Blitzen und den großen unermüdlichen Beteuerungen vom Wissen: seine Pflicht tun.
Er weiß sich eine kleine, Störungen unterworfene Blutsäule. Er kennt seine Kleinheit. Um ihn herum liegt die Ewigkeit. Um ihn, überall, steht die Gewißheit so sicher wie die Horizonte, die sein Auge überkreist in der Ferne. Um ihn, über ihn strömen die Saftstrahlen des Absoluten, sie schießen in eine kristallene Glocke rund über den Erdball hinaus; fern und blaß ziehend wie die durchscheinende Milchstraße schwebt die unbedingte, göttliche Wahrheit um den Menschenball.
Der Führer weiß, wie fern und wiederholt er ist. Er will zur Ewigkeit. Er will, daß sein Schritt mit der Drehung der Erde gehe (der Schritt des Magiers). Er will, daß seine geballte Faust abgestorbene Planeten zu Himmelsstaub drücke. Er will, daß seine Augen, die den Blick der Menschen aufwärts blitzen, eine Straße wahrhaft ins unbedingt Zukünftige bauen; er will, daß die Worte, die sein Mund als Fackeln auswirft, die zwar flammen aber nur aufs Geratewohl zünden, wahrhaft unabänderlich in die Welt gefallene Tatsachen seien.
Er will nichts anderes als die Ewigkeit. Aber er weiß, daß er ihr namenlos fern ist. Er weiß, daß die Menschen um ihn in einer grauenhaften Ungewißheit leben, und daß er sie nur aufrecht erhält, indem er ihnen von Zeit zu Zeit die Ewigkeit nennt. Aber er, was ist er denn? Ist er anders als jene? Auch er kann sich ja nur der Ewigkeit erinnern. Er kann sie nicht geben.
Kein Mensch von uns allen will vollkommen allein auf der Erde sein. Niemand will der Einzige sein - und um sich, unter sich, neben sich die Kugel leer von Menschen. Wußten wir es je, denn gewiß heute, daß es keine Übervölkerung der Erde gibt. Die Freiheit, die jeder Mensch auf der Erde will, heißt keinem, daß es um ihn öde sei. Im Gegenteil. Mit ihr meint man die Kraft: inmitten der Menschen vollkommen den Raum lebendig zu schaffen, in den man geboren wurde. Dies heißt: seinen Platz ausfüllen. Freiheit ist kein Begriff, der mit Moden oder intellektuellen Zeitströmungen kommt und dann wieder alt und wertlos wird. Freiheit ist ein ewiges und absolutes Ziel. Dieses Ziel schließt als etwas ganz Selbstverständliches das Wissen um die Unersetzlichkeit jedes einzelnen Menschenlebens ein. Nur der sinnlos teuflischste Bureauindustrialismus konnte zu der Entwertungsformel vergangener Jahre kommen: "Kein Mensch ist unersetzlich." In Wahrheit ist keiner ersetzlich. Denn mit dem Tode jedes Menschen wird jedesmal von neuem eine ungeheure und unausgeschöpfte Möglichkeit zu fleischgewordener Liebe vernichtet. - Aber zur Freiheit, zur Fähigkeit, seinen Platz als Bruder des Menschen auszufüllen, gehört das Wissen von der Einmaligkeit dieses Platzes.
Wir müssen einmal ihn ganz und allseitig stark sehen; es bleibt uns nichts übrig, als aus allen unseren vorhandenen Kräften einen unsichtbaren Turm zu bauen, von dessen riesenhoher Spitze wir unsere eigene Bestimmung in der Welt schauen, als wäre sie der Liniengang einer kleinen, bewegten Schachfigur. Dies ist das Wunder, an das wir glauben. Es ist nichts anderes, als daß wir in aller unserer gesammelten Energie vor das Absolute treten wollen. In dem Moment, wo wir zu Gott gehen, sehen wir uns selbst.
Aber dieser Augenblick wird uns nicht geschenkt; wir müssen alles selbst tun. Unseren Weg zu Gott wollen wir in einem Nu zurücklegen. Doch die Fähigkeit dazu wäre selbst schon göttlich. Man mißtraue den Mystikern, die ihre angebliche Einheit mit Gott bezeugten; sie waren entweder hingerissene Beschreiber von bloßen Seelenzuständen, oder sie drückten sich aus Wortmangel falsch aus, oder sie irrten. Wir sind selbst nicht Gott, nicht absolut, sondern Geschöpfe der Absoluten. Wir sind einfach Menschen. Wir sind nicht selbst Geist, sondern wir sind geistige Wesen.
Zwischen dem Absoluten und dem Menschen gibt es Stufen, und sie können dem Menschen helfen, zum Bewußtsein des Absoluten zu kommen. Doch nur, wenn er stets nicht sie erreichen will, sondern das Absolute selbst. Der Mensch muß auch mit der Hilfe kämpfen, die jene Zwischenexistenz ihm gewährt. Der Kampf mit dem Engel ist allein der Weg zu Gott.
Der Führer befremdet uns immer von neuem ein wenig. Vor uns wird er nie eine gewisse Lächerlichkeit los. Gleich darauf entzückt er uns, weil er von Dingen sprach, die die unsrigen sind. Doch dann bemerken wir, daß die Wege, auf denen er unser Bruder ist, uns lange selbstverständlich sind. Neuer Grund, ihn geringzuschätzen, und wir verurteilen uns, da wir bereits die Nennung eines uns werten Ideenkreises als Teilung des gleichen Interesses nahmen. Wir achten den Führer nicht, weil er nicht unser Leben teilt, und dennoch Führer ist.
Aber wir sind im Irrtum. Es ist der Irrtum der Vornehmheit. Unsere Vornehmheit - die Bequemlichkeit und Feigheit ist - hat das Leben in bloße Themen aufgeteilt. Der Führer befremdet uns, weil ihm nichts Thema ist, sondern alles Idee. Er denkt nicht, wie wir fahrlässig Zurückgezogenen, über eine Idee nach, sondern er denkt in einer Idee. Er scheint uns beschränkt zu sein, doch seine Begrenzung läßt in Wahrheit nur diejenigen unserer Lebensangelegenheiten zu sich, die ihm zu wirklichen Lebensleitern werden.
Wir erwarten vergeblich, daß er unsere bequeme Allseitigkeit zum Ausgang des Führertums nehme. Wi erwarten dies darum, weil wir selbst nichts für unsere Angelegenheiten tun, sondern sie nur betrachten wollen. Unsere Vornehmheit kommt daher, daß wir die Tat für uns immer einem Anderen zuschieben wollen. Wir erwarten, daß der Führer unsere Sache tue, die wir selbst noch nicht einmal entschieden haben. Wir schätzen ihn gering, weil ihm unsere Revolten in der Tasche - und die uns selbst nur Ausflüchte sind - nicht am Herzen liegen. Wir wünschen von ihm, daß er unsere Vorstellungen in greifbare Wirklichkeit setze, jetzt gleich, bis heut Mitternacht; unsere Vorstellungen, zu deren Verwirklichung wir selbst keinen Schritt getan haben. Wir wünschen von ihm das "Gleich Jetzt!", und uns selbst gewähren wir ewigen Aufschub.
Dabei vergessen wir: Er ist der Führer! Er führt auch uns. Aber wohin führt der Führer? Er führt zum Geist. Führer sein, heißt, zum Geist führen. Allein zum Geist. Wer nicht zum Geist führt, kann vielleicht ein begabter Vortänzer sein, aber nie ein Führer. Er führt uns zum Geist auf allen Wegen, die des Geistes sind: Der Umkreis, den wir Politik nennen, ist seine Bahn, die Ermöglichung unserer menschlichen Gemeinschaft.
Der Geist ist das Palladium der Gemeinschaft.
Die Materie ist das Abzeichen der Isolation.
Man sagt, die Unterscheidung: hier Geist - dort Materie - - sei eine nur schulmäßige Bequemlichkeit. Sehr gut! Jene Scheidung ist auch falsch, solange sie nur deskriptiv gemeint ist und behaupten will, sie stelle vollzogene Tatsachen dar. Aber sie ist herrlich: sie ist schöpferisch, wenn sie eine Forderung ist. Nur mit dieser Forderung, allein durch sie, leben wir: Seid geistige Wesen! Stammt von Gott ab!
Wenn unser Leib jetzt am Leben bleibt, so haben wir die Gelegenheit, gerade noch Blicke aus den schmalen Luken eines schauerlich versinkenden Zeitalters hinaus in eine neue Zeit zu tun. Aus dem Zeitalter der sinnlosen Welt - um es genau zu sagen, wie denn eigentlich die "Materie" aussieht: sie sieht aus wie die Welt, das Sein, das Gegebene, das für uns ewig Gewesene. Die Welt liegt da vor uns, um von uns geknetet, geformt, gestaltet zu werden, stets von neuem, nach göttlichem Plan, dessen Zeiger wir sind.
Aber wie menschvergessen, wie ursprungs- und gottvergessen ist es, sich von der Welt, der Materie, kneten, formen, gestalten zu lassen. Als sei man selbst Untermaterie. Die Elemente drängen in uns hinein, jene Macht, die man dämonisch nennt. Nur der Ungeistige wird vom Dämonischen übermannt. Alles, was an uns erlebt, das Seelische, das Außergeistige an uns ist, ist ungöttlich. O sinnlosestes, chaotisch blutendes Zeitalter, das nun zusammenbricht, Zeitalter des Erlebens, der Seele, des Elementenspieles! Es geschah das große Sichpassivmachen. Sichaufteilen als Objekt für Gelegenheiten. Jedes fremde Objekt zwischen sich und Gott treten lassen, ohne dazu etwas zu tun.
Das Ereignis - den Accident- den Rohstoff des Lebens, dei Natur, wie einen Billardball an sich stoßen lassen, und im Anprall erst das Ich vermuten. Zeitalter des ewigen Nehmens! Denn Erlebnis - in rückschlagender Rache ausgesetzt sein dem dämonisch Elementaren - ist: Nehmen. Während doch unser Leben die Liebe ist, und wir zu geben haben, geben, geben geben, und umso mehr, je geringer die Zahl der Menschen auf der Erde wird, und wir einsamer werden. Das vergehende Zeitalter versuchte, das bloße Bild des Lebens zu genießen, ohne es selbst zu schaffen. Aber wir haben zu leben, um mit unserem Leben der Welt geben zu können.
Grausamer Millionentod ist die Gipfelung des elementarischen Zeitalters. Heraus aus dem Elementaren, aus der Seele, aus der Vereinzelung! Heraus aus dem Treibenlassen, aus dem Besitz des Gewesenen, aus dem Erlebnis! Seid göttliche Wesen. Geht in die neue Zeit des Geistes. Seid Führer zum Geist.
Wir haben die Erbsünde, sie heißt heute für uns: Isolation. Sie ist Insichsein, Einzelner sein, Seele sein. Nehmender sein.
Wir haben auch die Erbliebe. Und die ist: Geben; Schöpfer sein; Genosse, Mitmensch, Kamerad, Bruder sein. Die Erbliebe heißt. Gemeinschaft!
Nichts wird von unserm Kampf mit dem Engel uns erspart. Keine Mythologie steht zu unserer Hilfe mehr da. Zwischen uns und Gott het nichts Gewesenes mehr Platz.
Der Mensch machte es sich leicht. Er formte eine Wachspuppe nach seinem Bilde, beweglich, lebensgroß mit Vollbart, langem Bart und Schlapphut. Sie steht auf ihrem Wachsfigurenpostament im Fürstensaal des Panoptikums. Der Mensch dreht das Uhrwerk auf, sie hebt mit knackendem Ruck eine Trompete krächzend an den starren Mund, darnach stößt die dünne, rostige Laute aus, die vorbereiteten Ohren ähnlich klingen wie "Revolution, Revolution!" Eine ungeheure Wachsfigurengebärde schüttelt den Mantel über der Holzschulter zurecht. - Der Mensch steht befriedigt vor seinem Werk. Noch ist er nicht totgeschossen; so geht er höchst angeregt schlafen.
Der Mensch schläft. Kein Führer ist für ihn da, denn er selbst wollte nicht Führer sein. Unterdessen stehen die Führer der Dämonen grinsend bereit, gigantische Metzgergesellen, geschürzten Arms, mächtig mit erdachsengroßen Maschinengewehren, die Fleischfetzen und Totenklumpen bis zu den Sternen hochspritzen werden.
Die Dinge sind so einfach. Dennoch muß man um sie kämpfen. Was wir wollen, ist gar nicht neu. Es ist nur ewig. Der Führer will immer wieder alles in der Welt plötzlich, mit einem Ruck und auf einmal ändern. Er sieht, daß dies nicht möglich ist. Aber er sieht auch, daß der sichere Glaube, trotzdem sei es möglich, nötig ist, um auch nur einen kleinen Schritt zurückzulegen. Der Kampf mit dem Engel besteht darin: Nicht zu resignieren.
Resignation ist Vornehmheit.
Nicht vornehm sein!
Immer wieder steht der einfache Mann - auf den wir herabsehen - als Führer da. Immer wieder sind wir die, welche vom Volksmann geführt werden, da wir nicht selber führen! Der einfache Mann, der Führer, ist weder talentlos, wie wir glauben mögen; noch ungenial, wie wir ihn zwecks verbitterter Karikatur einschätzen; noch ist er absonderlich zufällig. Sein Talent, seine Gabe, sein Genius, seine Notwendigkeit, ist: der vollkommene Mut, sich ganz hinzugeben, nicht Eigener im Besitz einer Seele zu sein; ganz erfüllt noch im letzten Blutstropfen Vertreter des Geistes zu sein. Auch auf rückständig kindlichen Irrtümern noch der gerechte Führer zu Geistigem zu sein. Nichts übrig zu lassen von sich für einen anderen als den öffentlichen Menschen. Kein Privatleben, keine Privatansichten, Privatfreunde, Privatfreuden mehr. Gleichviel was er sonst hätte sein können, und wie in einem anderen Leben seine Gemütseinstellung zu uns gewesen wäre (eine Perspektive der Unwirklichkeit, nach der wir ihn fälschlich beurteilen); gleichviel: Er ist der öffentliche Mensch, und das ist er ganz. Dies ist, gesehen vom obersten Turm der Menschenschicksale, seine göttliche Stellung in der Welt. Er erfährt oft sehr spät, in der höchsten Krisis der Menschheit, daß er göttliche Gesetze ausführt. Er kämpft mit dem Engel, um seine Besitzlosigkeit zu wahren, um nicht abzufallen zu dem Parasitenluxus des Augurentums; um trotz seines Hindurchschlüpfens durch eine neuere und vielverbrannte Haut von Menschenkenntnis, dennoch mit der Unmittelbarkeit des scheinbar Naiven auf das Geistige und Absolute hinzugehen.
Wir sehen nicht, wie er kämpft. Seine Robustheit erschreckt uns, und seinen göttlichen Platz in der Welt erkennen wir erst, wenn er unsere eigenen Unterlassungen vertritt und mit auf sich nimmt. Wenn er laut unsere Sache führt, die Sache des Geistes.
Doch unser eigener Kampf mit dem Engel liegt auf umgekehrten Bahn. Wir müssen herabsteigen. Jeder Schritt, den wir aus unserer erhaben skeptisch überwissenden Isolation herab in die heilige Vulgarität tun, vollzieht einen Teil unserer Aufgabe in der Welt. Heraus aus unserer Seele! Hinab in die Allgemeinheit! Wir ringen mit dem Engel, weil wir ihn uns einverleiben wollen. Wir wollen selbst der Engel sein - und können uns nicht entscheiden, ob aus Hoheit oder Trägheit. Aber wir sind, im schönsten Fall, nur einfache Menschen. Wir können nicht aus uns heraus Gesetze diktieren. Uns diktiert sie der Geist, und wir sprechen sie nur gesetzgeberisch aus, in Not, weil kein anderer da ist, der es zeugnishaft und bekennend täte.
Aber um Gesetze aussprechen zu können, um führen zu dürfen, müssen wir sie vom Munde unseres Lebensengels ablesen. Ablesen die Gesetze vom Munde des Völkergeschöpfes. Nichts mehr darf an uns bleiben von Überlegenheit. Nur Heiligkeit darf noch bei uns sein; aber mehr noch ist der Weg durch die Gosse. Erst wenn wir freiwillig vor der tiefsten Gewöhnlichkeit angekommen sind, erst dann sind wir befugt, Pläne zum geistigen Leben zu zeichnen: Führer zu sein. Zum Engel sprechen: "Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn!" ist immer wieder der Akt höchster, hoffnungslosester Vezweiflung, und dennoch muß es immer wieder unternommen werden.
Immer ziehen wir im Kampfe mit dem Engel den kürzeren. Der Engel fährt davon, wir behalten blaue Flecke. Aber erst die Wundflecke aus dem Kampfe, erst die ganze Haut ein einziges großes brennendes Wundmal des Kampfes; erst die ganze Notwendigkeit einer Erneuerung der Haut: Erst da ist die Segnung des Engels.
Erkennen wir: Nicht die einzelne, nur stets unerfüllte Wunschsekunde, sondern der ganze, vielzeitige Umfang und die Gestalt des langen Kampfes erst ist in Wahrheit unser Führertum!
Nicht eher werden wir unsere neue Erde bauen, als zwischen Gott und uns kein Ding mehr liegt, an dem wir uns zurückhalten können. Wir müssen ganz besitzlos sein. Jeden Besitz müssen wir erkannt haben als unsere Flucht vor dem Menschentum. Aber die letzte Barrikade gegen das Leben im Geiste, gegen die unbedingte Freiheit zu Gott, gegen unseren Weg zum Absoluten: ist die Seele.
Das Denken, der Wille, die Verwirklichung sind untrennbar voneinander. Aber schon das Denken, das nur mit unserem Leibe sich völlig decken muß, um uns zu geistigen Wesen zu machen, errichtet uns Hindernisse auf dem Wege zum Geist. Unsere Feigheit vor dem Verwirklichenmüssen rettet sich zu den niederen Anwendungsarten des Denkens. Die niederen Anwendungsarten des Denkens, da wo es aus seinem Leben als Aktivität des Geistes herabgleitet in ungeistige Surrogatprozesse, sind, auf der Seite der Abstraktion: der Formalismus; auf der Seite des Figürlichen: das Bild, die Vorstellung. Mit dem Formalismus und mit der Vorstellung lassen wir künstlich Naturgegebenes schaffen. Wir stellen das schon Vorhandene noch einmal dar; so erzielt unsere Angst vor der Verwirklichung, daß durch den Mangel an Verwirklichungsursprung die isolierende Schranke - Machtgefühl, Verteidigung des Besitzes - nur noch größer wird.
Aber diese Zwischenfälle können nicht unsere stetig sich erneuernde Besinnung auf das geistige Schöpfertum des Denkens, auf seine Menschenformung, aufhalten. Denn so erschöpflich und endlich die Natur ist, so unerschöpflich ist das Denken. Wäre auch die Natur - wie pantheistische Begeisterung besinnungslos behauptet - unerschöpflich, so würde sie der Verwirklichung des Denkens nicht ihre gewöhnlichen, heftig einmaligen Hindernisse bieten, sondern gradweis infinitesimale. Aber das geschieht nicht. Sondern zwischen dem vorangehenden üblichen Auftreten von Hindernissen und ihrem ebenso späteren Nachfolgen tritt jener heilig erhabene Fall auf, in dem die Verwirklichung des Denkens hindernislos ausgeübt wird.
Man nennt diesen Fall der hindernislosen Verwirklichung: den Glücksfall. (Die Tatsache des Glücksfalles erweist die Erschöpflichkeit der Natur. Hier sei gleich bemerkt, warum kein Pantheismus uns gestattet ist, selbst im - nicht zutreffenden! - Fall, die Natur wäre hochwertig schöpferisch. Jede Gleichsetzung Gottes mit der Natur und der Welt; jede Repräsentation Gottes durch einen kosmischen Prozeß; jeder solche Determinismus: ist ein Beiseiteschieben des Ethischen.) Aber der Glücksfall ist kein Zufall. Vielmehr, er ist das Wunder. Und jedesmal, wenn der Mensch das Denken ganz mit sich identifiziert, wenn das Geistige so um ihn Sphäre bildet, daß die Natur auf ihre Endlichkeit sich zusammenziehen muß, dann perlen um ihn - unglaubhaft für die bloß elemantar naturabhängigen Zuschauer, aber glaubhaft selbstverständlich für die Mithandelnden - die Wunder auf.
Die Welt könnte voller Wunder sein. Aber die Seele hält uns von ihnen zurück. Nicht das Geistige der Menschen, nicht sein wollendes Denken in Wirkung wartet auf das Wunder; das Denken tut das Wunder. Sonderlich die Seele wartet auf das Wunder. Die Seele wartet auf das Wunder, weil sie von ihm eine Bereicherung erhofft. Bereicherung des Besitzstandes. Die Seele ist vom Denken abgesondert, geflissentlich. Sie ist nicht da, um zu verwirklichen; sogar, sie will nicht verwirklichen. Sie will in sich sein. Die Seele ist ein Zufluchtsort, eine geheime Ecke. Ein Schatz. Ein Besitz. Eine Machtfülle. Ein Überlegenheitsmittel. Ein Gegebenes. Ein Erreichtes. Ein Ausruheplatz.
Es kommt aber darauf an, keine Zuflucht mehr zu haben. Es kommt darauf an, daß wir in die vollkommenste Vezweiflung gehen, wo wir nichts mehr zu retten haben. Kein Geheimnis mehr. Kein Fürsichsein. Kein Privatleben. Es kommt darauf an, zu verwirklichen. Es kommt darauf an, Besitz, Macht, Gegebenheit zu vernichten, um das Bewußtsein von der Existenz Gottes zu erreichen.
Die Seele ist unsere tötendste Ausschweifung. Immer wieder sucht sie uns das Maß der Welt anzulegen, wenn wir die göttliche Unermeßlichkeit des Geistes menschenhaft anrufen. Immer wieder, wenn wir schöpferisch für das Menschentum werden, sucht die Seele uns zu Einzelzellen zu machen, stolz auf das Vereinzelungstum ihrer Zelle.
Der Geist ist die Gnade Gottes. Er ist fremd allen unreinen Wesen.
Die Seele steht im Banne des Teufels.
Der Kampf mit dem Engel ist auch unser inniger Wille, das weltgebundene Sonderwesen der Seele aufzuheben, und die reine Lichtfortsetzung des Geistes zu werden.
Will man handgreiflich sehen, was die Vertretung des Teufels, die Vermenschlichung der Welt ist? Die Seele?
Die Seele kennt nicht Werte. Nicht Recht noch Unrecht. Nicht den Ursprung der Handlungen noch ihr Ziel. Sie kennt nur Wirkungen, und sie nimmt alle als gleichen Sinnes an. Sie wird darum stets zur Apotheose der Gewalt bestrahlt, denn die Gewalt beruft sich auf Macht, Geheimnis und inneren Besitz. Gewalt findet stets als ihren dunklen Anwalt die Seele.
Aber der Geist allein leitet, auch in der letzten Bedrängnis noch seiner Blutzeugen und öffentlichen Münder, die Verteidigung des Rechts.
Der Privatmensch gibt sich der Sache hin. Aber für uns gibt es kein Privatleben mehr. Wir, die Öffentlichen, die Geistigen, die Menschen: die Geistesmenschen - wir müssen in unserm Kampf mit dem Engel den Weg durch die Seele nehmen, wie wir den durch die Welt nehmen müssen. Offnen Augs, lichtumflammt vom Geist müssen wir durch das Dunkel. Auch dieser Weg wird uns nicht geschenkt.
Wir erinnern uns, daß wir die Welt geformt haben zu einem Glied des Geistes. Wir Wesen des Geistes.
Nun haben wir alles von uns abgetan, das uns noch band. Wir stehen nackt da, und selbst unser Leib, der mit Wunden aus dem Kampf bedeckt ist, ist uns nur noch wert als Mittel, unser Geistiges durch seinen Raum zu verwirklichen. So sind wir ganz herabgestiegen von unserm Adels-Sockel, wo wir als Vornehmer, als Seele, als Persönlichkeit, als Einzelner standen. Wir stiegen bis zur letzten Tiefe, die uns gerade noch vom Tod trennt. Wir haben nichts mehr von unserm Besitz aufgegeben und zu verlieren, wir sind besitzlos geworden. Wir haben nichts mehr zu bewahren: Nun können wir geben, so unerschöpflich wie der Geist durch uns strahlt. Zum erstenmal sehen wir.
Führer, du fährst auf aus dir, wie ein entflammtes Zündholz, klein.
Schwankend dünn im großen Taglicht-Umkreis.
Von dir atmet das Völkergeschöpf vorfühlend und rück die Glieder, in brauner Angsteshaut.
O steh gerade, halte die Augen entgegen, streck' die Hände!
Du siehst die Löcher aus den Augen schaun, die Arme tastend, Leiber hilfegedrängt, die Köpfe bleich und viel, als blicktest du lang in den schmerzenden Spiegel.
Sieh dein Gesicht großwächsern dir entgegen,
Das Blut läuft über die Augen vom erdig weißen Haar,
Hungerfalten um deinen zerknirschten Mund, der breit aufklappt zum Schrillen.
Sieh dein Gesicht weich und rund, rot, fleischig, zahnlos, sanft erschreckt bei der Geburt.
Sieh dein Gesicht erstaunt rasend, eh du Mann wirst.
Sieh dein Gesicht in der Abendstunde der schwesterlichen Nachdenklichkeit.
Sieh die Augen spiegelnd über Nasen, die gekrümmt sind in Jahrtausendgestalt,
Sieh die Augen blaß ausgelaugt von Verfolgungen,
Sieh den Mund, der faltig blieb von den Flammen der Scheiterhaufen, den Mund, der dünn ist von den Überfällen der Truppen, er schloß sich nicht seit den Handschellen der Gerichtsdiener.
Führer, sieh dein Ewigkeitsgesicht. Schmal. Brüderlich.
Der Führer steht klein, eine zuckende Blutsäule, auf der schmalen Tribüne. Sein Mund ist eine rundgebogene Armbrust, eine ungeheurer Ruck über ihm schnellt ihn schwingend ab. Gottes Stoß hat die Krummnase dieser schwächlichen Säule in die zitternden Massen geschwungen. Seine Glieder sind helle fliegende Wesen geworden, losgelöst von ihm, unter seinem Wink, die überall unter den Massen auftauchen und bei den Menschen eifern.
Seine Ringerarme kreisen weit hinein, überzeugend wie schlanke weiße Leiber, ins feindliche Menschenfeld. Seine Augen werfen im Horizontschwung leuchtende Flügel. Hohl beflügelt schweben seine Ohren rosig auf bleiernem Volksgeschrei, die hellen Flügel tragen den Thron seines Kopfes sanft hoch über Steinwürfe und graue Beleidigungen. Der leuchtende Ball seines Kopfes schwebt gewoben aus verflochtenen Engelswesen durch den blauen Raum, und schüttelt wie Wolkengefieder blitzende Himmelskuppeln auf die Menschenschultern herab. Die Engelswesen der Augen pfeilen zu den schwirrenden Bruderaugen weitum im riesigen Kreis.
Die Engel Gliedersäulen, Arme, Zunge und Lippen verschlingen sich wie Zweige im wehenden Baum. Der Führer spricht. Um ihn schweben auf und ab, ins Weite und zurück, ringend verschlungen seine Engel auf kristallenen Bergen. Pfingstflammen fließen schmalbrennend auf den riesigen Erdwald der Menschenhäupter herab.
Führer, sprich!
Homer und Monte Christo
Wir wissen alle vom Wunder. Wir sind seit unserer frühesten Zeit vorbereitet. Jungen liegen nachts wach; durch die Türen hört man die Gesellschaft bei den Eltern. Man kann im Halbdunkel neben dem Bett gerade noch das Kreisen der Zeichnung auf der Tapete sehen. Die Blätter winden sich auf dem Grünlichen auseinander, als wenn man auf einer Leiter hochkletterte. Nach einigen Märschen der Augen tritt aus der Wand auf der nächsten Blume ein kleines blaues Feuer, rund wie eine Erbse, ein strahlender Kern. Darum her dampft es feurig hoch, die Flammen schlagen auf und nieder, über die ganze Wand hin um die Kinder. Sie sind ganz ruhig und neugierig, was geschehen wird. In dem Feuerkreis steht ein kleiner Mann mit dem langen weißen Bart auf, die Flammen gehen weg und laufen nur noch flach über die Wand hin. Die Jungen richten sich im Bett auf, der alte Mann beugt den Kopf und teilt einiges mit. Was er mitteilt, weiß der Junge schon; es ist aber angenehm und kräftigend, das alles bestätigt zu bekommen. Die Mutter kommt ins Zimmer, und ist erschreckt, daß der Junge im Bett aufrecht sitzt und die Linien in seinen Händen ansieht. Die Linien hören erst langsam auf, sich zu verschlingen. Die Mutter ist beunruhigt und sorgt, daß er schlafe. Der alte Mann aus dem blauen Feuerlicht ist manchmal in späteren Nächten wieder da.
Man muß zunächst diese Schöpfung der Kindheit, die fast jeder Mensch sich macht, hinnehmen ohne Ablenkung durch eine Erklärung oder das Sonderliche einer nur physiologischen Deutung.
Viele Jahre später, mitten unter den Leuten der belebtesten Großstadtstraße, wird der Mensch sich plötzlich eine Lichtsekunde lang an seine Zusammenkunft mit dem Feuersmann erinnern. Oder, er geht einmal, des Spätnachmittags eines Sommers, vorbei an der rohen Ziegelmauer eines Amtsgartens; vor ihm, vielleicht mit müden Schultern, ein Berufsmensch, den er vom Rücken erkennt. Da ist die Kindertapete in Flammen. Er weiß sofort, was dieser Rechtsanwalt menschlich auszusprechen hätte. Er überschaut dieses Mannes Mitleben auf de Erde.
Jeder Mensch kennt die Augenblicke, wo hinein in Gewühl und gewöhnliche Dinge ein Aufscheinen fällt. Wir werden durchschüttelt; es ist ein Moment, der uns plötzlich auf eine Spitze stellt, wir übersehen alle unsere bisherigen Handlungen und die der anderen Menschen. Das Wunder. Jeder Mensch kennt das Wunder. Keiner wagt an das Wunder zu glauben, aber jeder weiß davon, am Ende ahnungslos, daß er weiß.
Von einem Buch, das nicht durch Ergebnisse der exakten Forschungen dem unmittelbaren Nutzen des Denkens zu dienen hat, erwarten wir immer das Wunder. Eine höhere Existenz. Unsere höhere Existenz, aufgezeichnet über den Knotenpunkt unseres Lebens, die durch weite Zwischenräume voneinander getrennt sind, zusammengehalten werden, gegeneinandergehalten werden. Wir erwarten, daß ihre Zusammenpressung ihnen ihre bestimmte Bedeutung gibt; Bedeutung, die sie untereinander enthüllen: jeder Lebensmoment drängt handelnd auf den andern ein.
Wir wissen: wir sind früher einmal erregt in den dunklen, eckigen Kellergängen unseres Hauses herumgestrichen; wir sind die Treppen prasselnd herauf ans Licht gerannt, wie ein Schiff, das breit auf die Helle des Meeres geht: ein Schiff und ein Meer, die wir erst viel später zu sehen bekommen werden. Wir sind viele Treppenwindungen atemlos einen Turm hinaufgestiegen, oben war es kleiner als sonst, auf dieser Spitze wurde alles klein, das Licht kam von weiter her. Die Erde wurde groß. Wir lagen am Meer, die Zeit war langsamer geworden; könnte man mitten auf dem Meere sein, wo nichts mehr zu sehen war, dann war man sicher ein Stück von den Dingen, die nach unsichtbaren Einwirkungen, merkwürdig in der Form, manchmal an den Strand geworfen wurden. - Oder die staubigen winkeligen Bodenräume, in die graues, scharfes Licht aus seltenen Luken fällt - von da auf die Dächer: über die ganze Stadt hinsteigen.
In jedem Moment läuft immer die Sicherheit, daß dieses alles einmal sehr ernst mit unserm Leben verbunden sein kann. Es ist nicht nur, daß wir geboren wurden und aus der Höhle des Leibes in die Helle drangen; und daß das Geschlechtliche wieder in dunkle Höhlen dringt, oft schon künstlich den immensen dunklen Höhenleib der Nacht schaffend. Aber wir wissen, daß man in Kellern verlorengeht, daß man von Türmen abstürzt, auf dem Meer versinkt, auf Böden von Feuer erstickt wird. Das können Gefängnisse, Schlachten, Fluchten, Belagerungen sein. Geldabhängigkeit bricht über uns herein, Vermögen zerfließen und werden gewonnen. Frauen weigern sich uns und werfen sich uns besinnungslos an den Hals.
Menschen um uns werden erschossen, zerschlagen, oder sie zertrampeln die andern. Sicher ist, dieses Hinabsteigen, Hinaufklimmen, Hinaufschwimmen, das uns immer unerklärlich gebannt hat, wird auf einmal zu Ungeheurem in unserm Leben, zu Tod oder Rettung, in dem Moment, da sich unsere Welt ändert. Der Raum auf dieser Erde, in dem wir uns zu bewegen haben, der Raum, in dem unsere Mitmenschen sich bewegen, die Drehung und Bewegung der Räume umeinander, die Kämpfe aus unseren Anstrengungen, Räume zu verschieben; die immer vergebene Hoffnung, Räume zu durchdringen, unser Zusammengeschmiedetwerden, unsere Rückstöße: Körperlich wahrnehmbar wird uns dies alles nur durch unsere Beziehungen zum Licht. Das Licht und der Tag; das Fehlen des Lichts; das Feuer. Unser Denken ans Licht, unsere Vorstellungen vom Licht, unsere Einbildungen. Alle Akte unseres Willens sind auf der Raumwelt dieser Erde unlöslich verbunden mit dem Licht. Wie etwas aus dem Dunkel kommt und ins Dunkle zurückgeht, das Formwerden im Licht - hier sind die unmittelbarsten Zeichen zum Aufschluß von unserm Willen über andere und anderer Willen über uns.
Diese Zeichen suchen wir, ohne darauf zu achten, überall. Wir erwarten sie als Substanz jeden Buches, das Wesentliches von Menschen sagt.
Die Höhepunkte unseres Lebens, alle Momente, die uns außer uns oder in uns versetzen, die großen Aufstiege und Zusammenbrüche, treten nur als Vorgänge unter Menschen auf. (Wir können sie uns nie anders als durch Raumveränderungen vorstellen; und das heißt: daß auch jenes Außer-uns-Geraten nicht ein Losgelöstes von uns wird, sondern daß wir von der Dauer des Ichs wissen, daß wir das Ich stets irgendwie als Raum wiedererkennen.) Vorgänge unter Menschen, Beziehungen zwischen Menschen: Willensäußerungen.
Es ist noch etwas anderes möglich, die Vorstellung von der vollkommenen Auflösung unseres Ichs. Wir können uns als Raum verneinen, wir können uns passiv machen, uns "entwollen". Dann müßte die höchste Stufe dieses Vorganges, das Eintreten in außer uns liegende Bewußtseinszustände sein; wir müßten uns in die Situation von ganz außermenschlichen Dingen einfühlen können - und dies oft gebrauchte Wort "einfühlen" zeigt sich hier, von menschlicher Art genommen, als ganz undeutlich. In Tiere, Bäume; in Unorganisches, Steine. - Aber das ist nicht die pantheistische Vorstellung von der berühmten Belebung der ganzen Natur (aller geistigen Feiglinge), sondern etwas viel Präziseres. Es gälte dabei, die Zustandsform des Dinges zu erfassen: wie - nicht ein Baum - sondern der bestimmte, gewachsene Baum in der Welt für sich besteht. Oder das Steinsein eines Steines. Hindernisse gäbe es nicht; das müßte so weit gehen, ein bestimmter Stuhl, ein bestimmtes Glas in ihnen selbst sein zu können. (Als Kunst im ganzen Schrifttum aller Zeiten nur einmal durchaus grundsätzlich versucht, von Rilke, mit dem Gedicht "Die Säule".)
Diese ganze ungeheure Welt der passiven Strömung, des aufenthaltlosen, hindernislosen, willenlos gemachten Ichs, des bewußt unfrei gemachten Ichs ist das Gebiet des Lyrischen. Das Lyrische ist ja nicht auf die Versform des Gedichts beschränkt; es kann in einer Abhandlung, in einem Roman, in einem Bühnenwerk dasein (ein Schwächezeichen, das auch längst Tagesbrauch wurde). Aber sein Sinn ist immer: ein Ich, abhängig gemacht von außermenschlichen Dingen; von Dingen, die der Wille nicht mehr regiert. Von Dingen. (Und das Lyrische des Liebesdichters liegt auch nie in den Willenslinien des Liebenden und der Geliebten, sondern in der Darstellung von Veränderungen, die in der "Natur" um sie vorzugehen scheinen, von der Erde bis zu Kleiderfalten, Haarduft, Glanz der Haut.)
Drüben die andere Welt der menschlichen Darstellung, das Gebiet der Willentlichmachung, der Eingrenzung, der Ein-Räumung des Ichs - da wo es sich um das Gegeneinander und Nebeneinander und Miteinander der Menschen handelt -, diese Welt des Erdenlebens müßte man, im letzten Gegensatz zur lyrischen, die politische nennen. So hat das Politische seinen grundsätzlichsten Sinn: Plan des Verhaltens der Menschen zueinander. Hier geht es um Menschen.
Aber das Politische in der Kunst kann sich nur in Taten äußern. Das Werk, dessen Substanz es ist, muß ein Werk der Handlungen sein.
Der Routinier verwechselt Handlung mit Vorgang. Ebenso wie der Geschäftige Arbeit mit Tätigkeit verwechselt. Aber Handeln ist etwas Unzweideutiges, eine Veränderung, die durch den Willen erwirkt wird. Die wirkliche Dichtung hat immer nur mit dem menschlichen Willen zu tun, dessen äußeren Anschein sie gibt. (Sie kann auch vollkommen da sein, indem sie bewußt den Willen scheinbar fehlen läßt, das heißt in Wahrheit ihn verschoben auf Gebiete des Außer-Ich zeigt. Hauptmanns "Emanuel Quint".)
Langeweile ist ein sehr bemerkenswertes Phänomen: wenn ein Buch uns seitenlang in sorgfältigem Fleiß Gewitter, Meereswogen, Waldrauschen, modernes und älteres Alpenglühen zeigt, dann merken wir ganz genau, daß wir es mit Schriftstellertätigkeit zu tun haben, mit Beschreibertätigkeit. Dichtung hat nichts mit Beschreibung zu schaffen. Wie wahr das ist: Die Kosmogonien des Altertums können die Natur nur in Personifikationen darstellen. Die Naturschilderer der neuen Zeit anthropomorphisieren die Natur; bei ihnen "handelt" die Natur, die Natur "bedrängt" den Menschen, "wehrt sich" gegen den Menschen, der Wald "wacht auf", der Turm "springt in die Höhe" - grobschlächtige Vorstellungen, die aber auf demselben Plan stehen mit Intimitäten des Solipsismus: ein Romanheld sieht in einem Florentiner Flügel das Knie seiner Geliebten. -
Dies sind Auswege, Verschwommenheiten, bei denen nur das Temperament des Autors - als des in so einem Fall einzigen wirklichen Handelnden - den psychophysischen Dilettantismus ein wenig kaschieren kann. Man nennt diese Vorstellungsart mit Recht auch nicht dichterisch; es gibt eine sehr gute Bezeichnung für sie, die das Surrogative ausdrückt: "poetisch".
Der Dichter hat es nur mit dem Handeln des Menschen zu tun. Die Natur ist die große, vorhandene Passivität der Welt, das Material, in dem die Subjekte des Dichters arbeiten, das sie kneten, schneiden, verschieben, umwandeln: verändern. Ändern. Der menschliche Wille geht auf Änderung der Welt. Jeder menschliche Wille. So müssen die Willenslinien immer zusammentreffen. Ihr Objekt, die Manifestation der Welt, die geändert werden soll, ist ein Stück Raum, dessen Lage man wechseln will. Und die Politik des Staatslebens ist nur ein Sonderfall aus dem ungeheuren Gebiet der Willensäußerungen in der Welt: des Politischen.
Die Bühnendichtung zeigt den Weg der Willensduelle an einem Ding, das seinen Besitzer wechselt. Der Besitzwechsel ist immer ein Ausdruck für die Übermacht des einen, aber der Gegenstand hat auch eine Beziehung zu dem Menschen, unter denen er seine Lage ändert. Ein ganz klarer Fall, in dem ein Requisit zum Symbol wird, ist Goldonis "Fächer". Indes der Bühnenroutinier und der Dilettant beläßt alle Dingobjekte, die den Knotenpunkt der menschlichen Willen veranschaulichen sollen - Kronen, Schmuck, Dolch, Geld - bei ihrer rohen Materialwirkung als Requisit. Am deutlichsten in den häufigen Dilettantenschlüssen mit Gift; das Gift, ein bloßes Objekt des menschlichen Willens, ist da nicht das "politische", also veranschaulichende Ding, sondern etwas angeblich real Wirkendes; diese Zumutung ist immer so lächerlich. Dagegen der Dichter läßt selbst das am stärksten materialmäßig Wirkende, das Geld, zur Veranschaulichung des Willenskampfes "politisch" werden; Molières "Geizhals".
Das wirkliche Können des Dichters formt an der Sublimierung der Dingsymbole. Shakespeare gibt das Ringen zweier Wesen an Macbeths Monolog von einem Dolch, der nicht einmal existiert. Sophokles, wohl in der Bühnenwirkung am stärksten, verleiht dem Objektsymbol des Kampfes die allerkühnste und beziehungsvollste Einfachheit: In der "Antigone" ein Leichnam!
Aber das Raumsymbol der erzählenden Dichtung und des Romans ist anderer Art. Es ist unmittelbar. Es ist jene Ausmessung der Umgebung, die das handelnde Subjekt durch sein Wirken selbst wählt und begrenzt. Im Drama gehört ja die unmittelbare räumliche Umgebung des Handelnden nicht wahrhaft zum eigentlichen Wesen der Handlung, der Wald, die Straße, das Zimmer der Bühne. Im Roman ist aber der eigentliche Bewegungsraum des Handelnden unendlich sinnvoll. Die dunkle Grotte, in der Odysseus die Schatten der Unterwelt beschwört; in die er hinabsteigt, aus der er glückselig wieder ans Tageslicht heraufkommt (es würde gewiß eine unabsehbare Gefühlslücke dasein, wenn ihm hier nicht seine Mutter erschiene; keineswegs aus sentimentalen oder sogenannten psychoanalytischen Gründen). Oder der unermeßlich reiche und lichte Phäakenpalast. Die felsige Insel Robinsons, die Bergspitze, auf der er Signalfeuer anzündet und seine Höhle. Lederstrumpfs Urwald und der breite Mississippi. Bis zum Roman der populärsten Wirkung: das unterirdische Gefängnis des Grafen von Monte Christo und seine strahlende Schatzkammer.
Dies alles sind nicht Milieuangelegenheiten oder etwa soziologischer Natur; noch weniger dekorative Dinge, Kulissen. Sondern es sind die plastischen Darstellungen des Umfangs, in dem der Wille des Handelnden sich erproben muß. Der Sinn und die Kraft des epischen Raumsymbols gehen bis zu Dostojewski, der doch den epischen Gang der Erzählung scheinbar kompliziert, indem er ihn aus Gesprächen und Betrachtungen entstehen läßt. In den "Brüdern Karamasow" das Kloster des Mönchs Sossima, das erst voller Heiligkeit und Wundertum ist und später ein Ort des teuflischsten Leichengestankes, dies ist eine Versinnlichung von mächtigster Einfachheit für den Umfang - und die vielfache Art - der Willenskatastrophen bei den Karamasows. Es ist typisch, daß die schöpfungslose Literatur der Unfähigen, Verirrten und Unsicheren (die das Energiewesen Dostojewskis nicht verstanden und das technische Gewebe von außen nachzuahmen suchten), beispielsweise die sogenannte psychologische Literatur, nie ein aktives Raumsymbol hervorgebracht hat; ihre Szenen spielen sich allzuoft in Restaurants und Cafés ab, die stets als "gleichgültig" für den Handelnden bezeichnet werden. Dies bedeutet, daß die Orte solcher Schilderungen nicht auf der Ausdehnung von Willensverknotungen liegen. Sie sind nicht Raum geworden: sie sind nicht geschaffen.
Die Konzentrierung der Handlung, die die Schreibart jeder wirklichen erzählenden Dichtung auszeichnet, ist erst eine Folge der Erschaffung eines Raumes für die Handlung. Innerhalb des gedichteten Raumes ist jeder Vorgang körperlich und erfüllt sein eigenes Raumvolumen. Aber jede dieser Körperlichkeiten ist ein Sammelplatz von Energien, die immerfort einen Austausch anstreben: Wahrnehmung des Lesers von der "Fülle der Handlung". Bei den höchsten Werken der, im Sinne der Aktivität, politischen Dichtung, jenen, die gar nichts mehr von Deskription haben, sondern alle Körperlichkeit zur Darstellung von Willensintensität machen: Wahrnehmung des Lesers von der "Dichtigkeit des Ausdrucks".
Die Odyssee ist ein Abenteuerroman, der Monte Christo des alten Dumas ist es auch. Zwischen diesen ungeheuren Abständen von Dichtung und Unterhaltung stehen Werke Daniel Defoes; Dostojewskis Raskolnikow und die Karamasows; Caleb Williams, der anarchistische Rokoko-Proletarier-Roman des Engländers William Godwin; von Cervantes der Don Quixote, Coopers Lederstrumpf. Ganz ungleichartige Bücher. Gemeinsam haben diese Werke Aktivität der Vorgänge, die Handlung. Oder, vom Grundeindruck des Lesers aus gesprochen: die Spannung.
Von allen Wirkungen des Romans scheint die Spannung die wertloseste zu sein. Der Routinier, der über nichts mehr verfügt, kann immer noch Spannung machen. Die Spannung hält die alten Räuber-, Ritter-und Geisterbücher, die modernen Dienstmädchenromane, die populären Kriminalgeschichten zusammen. Die Spannung scheint am wenigsten vom Leser zu fordern und am wenigsten vom Autor. Aber in Werken von so reiner Kraft, wie denen Defoes und Dostojewskis herrscht ungeheuerste Spannung. Und wenn man die Odyssee in einem einheitlichen Sinn vollkommen überschaut, als der Erklärung nicht bedürftiges Erzählungswerk - wie es erst heute wieder die Tatsache von Rudolf Alexander Schröders Übersetzung fordern darf - so steht man überall von einer Zusammenfassung von Ereignissen, die als höchste Spannung wirkt.
In allen diesen Fällen ist Spannung nicht etwas Verschiedenes, sondern überall derselbe Vorgang im Leser: stärkste Erwartung einer Folge, deren Kommen man zugleich sicher voraussieht. In allen Romanen der Aktivität, den reinen Dichtungen und den bunten Groschenheftchen, ist die Spannung gleicher Art. Denn Spannung ist überall dasselbe Gebilde; ein Gebilde, das aus der Einheitlichkeit eines Ausdrucksmittels und eines Sachinhaltes besteht. Der Inhalt der Spannung ist stets eine Elementarerschütterung des menschlichen Willens; ihr Ausdrucksmittel ist die Zusammenfassung in unmittelbar ausgesprochenen Resultaten. In unmittelbaren Feststellungen wird ausgedrückt, wie Odysseus, nach dem Schiffbruch an den Mast geklammert, sich rettet, wie Robinson auf seiner Insel menschliche Fußspuren findet, wie der Mörder Raskolnikow vor dem Untersuchungsrichter steht. Diese Feststellungen können sehr gedehnt sein; sie sind es nur, um den Raum für ein Subjekt zu schaffen: um eine Gestalt vollkommen zu einer Figur nur aus ihren eigenen Willensdimensionen zu machen.
Sie sind nie deskriptiv, das bedeutet, sie geben nie einer Gestalt die Möglichkeit, ihre Umrisse aufzulösen und in der Welt zu verströmen. Das Ausdrucksmittel durch das Resultat wirkt auf die Gestalt kondensierend, zu deutsch: dichtend. Das Ausdrucksmittel stellt das Maß des in der Gestalt angesammelten Willens dar. Es stellt das dar am Inhalt der Elementarerschütterung des Willens. Das menschliche Elementarereignis für die Grunderschütterung des Willens gibt dem Willen erst die Möglichkeit zu wirken. Odysseus, der als Bettler verkleidet sein muß, um gegen die Übermacht der Feinde sich in sein Haus zu schleichen; der Graf von Monte Christo, der sich statt eines toten Gefangenen vom Turm ins Meer werfen läßt, um zu entfliehen: hier sind Katastrophen an der äußersten Grenze des menschlichen Willens.
Solche Katastrophen können gar nicht anders als durch Feststellungen von Tatsachen, also der Form des Willentlichen, ausgedrückt sein. Wären sie es anders, wären sie in die Erklärung und Auseinandersetzung der Deskription - also des Abhängigmachens von der Umwelt - eingebettet, so hätte man nicht Höhepunkte, sondern Endpunkte. Abschlüsse. Das widerspricht dem ganzen Energiematerial solcher Vorgänge. Es ist eine Energiesammlung, die nicht in sich selbst zur Ruhe kommen kann; sie ist auch nur möglich durch andere Energieaufspeicherungen außer ihr. Intensität fordert Aktivität. Im Wesen der Spannung taucht so von einer ganz anderen Seite der Begriff des Politischen wieder auf.
Die Grunderschütterungen des Willens spielen stets um unseren Tod herum; sie stehen unserem Denken sehr nahe. Es steht auch dem Autor sehr nahe, sich ihrer zu bedienen. Daher ist die Spannung wirklich die niedrigste Wirkung des Erzählers; nämlich die allgemeinste. Aber die Tatsache der Spannung selbst sagt nichts über den Wert des Werkes, in dem sie wirkt. Fast umgekehrt: die an sich wertlose, das heißt außerhalb eines Maßes stehende Spannung ist selbst erst das Maß, der Waagebalken für unsere Entscheidung über den Wert des Werks. Denn wir nehmen unfehlbar wahr, ob die Spannung nur eine Folge von Vorgängen ist, ein lineares Gebilde, das bloß durch flächig für sich selbst bestehende Ereignissummen hindurchgleitet. Oder ob sie die Rhythmusarchitektur ist, die zusammenschießt aus den Energiestrahlen der Bewegungskämpfe von geschaffenen Räumen des Willens. Die Erscheinung einer Schöpfung.
Die Literatur, die von Zeitgedanken abhängt, die Literatur geht immer wieder im zeitlichen Wechsel zweier entgegengesetzter Bahnen. Entweder der sogenannten Phantasie oder der sogenannten Tiefe. Die Literaturphantasie ist eine Darstellungsart, die in der Fläche bleibt; sie vervielfacht ihre Vorgänge; sie erfindet nicht, sondern erdenkt. Sie zeigt nicht Folgen, sondern Konsequenzen. Sie zeigt Willenshandlungen ohne Ausmaß des Willens. Sie gibt Gestalten ohne ihren Raum. Der Gegensatz, die Literaturtiefe, gibt einen Raum ohne seine Gestalten. Das eine ist eine zeitliche Überschätzung des Denkens, das andere eine Überschätzung der Anschauung.
Die Literaturphantasie ist logisch, die Literaturtiefe psychologisch. Beide, unschöpferisch, hängen in ihrer Gültigkeit unablässig vom Zeitmoment ihrer Entstehung ab. Hauptvertreter: der alte Dumas, die Phantasie. Flaubert, die Tiefe. Wir stehen gegenwärtig noch in der Mode der Anschaulichkeit; also hohe Schätzung von Flaubert.
Aber die großen Schöpfungen, es sind wenige, die über Jahrhunderte zusammengehören, sind ganz anderer Natur. Sie gehören nicht zur Literatur. Das ist eine bestimmte Qualität (doch auch nicht einer jener oft verbittert hingeredet mürrischen Vorwürfe gegen die Literatur). Die Literatur ist immer von dem Material der Logik oder der Psychologie. Das sind die Werke der Schöpfung nicht. Es ist wiederum gerecht, daß die Literatur Verdacht gegen die "Schöpfungen" hat, sie innerlich nicht zu sich rechnet, und wenn sie sie schon verbreiten muß, dann gern "bearbeitet", das heißt, sie möglichst nach der gerade herrschenden Denkform maskiert. Die Literatur ist für sich selbst da. Die Schöpfung nicht.
Vergessen wir nie: Nur den rohen Wortklang gemeinsam mit der Literatur hat der Literat. Kein höheres Wesen in der menschlichen Gemeinschaft als der Literat! Der Literat ist für uns alle da; tausendmal opfert er sich in die aufreizende und vergängliche Stunde. Er wagt es, für uns das Wort zu sprechen, auf das Glück und die tolle Gefahr hin, daß es das Wort des Tages ist. Er stürmt für uns vor; er ist der Führer; und um den Preis, daß wir ein Ohr, ein Herzzucken, eine schwingende Masse sind, nimmt er selbst das ewige Vergessen von morgen auf sich. Zuerst unter allen Dingen der Welt ist der Dichter Literat. Zuerst ist der Schöpfer Literat.
Der Literat spricht unser Denken unmittelbar aus, als ein Feuertransparent vor unserm Leben. Dagegen die "Literatur" ist nur die ateliergeheimnistuerische Polemik über unser Denken.
Die Schöpfung ist ein Krater für die Aufrüttelung durch den Geist. Diese mächtigen politischen Romane dienen der Darstellung einer geistigen Idee. Schärfer begrenzt: der Idee des Geistigen. Die Odyssee, Robinson Crusoe, Gulliver, Tausend und eine Nacht, Karamasow sind da, um die Erschütterung des menschlichen Willens durch ein Geschehen über den Körpern, das unabhängig von allem Material der Welt ist, körperlich werden zu lassen. Diese Dichtungen finden ihren Ausdruck nie in Auseinandersetzungen und Erklärungen, sondern in Feststellungen und Resultaten. Darum, weil sie von einem Absoluten wissen. Was diese Werke über Jahrhunderte aneinander bindet, ist ihre selbstverständliche Voraussetzung: ein freier Wille des Menschen, der durch alle seine Handlungen vor einem unendlich übergeordneten, aktiven Sinn außerhalb der Vorstellungsmöglichkeit Rechenschaft ablegt.
Die Dokumentation des absoluten Geistigen erzwingt eine unmittelbare Aneinanderdrängung der Handlungen; jeder Ruhepunkt durch die Beschreibung (Bequemlichkeit der Deskription) wäre auch nur vor der Tatsache Gottes eine furchtbare Leere, es wäre eine Tatenlosigkeit auf der Welt, Verleugnung, ja Verstellung. Auf der Welt lebt man, um in jeder Minute seine Herkunft vom Geist in Taten darzustellen; und das Material der Welt ist dazu da, um unsern Willen zu zwingen, im Durchbrechen des Raumwiderstandes, unter Flammenkatastrophen, jeden Augenblick des Lebens immer wieder von neuem als den ersten Tag unserer Geburt vom Geist aufscheinen zu lassen.
Der Aktionsroman gibt das Leben der Menschen in den Katastrophen der Gewißheit vom Geist. Seine Kunst ist nie ein für sich laufender Kreis, nie etwa die Nutzung des persönlichen Privilegs einer Offenbarung. Nie ein Luxus. Nie wertvoll. Sondern selbst wertend. Sie ist dazu da, um die menschlichen Handlungen auf ihre Ausfüllung der Willensmöglichkeit zu werten. (Und daher kommt das starke Mutgefühl, das den Leser des Aktionsroman immer umgibt.) Die Dokumentation des Geistigen erzwingt die Lückenlosigkeit der Erscheinungen des Willens. Die Konzentration der Handlung. Und erst die unerfüllten (Kultur-)Nachahmer meinen gewöhnlich, Kunst bestehe abseits von der Mitteilung des Menschlichen, und Konzentration sei ein Vorgang aus sich selbst.
Dieser politische Roman der Dichter stellt, als wertendes, undeterministisches Werk, immer ungeheuerliche Forderungen auf. Daß diese Forderungen nicht leer phantastisch erscheinen, ist wieder erst durch die Intensität der Willenstätigkeit möglich, innerhalb deren diese Forderungen als Willensangelegenheiten verflochten sind. Dostojewski fordert Ungeheures vom menschlichen Herzen, der Robinson vom moralischen Bewußtsein, Gulliver vom gesellschaftlichen, Godwins Caleb vom rechtlichen; die Odyssee von der menschlichen Treue. Cervantes fordert Utopisches von der Verwirklichungsmacht der menschlichen Vorstellungskraft, und er ist auch tatsächlich der erste Romantiker, insofern er innerhalb seines eigenen Werkes Skeptiker an seinen eigenen Forderungen ist. Literatur taucht hier auf.
Die Literatur vertritt immer ihre Gesellschaft. Die Schöpfung vertritt nichts. Ein Ventil vertritt seine Dampfmaschine. Die Schöpfung ist ein Ventil dieser Welt für die Aktivität des Geistes. Das Geistige geht unmittelbar durch sie hindurch, und darum ist sie unmittelbar aktiv. Die Literatur beschreibt die Katastrophe; die Schöpfung ist ein Teil der Katastrophe selbst. Die Literatur schildert bestenfalls die Aufrüttelung, die Schöpfung macht die Aufrüttelung mit.
Die Schöpfung ist unabhängig von ihrer Gesellschaft und von jeder Gesellschaft. Sie hat mit Kultur nichts zu schaffen (die Literatur alles). Denn die Gesellschaft ist ihr nur ein bestimmtes Trägheitssymptom des menschlichen Willens, wie ihr auch jedes andere Material sich als Trägheitssymptom darstellt. Die Schöpfung ist dazu da, im Brennen des Geistes die Trägheit zu vernichten. Die Intensität der Schöpfung ist wirklich der Gesellschaft feindlich; aber das ist so zu verstehen, daß sie eine unendlich viel größere Rolle für die Gesellschaft spielt, als die Gesellschaft für sie. Gesellschaftsdichtung oder soziologische Dichtung gibt es ebensowenig wie logische oder psychologische. Nicht etwa nur, weil dies ein Übergang in die Wissenschaften wäre; diese Antwort zeigt allein das äußere Bild des wahren Grundes. Sondern weil der Geist eine andere Welt ist als das Material. Das Licht von der Sonne kann zwar durch ein Prisma gebrochen werden, aber nur das Licht ändert die Umgebung des Prismas, und das Prisma wirkt nicht auf die lichthervorbringende Sonne zurück.
Die Schöpfung des politischen Romans flammt durch das Material der Gesellschaft hindurch, und bleibt Geistiges; die Gesellschaft und die Umwelt ändert sich, wird von einer Aufwühlung in die andere getrieben. Der Sinn aller Katastrophen im Aktionsroman ist: Den Menschen immer wieder, durch Zerstörung aller Trägheitslieblichkeit der Umwelt, unmittelbar in die fürchterliche Helligkeit des Geistes zu stellen; von der er stammt. Den menschlichen Willen immer von neuem als auf dieser Welt sichtbar fortsetzenden Strahl des Geistigen zu weisen.
Die Substanz des aktiven Romans, der wahre Stoff und Vorwurf seiner Dichtung: sind jene Urelemente des Fühlens zwischen dem Feuer und der Nacht, der Helle und dem Tod, die wir seit unserer Kindheit kennen, und die uns stets an unsere geistige Herkunft erinnern. An denen der menschliche Wille sich zu verkörpern hat. Alles, was unsere räumliche Existenz ändert. Man weiß erst, wie sicher die Aktivität des Geistigen, unabhängig von den Gelegenheitsänderungen des Materialen ist, wenn man feststellt, daß schon die rohe, nur erwähnende Aufzeichnung der Elementarsituationen des menschlichen Lebens auf uns wirkt, bis hinein selbst in die dichtungslose, weitmaschigste Verbreitungsliteratur.
Die Spannung ist eine der Erscheinungsformen des Geistigen, so wie die Farbe eine Erscheinungsform des Lichts ist, und die Farbe wirkt auf uns bestimmend auch noch aus einem billigen Öldruckbild.
Diese immerwährende katastrophenrührende Aktivität des Geistigen: das Politische macht die Dichtung des Aktionsromans zu einem revolutionären Werk. Die Forderungen, die er stellt; seine Arbeit, die herrschend unberührte Änderung. Umschiebung, Knetung - Umstürzung - des Materialen, der Gesellschaft, machen ihn zur Stimme des Aufstandes. Er lehrt nicht, er wirkt durch unmittelbare Wirkung. Er hat keine "Tendenz", er hat nur die eine Richtung aufs Geistige. Er analysiert nicht, er stellt fest. Er kritisiert nicht, er zerstört direkt. Er zerstört immer wieder mit seinen Katastrophen die angeebbten Gewohnheiten, die den Menschen zu einem Wesen seiner Umgebung verschwemmen. Er zerstört: Um den menschlichen Willen für den Geist frei zu machen.
LITERARISCHE NEUERSCHEINUNGEN
Paul Adler. Elohim. (Hellerauer Verlag 1914.)Das Buch fand ich am Vorgestell eines Buchladens, blätterte darin - der Stoß der Wahrheit brach aus den Seiten so mächtig auf mich her, daß ich mir zurief: Schnell das Buch kaufen! Vielleicht ist hier das letzte Exemplar, die anderen sind verloren gegangen. Dieses Buch retten für die Menschheit! Daß das Buch existiert, darüber bin ich glücklich. Es ist ein Wunder.
Das Buch "Elohim" besteht aus Mitteilungen über den Verlauf des Menschenlebens, und aus Mitteilungen dessen, was dem Einzelnen zu tun nötig ist. Es enthüllt in einer selbstverständlichen Klarheit, die wunderartig und die man nur magisch nennen kann, den Zusammenhang des menschlichen Einzelwillens, seiner Trübung und Ablenkung, mit dem Schicksal von Völkern. Es zeigt, daß die Menschen, Wesen göttlichet Abkunft, hin über den ganzen Planeten Erde in moralischer Vereinigung von höchster realer Aktivität stehen.
Und die einzige Lebensaufgabe des Menschen: ein Geschöpf auf der ungeheuren überirdischen Wage des Geistes zu werden, deren Wagschalen, auf und nieder, die fernsten, einander fremdesten Punkte der Erde berühren. Dies sind Mitteilungen.
Und man pflegt den Verfasser annähernd ähnlicher Mitteilungen einen Dichter zu nennen, wenn seinen Geschöpfen eine Umwelt aufgebaut ist. Aber die Mitteilungen des Buches "Elohim" sind weit entfernt von der Zufriedenheit der Dichter, Kunst zu machen. Die reale Welt in diesem Buch ist nicht der Gestaltung wegen da, sondern alles, was greifbar, sichtbar und männlich wirkt, ist ein Ding, das Gott dem Menschen hinwirft, um ihn zu erinnern.
In der Tat hat das Buch einen Verfasser, aber er ist kein Wesen für sich, sondern der Sprecher von Tatsachen des Geistes. Und wenn man zu erkennen glaubt, daß Paul Adler ein Mann ist, hinter dem mächtiges Wissen, Erkenntnisse und Willensballungen liegen, so sagen die Seiten des Buches, daß sie der inneren Geschichte unserer Erde entstammen und daß sie dem Verfasser diktiert sind.
Ich nehme nur die Tatsachen; ich vergleiche nicht, ich nenne nur die geistige Haltung dieses Werkes, das ein Werk von Feststellungen und der Anleitung zum Leben ist: Seit der Zeit der "Göttlichen Komödie" zerstoben Jahrhunderte aus Spiel, Blutkitzel und Versäumnis und die Welt wußte nichts mehr von Heiligkeit.
Dieses Werk lehrt uns wieder die Unbedingheit, und damit sagt es, daß die Welt noch nicht gestorben und die Zeit wieder neu wird. Und daß die Menschen, welche diese Jahre überleben, die Hände ihren Brüdern aus den neuen Zeiten, den einzigen, über Jahrtausende hin reichen.
Brüder sind verwandt, nicht gleich. Orpheus ruft noch die Welt auf, der Mozartische ruft sie nur an. Aber Bruder schon zu sein, aus prophetischem Stamm, ist groß.
Notizen
Theodor Däubler, mit einem kleinen Buch "Lucidarium in arte musicae" (Hellerauer Verlag): befreit die deutsche Musikschriftstellerei vom sauren Schund und vom eitlen Atelierkram. Sein Essay ist nur ein gedrängter Abriß der Musikgeschichte (vielleicht sogar einer schlechten; man rät auf den Canevas eines verkappten Wagnerianers.) Aber, endlich einmal! Dieser Däubler fügt die Musikgeschichte ein in die Geschichte des Menschen, der nach den Sternen springt. Dadurch begrenzt er den Weg der Musik - der sonst als unabsehbare Addition aus unendlich vielen kleinen Fortschreitungen dargestellt wird; und gleichzeitig erweitert er ihn ungeheuer - denn nun gilt es nicht mehr die Übergänge, sondern die Resultate der Geschichte des Himmels im Menschen.
Das Buch ist nicht einmal blendend, aber es ist unglaublich richtig. Mit der leidenschaftlichsten Selbstverständlichkeit bekommt hier Pythagoras, der Musiker, wieder recht, nach mehr als zwei Jahrtausenden: Die himmlischen Verhältnisse der bewegten Bilder des großen Kosmos werden vom Menschen eingefangen in erbittertem Schauer; umgeboren in bewußt geleitete Luftschwingungen, die den Menschen wieder unmittelbar anrühren und hinauf zu seinem göttlichen Ursprung führen. (Diese Partien hätte auch ein heutiger Maler schreiben können, dem der Kubismus ein gläubiger kosmischer Enthusiasmus ist!)
Däubler, der, ohne Aufhebens davon zu machen, die innere, die geistige Geschichte der Jahrhunderte kennt - den Zusammenhang des Menschen mit dem Himmel durch die Zeiten und seinen Abfall - gibt außerordentliche Erkenntnisse beinahe in Nebensätzen. Die Dreiteiligkeit der neueuropäischen Musik, der Kathedralenbauten und des Danteschen Werks. Oder, Zusammenbindung eines scheinbar nur musiktechnischen Prozesses mit dem ewigen Schicksal der Erdenwesen: "Die Polyphonie, der tönende Ausbruch eines unterweltlichen Sternenhimmels im Menschen" (was nicht allein schön ist, sondern jedem Kenner der Mythengeschichte sofort als unerhört exakt auffällt!).
Nebenbei tiefe Aufschlüsse über den Sinn der senkrechten und der wagerechten Linie; über den Ansturm des werdend vorschreitenden Entwicklungsmäßigen und über das in sich geschlossen Ruhende des "glaubhaften Urvorhandenseins".
Jedoch, das erste und das letzte Zeichen dieses Buches ist: der Mensch! (nicht eine künstlich herausgelotete Lehrangelegenheit "Musikgeschichte"). Damit wirft das kleine Musikbuch des Dichters Däubler in die Musikbetrachtung (die bisher amoralischeste aller Betrachtungen) Werte. Nicht Sonderentdeckungen, Nebenforschungen werden da veröffentlicht, auch nicht jene alten, sinnlos unvorstellbaren Parteiurteile von guter oder schlechter Musik.
Die neue Frage heißt: gelungene oder mißlungene Musik. Sie ist eine ethische Frage, sie fragt nach dem Maße des Sprungantriebes, den die Musik in unsere Adern bläst. Und diese schon metaphysische Frage reiht die klingenden Präludien unserer Anläufer auf nächtige Gipfel in die Menschheitsgeschichte.
Das Paradies in Verzweiflung
Ferdinand Hardekopf gab heraus "Lesestücke" (Im Verlag der "Aktion" [Franz Pfemfert], Berlin - Wilmersdorf, 1916). Hardekops Buch ist das schlachtenfernste dieser zwei Jahre. Jeder seiner Sätze handelt von den bürgerlichen Katastrophen des einzelnen und von seinen Rettungen. Das gab es noch nicht in der deutschen Literatur; sie war mit der Form beschäftigt, weil sie zu wenig zu verlieren hatte. Verzweiflung ist erst da, wo einer zu verlieren hat; Ausflüchte werden erst anerkannt, wo noch zu retten ist.
Irgendwo in der Welt kann Hardekopf Brüder finden, Empörer in alten Literaturtraditionen, die ihrer eigenen Beruhigtheit mit dem Sprung in den Abgrund drohten: Walter Pater, der fast Baudelairische Selbstmordlust in die dünne, spiegelnde Oberflächenhaut des ungewöhnlichsten Curialstil-Englisch leitete; den Franzosen Lautréamont, der mit fanatischer Offenheit und dichterisch geätzter Theologensonde sich schmachvoller Absichten bezichtigt; und den nahesten Laforgue, der die eigenen Ideen zwingt, ihn höhnend zu zerquetschen.
Dieses Geschlecht ist stets bereit, sich selbst unrecht zu geben, um aus noch größerer Verzweiflung die Rückschwingung zur Erde auch größer zu machen. (Es sind aber keine Aufrührer. Denn Insurgenten haben eine geradezu unfaßbare Naivität darin, sich selbst recht zu geben, auch wenn sie schon längst in Ehren und Ministerien eingerückt sind.) Von den Kindern dieses Geschlechts kann die Literatur Unendliches gewinnen; aber die Welt selbst, die Erde, durch Änderung wenig, und nur auf sehr indirektem Wege. (Umso falscher übrigens jene Argumentation, die behauptet, der indirekte Weg sei der einzige!).
Fragt man sie, die stets rücksichtslos offen gegen sich sind, so wollen sie nichts anderes als: Literatur machen. Sie wollen den Weg bereichern, den man zu den Häusern der Ideen zurücklegen muß. An der Wahrheit des Weges ist ihnen alles gelegen, an der Wahrheit der Ideen nichts.
Hardekopfs "Lesestücke" bereichern die deutsche Literatur. Mit einem Ruck springen Auge, Mund, Hand der deutschen Sprache auf ein hohes Niveau. Von der Höhe des Niveaus werden wir durch nichts abgelenkt: keine geheime Absicht soll mit Stilhülfe geschmuggelt werden; ein Ziel, zu dem Schreibkunst fortrisse, ist nicht gesetzt; keine ethische Angelegenheit außerhalb der gedruckten Seite wird der Verwirklichung zugetrieben; nicht einmal eine Amoral. Mit Offenheit ist nichts anderes angestrebt, als das Niveau selbst.
Außerordentlich ist die Klarheit solcher Menschen. So ist der Titel von Hardekopfs Buch wörtlich zu nehmen. Die Gedichte, Essays, Novellen des Bandes sollen zum Lesen da sein, allein für die Beseligung des Aufnahmeprozesses zwischen Leserauge und Leserglück. Der Leser machte das Buch zu - er ist entlassen. Handeln danach soll er nicht. Mit einer Sicherheit, die unter Deutschen ungewöhnlich ist, begrenzt Hardekopf diese Welt des Lesers zu einem wahrhaften Welt-Bild:
"Ich presse zu Linien die lästigen Bäche
Und denk' die ent-ölten in ebenen Plan;
Ich hasse den Raum, ich vergöttre die Fläche,
Die Fläche ist heilig, der Raum ist profan.
Ich werde mich listig der Plastik entwinden
Und laß euch gebläht im gedunsenen Raum.
Ich denke die lieblichsten Schatten zu finden
Im gefälligen Teppich, im flächigen Traum."
Sofort merkbar: diese Vorsätze sind nicht Armut, sondern Leidenschaft. Selbst wer den Haß nicht glaubt, glaubt die Vergötterung; und die Selbstbezichtigung der List gibt über alles Aufschluß, über Kampf, Katastrophen, Entscheidungen, über die namenlose Verzweiflung bis zur Selbstschmähung, und die resignierte Freude auf einen Ausweg.
Flucht, Ausweg, Rettung sind: Auch die Welt nicht mehr zu lesen mit einer Überideenwelt, sondern nur noch sich zu kümmern um den Weg zwischen einem unbestreitbaren Faktum und dem Menschen, der diesem Faktum gegenübersteht. Nur noch nach ihren Funktionen die Welt anzusehen. Überhaupt nur noch eine Funktionswelt zu kennen.
Funktionswelt; man horche auf! Wir wissen heute in allen Ländern so ungeheuer viel davon, wer die Menschen dirigiert, daß es köstlich ist, endlich einmal wieder zu erfahren, wie sie funktionieren. Durch Hardekopfs Fähigkeit zur abgekürzten Wiedergabe der Funktionen, fühlt man Menschenwesen wieder in ihre Würde und ihren ursprünglichen Wert als Mensch eingesetzt.
Hardekopf erdenkt das Paradies: Eine reine Funktionswelt, in der jede Bewegung kristallinisch durchschimmernd für ein wahrhaftes Sein eintritt. - O Verzweiflung! -
Die Schärfe, das Aufregende in der Zusammenfassung der menschlichen Funktionen bleibt stets auf derselben Höhe der unbedingten Aufrichtigkeit. Grenzen gibt es nicht, und ein sachlicher Unterschied durch die Form des Lesestückes besteht nicht. Es ist gleich, ob Hardekopf Gedichte, Aufsätze, Novellen, Dramatik schreibt; mehr in Betracht, als die Differenz des Lyrischen, Monologischen, Erzählenden, Zwiegesprochenen, kommt das Gemeinsame in allen diesen: die Feststellung; die Absolutheit, Indiskutabilität der Feststellung. Wo Hardekopf feststellen kann, ist ein Thema für seine Katastrophenmusik da.
Wer möchte, beispielsweise, heute noch imstande sein, ungelangweilt jene plumpe Variétéverklärung mitanzusehen, die eine Zeit lang sehnsüchtige Schriftsteller aus allzu niedriger, grober und gemeiner Nietzscheinterpretation konstruierten! Hardekopf unternimmt, trotzdem vom Variété zu sprechen, verklärt nicht, sondern stellt fest, teilt Chansonetten-Akrobaten-Zuschauer-Gattungsfunktionen aus, so wie er die Funktion des Zigarettenrauchens feststellen würde.
Und über seinen Variétékapiteln könnte als Motto das Wort einer Fee aus dem Märchenstück "Schlangenweib" des höhnisch unbekümmerten Gozzi stehen: "O Himmel, eh' das Publikum ungeduldig wird, mögen lieber die beiden Hauptpersonen zugrunde gehen!"
Aber man täusche sich nicht darüber, was denn die Feststellungen eines solchen Schiftstellers sind: es sind weder Beschreibungen noch Psychologie. Jede dieser aufgezeichneten Funktionen ist das äußerste Ende, das herausragende Spruchband eines ganzen Bündels von Symptomen. Jede menschliche Funktion, die Hardekopf notiert, ist nichts anderes als geradezu das Stenogramm eines Menschenschicksals.
Es gibt unglaubliche Enthüllungen. In der Erzählung "Manon" entschleiert der Leser einfach das Geheimnis der Konventionalität. Manon ist ein junges Mädchen, nichts anderes als ein harmloses junges Mädchen, die mit rührendem Eifer sich in erotische Abenteuer einläßt, aus Konventionalität. Sie ist gar nicht bei der Sache, nur beim Abenteuer (weil man offenbar so etwas tut). Und der Mann, der ihr Geliebter sein will, wird unfehlbar hingerissen durch ihre scheinbare Erfahrung in Liebesintrigen (die ganz aus Konventionalität besteht), und stets völlig entwaffnet durch die wirkliche, ungeheure Einfalt des jungen Mädchens, die er nicht sieht, nicht kennt, nicht erwartet - aus Convenu.
Davon erfährt man als von einem Leserereignis. Wo Leiden, Erregungen, Mißverständnisse der Personen auftauchen, sind sie nur in ihren Funktionen mitgeteilt, und dadurch für den Leser zu der Aufregung und Spannung geworden, die sonst höchstens ein Detektivroman aufbringt.
Aber wozu ist der Leser da? Um unterhalten zu werden? Nicht das ist Absicht. Woher die "Lesestücke" und woher die Hingabe an den einzigen Weg zwischen Schreiber und Leser? Hier ist kein Spiel. Hier ist Verzweiflung. Teleologie taucht auf; ein wildes, schluchzendes Durchdrungensein von Unausweichlichkeit der Erbsünde. Unvermeidlich wird die Welt als Gegebenes hingenommen, und das Erhabenste, das ein Mensch erreichen kann, ist, aus den Ereignissen Abstraktionen zu gewinnen. Vielleicht sind diese Denker die einzigen, die den Begriff Sünde wirklich kennen. Hardekopf sagt einmal bissig:
"Nie gelingt ein Dasein richtig;
Nur der Dicht-Extrakt bleibt wichtig."
Er kennt die göttliche Richtigkeit. Aber sein Schluß ist nicht (wie ich persönlich ihn ziehen müßte): wenn das Dasein nicht richtig gelingt, müssen wir - anhand des Dichtextraktes - es richtig machen! Diese Konsequenz würde er, beispielsweise mir, als mögliche Funktion anerkennen, doch sich selbst würde er sie nicht gestatten. Aus einer unausschöpfbaren Resignation, die ihm schon über die Verzweiflung hinaus zu der Schöpferkraft einer Passion geriet.
Man danke ihm für diese Offenheit hier (welcher Schriftsteller versteckt nicht sonst den Gedanken!):
"Das Leben: eine blague aus Schleim und Eiter.
Das Buch besteht und hilft euch weiter."
Nur ist es nicht wahr, daß uns heute wirklich das Buch weiterhilft! Hilft uns nicht heute mehr als gutgemeinte Ratschläge aus der Vergangenheit: daß noch rücksichtslose Offenheit möglich ist?
Völker mit einer langen Literaturgewohnheit sehen bei einem Schriftsteller nicht auf Einzelheiten, sondern auf die Totalsumme seiner Arbeit, aufs Oeuvre, auf die lebendige Druckseite, die von Buch zu Buch, quer durch die gelben Rücken der Volumina sich vervielfältigt, auf die Legende, die ein Schriftsteller aus seinen Werken von sich selbst schafft.
Das tun die Deutschen (mit geringer Literaturerfahrung) nicht. Sie sehen aufs Stück. Wenn ein deutscher Autor dreißig unvergleichliche Bände geschrieben hat und darnach in irgend einem Druckwinkel der Zeitschriften ein kleines, schlechtes Gedicht produziert, so ist er geliefert.
Geht es nun schon bei den Deutschen ums wertvolle Einzelstück, so mögen sie wenigstens im Fall Hardekopf ein positives Ergebnis aus ihrer Neigung zur Einzelkritik gewinnen! Das Buch "Lesestücke" ist nur klein, es ist von Zeile zu Zeile vollkommen. Man müßte von jeder Seite sagen, daß sie auf dem Hang über einem Abgrund geschrieben sei; mit der äußersten Hingabe an Vergangenes; mit dem unwiderruflichen wilden Ausdruck des Fertigseins.
Denn wo die Verzweiflung des Autors die Dinge dieser Welt zu ihrer letzten Vergeistigung zusammenschlagen läßt, entsteht die Augenlust des Lesers.
Die Wartenden (Worauf wartest du? Roman von Arthur Holitscher)
Menschen der heutigen Gesellschaft, die den Roman von Arthur Holitscher lesen, müssen in ungeheurer Angst erwachen. In dieser Dichtung erscheint unsere Zeit wie ein blitzschnell lautloser Absturz im Fiebertraum. Man kommt vor dem Buch gar nicht auf Fragen nach irgend einer Kunst. Dem Leser bleibt nichts als verzweifelte und fruchtlose Abwehr. Aber man ist gegen das eigene Entsetzen wehrlos, man kann das Buch nicht einmal im Schreck zuklappen und weglegen: so unmerklich gleitend und in unheimlich immaterieller Stille geht es weiter.
Die Menschen in der Dichtung Holitschers warten ihr Leben lang. Der Mann auf die Begegnung mit der Geliebten, das ungeliebte Mädchen auf den Mann; ein anderer wartet auf das Mädchen. Ein Künstler wartet auf seine Vision, die Frau, die er malt, wartet auf Enthüllung seiner Menschlichkeit. Um diese Menschen schliesst sich ein Chor knirschend Verzweifelter, Russen aus der Revolution. Sie warten auf die Freiheitstat, Ermordung des Grossfürsten. Dieser Ring düsterster Finsternis des Elends schliesst sich um den Mann, das Warten tauch ihn unter, wie eine Welle.
Sie alle verkommen, sterben verhurt oder unter Zuhälterfäusten, werden zerstört im Abgrund elendester Dunkelheit. Der Mann findet die Geliebte wieder, es ist zu spät, ihre Sinne sind erloschen. Es bleibt nichts mehr. Vielleicht die Tat? Mitten in diesem geordneten Deutschland, unter sympathisch gut gekleideten und harmlos Satten will dieser gutgekleidete, gesättigte Deutsche das Revolutionsattentat ausführen. Er wartet. Dann ist es zu spät, und er stirbt einen dreckigen Tod. Er wartet noch im Tod - vielleicht ein Ausweg!
Das scheint kein epischer Inhalt zu sein. Diese Menschen, die nicht selbst handeln, sondern den Moment ihres Lebens suchen, in dem alle Triebe gedrängt sich zu einer Handlung in die Zukunft entladen, die enden alle nicht in einer Tat, sondern mit einem schrecklichen Abbiegen, in einem stumpfen Ausweg. Es erscheint zweifelhaft, ob ein solches Buch in etwas anderem wirken könnte, als mit einigen Stimmungseindrücken. Aber der Nachhall ist von einem furchtbaren und starren Klang.
Erstaunlich, wie es aufgebaut ist ganz aus jener zerlegenden Psychologie, die man heut schon den Unterhaltungsblättern gönnen möchte - erstaunlich aufgebaut als hartes Dichtwerk. Diese Zerlegung und Auflösung - sonst billige Technik - wird hier zum Mittel einer Auflösung und Zerstörung der ganzen Zeit, die sie entstehen liess. Die kalt verschlossene Form der Zurückhaltung wird zu einem mächtig drohenden Ausdruck ethischer Verantwortlichkeit.
Holitschers Roman hat vielleicht das Äusserste gegeben, was die heutigen Romane mitleidender Psychologie vollbringen können. Das Stoffliche der Technik des psychologischen Romans, das Durchfüllen der Passivität, ist für Holitschers Buch zum Stoff geworden; zur Darstellung dieser letzten, tiefsten, furchtbarsten Hemmung unserer heutigen Gesellschaft: jener der Wartenden.
Damit ist diese Dichtung der Schlussstein einer ganzen Epoche, und darum hat dies Werk der Vielheit und der Verknüpfung auch schon wieder die grossen - nicht mehr individuellen - sondern Gemeinsamkeitswirkungen der reinen einfachen Epik.
Maler bauen Barrikaden
Die besseren Deutschen sind ein zufriedenes Volk. Sie sind zufrieden, zu sein. Bedeutendere Schriftsteller sind hier verfeindet um die Meinungsverschiedenheit, ob man aussprechen soll, was "ist" - oder ob man das nicht soll. Ton auf dem "ist". Niemand fragt nach dem "Was". Aber die besten Deutschen sind nicht mehr zufrieden, sondern phlegmatisch. Sie tun immer so, als kämen sie nach fürchterlichen Revolutionen einzig überlebend wieder auf die Erde gekrochen. Sie äußern: "Der Kampf ist ausgekämpft." Oder sie dichten: "Oh Daseyn!"
Für dieses Volk ist fleißige Tätigkeit und Hervorbringung dasselbe. Hier dichten sie, um zu dichten, malen, um zu malen, und jüngere Bildhauer sagen im dramatischen Halbschlaf: "Gebt mir Ton, zu kneten!" Man nennt das Produktion.
Malerei ist nicht da, um gemalt zu werden. Aber ebensowenig, um von Armen genossen zu werden, oder um bei Reichen zu schmücken. Eine wirkliche Ausstellung ist immer eine wirkliche Polemik, und Politik heißt höchste Begabung, höchster Wille, unsere Erstmaligkeit auf der Welt organisch werden zu lassen. Es kommt nicht darauf an, innerhalb der jedesmaligen Vorstellung von Weltgeschichte eine Rolle zu spielen. Es kommt nicht darauf an, zu sein. Es kommt darauf an, vollkommen zu sein und zum ersten Mal zu sein: was immer dasselbe ist. Es kommt darauf an, jede Sekunde unseres Lebens mit der Unmittelbarkeit und Unabgenutztheit des ersten Tages zu haben. Dagegen gilt nichts von dieser Welt der Zeitlichkeit, in der eine Sonne und ein Mond immer viel zu lange Tage brauchen, um auf und unter zu gehen. Was sind die Seligkeiten unserer Telephongespräche vor der Umrüttelung durch die Intensität, vor dem Auferstehen des ersten Tags!
Dies aus uns Raum werden zu lassen, seinen Raum überhaupt zu finden, ist die immerwährende ungeheure Revolution durch alle Zeiten. Es ist der Umsturz, überall, unter den Völkern, den Dichtern, Musikern. Den Malern. Der Maler: hat diesen geistigen Raum visionär zu schaffen. Das heißt, nach der Gestaltungskraft des Auges.
Visionär ist Picasso, trotzdem er Akademiker ist. Nicht visionär, sondern nur Illustratoren ihrer Unmittelbarkeitsempfindungen waren Beardsley und Gauguin; illustrativ: heute schon ein Kitsch.
Visionär ist Delaunay, trotzdem er Plakate malt (und wer privatim über Rubens so gerührt ist, müßte eigentlich in Delaunay dessen zeitgenössisches Gegenstück erkennen, mit genau demselben Anlaß zum Farbenexperiment).
Visionär ist Kokoschka, dessen überzeitliche Gabe mächtig auf Defreggertum gepfropft ist. (Ein berlinischer Maler darf gelassen ein koloriertes Umriß-Compositum aus Delaunay und Kokoschka, eins nach dem andern, herstellen: der augenlose Berliner Kunstmob ist enthusiastisch epatiert.)
Maler, wißt, daß ihr geistige Wesen seid, oder bleibt uns vom Halse! Ihr seid da, um mit Gabe des Auges unser Geistiges, von dem wir alle herkommen, als Raum in die Welt zu setzen. Wer das tut - weniger: wer das nur versucht - , ist so stark, daß er diese Welt um uns, diese Welt des Angeschwemmten, Versandeten, des seelig Breiartigen, des Ruhenden, daß er diese Welt des Daseienden in die Luft sprengt. Immer wieder. Maler, du willst; du stürzest die Welt um; du bist Politiker; oder du bleibst Privatmann.
Ein Uhrmacher interessiert sich natürlich für die Uhren seiner Kollegen, auch wenn sie schlecht gehen. Das ist Bereicherung der Technik. Maler kümmern sich mit Recht um die Tatsache, daß gemalt wird. Aber wir? Was geht uns das an? Daß Kunstfreunde sich um die Malerei für die Malerei zu tun machen, ist der alte deutsche Schwindel: immer mit dabei sein. Des weiteren Verschämtheit, Mißverständnis, Schutz vor Unproduktivität. Der Deutsche glaubt, es ist nett, ein Dichter zu sein. Dichter dichten in Bildern. Bilder? Na, beim Malen hat er ja gleich richtige! Oder, Anschaulichkeit die große Mode. Aber beim Maler kann man die Anschaulichkeit sofort mit nach Hause nehmen. Und erst ganz zuletzt kommt ein steinalt Mütterlein: "Wie faß ich dich, unendliche Natur?" Ei, beim Maler, auf dessen Werk sie nimmer welket. Das gibt es, natürlich, auch noch.
So brutal und blödsinnig einfach ist, daß in Deutschland alle besseren Damen und Herren Kunstgeschichte studieren. Deutschland das Land der groben Verwechslungen. Der Deutsche hat sich ein erstaunlich treffendes Symbol erfunden: den Ruderapparat im Zimmer. Man rudert, rudert, rudert und kommt nicht vom Fleck. Man rudert, bis man ganz dumm wird. Man sagt, vom Rudern wird man gesund. Deutsche Verwechslung: vom Dummwerden wird man gesund.
Malen um des Malens willen ist der Ruderapparat im Zimmer.
Kapitalismus ist nicht bloß ein Zustand; es ist auch eine Handlungsweise. Ausbeutung des auf der Welt Vorhandenen, das nicht aus unserm eigenen Organismus kam. In der Kunst verbirgt sich die kapitalistische Handlungsweise hinter den Begriffen "Tradition" und "Stil". Aber wenn man fort war, und man kommt wieder nach Deutschland, dann sieht man, in dieser Kunst hier herrscht nicht einmal der Großkapitalismus. Das ist ja der lumpigste Zwischenhandel: Dekoration und Imitation! Der dekorative Maler ist der Mann mit der Kellnergesinnung. "Was wünschen der Herr?" - "Schmücke mein Heim!" Der Imitator: "Komme sofort nach Empfang einer Postkarte."
Aber ich brauche ja den Secessionen nicht mehr erst zu erklären, daß ihr Schutzname bedeuten soll "Abmarsch des Volkes auf den heiligen Berg". Die Secessio plebis in monteem sacrum kennt jeder aus Sexta oder aus dem Lexikon.
Ich kann aber nichts dafür, wenn sie's vergessen haben. Der heilige Berg hat nichts mit dem zahlenden Publikum zu schaffen. Der Abmarsch nichts mit dem Kunsthandel. Das Volk sind nämlich wir, und die Secessio hat nur Sinn, wenn der Berg, auf den wir gehen, wirklich heilig ist: wenn von ihm aus die Welt der Beziehungen, Gewohnheiten, die Welt des Ausruhens und Genießens, die Welt der Tradition, Dekoration und Imitation erschüttert wird.
Und niemand wird hoffentlich noch albern genug sein zur Entgegnung: das sei eine Sache des Geschmacks. Geschmack gehört zum Kunstgewerbe, ist also eine Angelegenheit der Bequemlichkeit. Über den Geschmack kann man wirklich nicht streiten, denn es verlohnt sich nicht; vernünftigerweise setzt man sich auf ihn oder man trinkt aus ihm.
Die Secessionen haben nichts zu tun mit jüngeren oder älteren Generationen. Sondern einfach mit Durchrüttelung, Umstürzung, Änderung der Welt. Sie haben auch nichts zu tun mit verschiedenen Sehweisen verschiedener Maler, denn "verschiedene Sehweise" bedeutet, daß alle Maler in einem und demselben zeitlichen und zusammenhanglosen Material stecken, und jeder einer anderen Ecke verpflichtet ist.
Impressionismus, oder "Wie ich es sehe", ist aber nicht erst eine Erscheinung vom Ende des neunzehnten Jahrhunderts, sondern gehört zu allen minderwertigen Kunstwerken aller Zeiten; nämlich zu jenen, die mit dem Bereitliegenden Vorhandenen und Daseienden zufrieden sind, und denen es nur noch aufs Sehen ankommt - nicht aufs Schaffen. Jede wirkliche Schöpfung, jedes Raumwerk, jede Spur von der Intensität des Organischen anulliert sofort im Moment der Vollendung die sogenannten Qualitäten der Impressionisten. Aber das sind so bekannte und selbstverständliche Dinge, daß sie nicht zu wiederholen wären. Wenn nicht die deutsche Vieldeutigkeit und die deutsche Gekniffenheit vor dem Scheck - vor dem, was ist - wieder es forderten.
Ich habe soeben den fürchterlichen Fall erlebt, daß ein Freund, den ich bisher für den Fähigsten hielt, auch für den wertvollsten Urteiler, daß der Freund gekniffen hat, bloß weil Maler malen und Kunsthändler reiche Leute sind.
Aber Feigheit ist Willenlosigkeit.
Ein willenloses Volk sind die Deutschen.
In Deutschland nennt man einen Milchkeller "Trinkhalle". Gerad so pompös nennt sich die alte Liebermannsche Secession "Freie Secession". Sie hat, um nicht ganz zu verfallen, Maler aufgenommen (aus der "Neuen Secession"), die ihr sehr unsympathisch sind. Zwangsweise. Mit demselben Recht könnten sich die Elsässer, welchen man den Polizeiminister Dallwitz vorsetzt, ein freies Volk nennen.
Die "Freie Secession" stellt dreihundertvierundvierzig Werke aus. Dreihundert von ihnen zeigen konzentriert die größte Schande, die der Gedanke an Deutschlands Willen, Mut und Geist je vorstellen könnte. Nicht vorzustellen ist, wieviel in Deutschland immer einer hinter dem andern hergemalt hat, und wie wenig gearbeitet wurde. Hier muß Einsteins gutes Wort zitiert werden von den Leuten, die "mit den schwierigen Fünden eines bedeutenden Mannes imitatorisch ihre Kleinheit maskieren". Aber dreihundert Genossen der Freien Secession maskieren mit den leichten Fünden unbedeutender Männer.
Dreihundert Werke, von denen zu reden man sich schämt, weil mit Recht der für einen Zeitverschwender gehalten wird, der das Wort "Salonmusik" noch verächtlich ausspricht. Genüge die Mitteilung, es sind auch genz Feine da. Die imitieren, vorgeschrittenerweise, Henri Matisse. Über allem steht symbolisch das einzige Bild, das auf dieser Ausstellung erschüttert, Renoirs großer "Spazierritt".
Es erschüttert, weil es der vollkommenste Ausdruck der Malerei aus dem neunzehnten Jahrhundert ist, hinter der die Ausstellung schleift. Die ungeheuerste Verschwendung von Kraft, Tüchtigkeit, Anständigkeit, Zeit, Farbe und Leinwand, die magisch riesige Projektion der Seele eines vollkommenen, getreuen Porzellanpfeifenkopfmalers von unerreichter Technik in der Porzellanpfeifenkopfmalerei: mit diesen Werken wird der Kunsthandel ewig Geld machen. Rechtens. Da gehören sie auch hin.
Kameraden, ihr sitzt vielleicht in Hildesheim oder in Konstantinopel, ihr liegt vielleicht im Krankenbett und ihr werdet mit eigenen Augen diese Ausstellung nicht sehen. Dann denkt an alle Jahrgänge der verschwenderisch gedruckten Zeitschrift "Kunst und Künstler", so habt ihr sie.
Denkt an die Lebenden, die da als Vertreter gestellt werden. Maler Liebermann für ein sogenanntes Können, Maler Beckmann für ein sogenanntes Temperament, und abwechselnd Hodler oder ... Walser für sogenannten Stil.
Eine Zeitschrift, die genau wie die Secession plötzlich Bedürfnisse nach einer mystischen "jüngeren Generation" hatte, und in verantwortungsloser Feigheit sich Kunst-Meinungen von neueren deutschen Malern schreiben ließ. Und nur von Malern, die eine eifrige Maltätigkeit für Arbeit halten, deren Künstlertum im Nachschreiben angejahrter Redensarten und deren Kunst im musivischen Zusammenhausieren fremder Motive besteht.
Diese Zeitschrift voll frecher Unsicherheit wird geleitet von einer patzigen, stumpfen Unfähigheit namens Karl Scheffler. Einem Mann, der sich immer irrt, wenns aufs Unmittelbare geht. Kleinigkeiten beiseite: wie er vor Jahren zu Kokoschka allerlei von Unkunst eines - - Russen geschwatzt hat (und heute soll Kokoschka auf einmal ganz still als bedeutender Mann wieder einziehen). Wie er gelegentlich Marc Chagall als Nachschmierer alter Miniaturen bezeichnete und dicht daneben einen kleinen, diebischen Graphiker pries.
Wie er den unrettbar und vergebens von Abgestandenheit aufgewärmten Privatdruck-Illustrator Pascin seinen verblüfften Bankiers-Lesern als kühnen Versucher darbietet. Beiseite. Unmöglich zu reden von den Büchern dieses Kenners. Unmöglich zu erwähnen die gedunsene Geschwollenheit, das erregungslose Zuchthauswollespinnen in der Schreibart dieses Wortführers. Aber es ist die plumpste Herausforderung, daß dieses Produkt des Kunstkapitalismus, Karl Scheffler, daran gehen durfte, über den Schriftsteller Julius Meier-Gräfe linkische Worte, tadelnder Art, durch Druck zu äußern.
(Meier-Gräfe übrigens meint von Picasso, aus seinem "Kubismus" sähe überall die eigene Philistervisage hervor; ich halte Picasso für den bedeutendsten Menschen, der heutzutage den Pinsel auf die Leinwand setzt. Über dieser Verschiedenheit von Grund aus stelle ich fest, daß Meier-Gräfe der einzige mutige und unbedingte Mann ist, der seit hundert Jahren in deutscher Sprache zur Kunst spricht.) Karl Scheffler, vieldeutig aus Unbegabtheit, feige also aus Unbegabtheit wie seine Mitarbeiter, verzeiht keinen Mut.
Einige deutsche Maler stehen heut am Anfang. Wie weit sie überhaupt in Deutschland jetzt kommen können, mitten in der Berliner Tiefebene zurückzieherisch sich mästender Genügsamkeit, sieht man in der "Neuen Secession".
Das Unbedingteste, was heut geschehen kann, sieht man auch hier nicht. Die "Neue Secession" hätte die Pflicht, über private Mißstimmungen, über Personenkombination, und über Handelsfeindschaft hinweg nur Schöpfungen zu zeigen. Manche der wahrhaft Geistigen, Freundlich in Paris, der Russe Chagall, der Ungar Reith und der junge Düsseldorfer Mense stellen hier nicht aus.
Aber wenn jetzt von Bildern der "Neuen Secession" gesprochen werden soll, so kann das nicht über Lob- und Tadelverteilung geschehen, über Bilderbeschreibung, über technischen Anerkennungen, nicht über zeitgeschichtlichen oder psychologischen Auseinandersetzungen. Denn hier geht es nicht um Ateliergeheimnisse, sondern um das Gerüst des Schaffens. Um den Geist und um den Willen. Und alle sollen mit uns verkrachen, die sich bei der Feigheit besser stehen.
Voltaire
Der Mensch, aus dessen Händen das geistige, öffentliche und politische Leben Europas vor der französischen Revolution von 1789 über lange Strecken hin entscheidende Ideen und Antriebe empfing, hieß François Marie Arouet. Er wirkte unter dem Namen Voltaire, und dies ist eine Buchstabenversetzung von "Arouet l.j." (le jeune). Er war Sohn eines Notars, wurde am 21. November 1694 in Paris geboren und starb nach dem langen Leben von vierundachtzig Jahren am 30. Mai 1778 auf seinem Gute zu Ferney am Genfer See. Sofort nach seinem Tode wurde das Schauspiel, das er wenige Tage vorher hatte in Paris aufführen lassen, vom Spielplan abgesetzt, und die Pariser Gesellschaft, die ihn eben noch gefeiert hatte, war der Furcht vor ihm ledig und vergaß ihn eilig.
Dieses lange Leben war ganz von Arbeit, von Kämpfen, von Verfolgungen und von den höchsten Ehrungen, die seine Mitwelt geben konnte, ausgefüllt. Ruhe hat dieser Mann nicht kennengelernt: er fühlte sich für die Menschen seiner Zeit verantwortlich, und das ließ keine Zeit für persönliches Glück. Alle entscheidenden Momente seines Lebens zeigen ihn als Flüchtling. Er war Gefangener der Bastille; er lebte im Exil in England; er kam, in Ungnade am Hofe Louis' XV., zum Könige von Preußen und verließ auch Friedrich II. wieder bedroht und auf der Flucht. Er war verfolgt von Höflingen, Königen, Maitressen, Politikern, Gelehrten, Schriftstellern und am wildesten von der Kirche. Er war so an das Schwankende eines Doppellebens zwischen der Gunst der hohen europäischen Gesellschaft und bedrücktester Flucht vor Verfolgung gewöhnt, daß er sein Landgut Ferney nach der Möglichkeit wählte, am leichtesten aus einem dreier Länder ins andere fliehen zu können.
Alles, was man von seinem Leben weiß, zeigt außerordentliche, freiwillig menschliche Güte. Die Beziehungen Voltaires zu seiner Freundin, der gelehrten Marquise du Châtelet, mit der er im innigsten Freundesverhältnis blieb, als sie dem kränklichen Fünfziger Voltaire einen jüngeren Mann vorzog, deuten sein großes Herz, das schmerzend auch den Rivalen in die Freundschaft einschloß. - In einer Lebensstunde, da andere sich zu müdem Sterben bereit machen, als Siebzigjähriger, ficht Voltaire drei rastlose Jahre lang seinen gewaltigen Kampf um die Familie des unschuldig hingerichteten jean Calas aus, den Kampf gegen Gewalt, Grausamkeit, Intoleranz, zu dessen Teilnahme er ganz Europa mitriß; drei Jahre, von denen der Greis sagt, es sei während ihrer Zeit kein Lächeln auf seine Lippen gekommen, das er sich nicht wie ein Verbrechen zum Vorwurf gemacht habe. Zwei Sätze aus der herrlichen Gedenkrede Victor Hugos auf Voltaire (die eine Demonstration gegen den Krieg, gegen Gewalt und für das Volk ist): "Da, Voltaire, stießest du einen Schreckensschrei aus, und dies wird dein ewiger Ruhm sein. Da begannest du den fürchterlichen Prozeß mit der Vergangenheit, du plaidiertest gegen den Tyrannen und die Unmenschen für die Sache des Menschentums, und du gewannst sie. Großer Mann, sei auf immer gesegnet!"
Die neue Zeit begann damit, daß zum ersten Male die Feder des Schriftstellers den Sieg der menschlichen Erkenntnis über autoritäre Institutionen herbeiführte. Der Denker und Politiker Voltaire warf als Polemiker seinem Jahrhundert die Waffen zu geistiger Befreiung hin.
Bis er zu diesem Ziele einer neuen Heiligkeit vordrang, ist er in unerhörter Arbeitsleistung durch alle Gebiete der Sprache hindurchgegangen: Er schrieb die ersten großen Geschichtswerke seiner Zeit (darunter die "Histoire de Charle XII"); er dichtete die "Henriade", das bekannteste seiner großen Heldengedichte; die "Pucelle", das komische Epos der Jungfrau von Orléans, ein Werk, dem an kühnster lachender Skepsis gegen Traditionen kein Späterer nahe kommen konnte. Er verfaßte zahllose Streitschriften, deren jede die Zeitgenossen entsetzt auffahren ließ; er schuf unendlich viele Dramen - sie waren sein größter privater Ehrgeiz -, die am Tage nach seinem Tode vergessen waren. Er schrieb philosophische Abhandlungen, astronomische Werke. Und er gab, als Arbeit zu seiner eigenen Ergötzung, fast wie einen Nebenquell, der aus dem Überfluß des großen Stromes in der Nähe entspringt, jene Schöpfungen, die seine Zeit bis in unsere Tage lebendig überdauern, seine Romane. Er war schon ein reifer Mann, war vierundvierzig Jahre alt, als er 1738 auf Cirey, dem lothringischen Landgut der Marquise du Châtelet, seine ersten Romane entwarf. (Sie erschienen in der Öffentlichkeit etwa zehn Jahre später:) "Die Welt, wie sie ist", 1746, "Zadig", 1747, "Mikromegas", 1752. Ein Menschenalter später, 1775, wurde die letzte seiner Prosaerzählungen, "Die Ohren des Grafen von Chesterfield", veröffentlicht.
Die Dramen Voltaires, mit denen er der Euripides des klassischen Theaters der Franzosen sein wollte, sind der Nachwelt gleichgültig geworden, weil sie Thesenstücke sind, und weil ihre Thesen (wie etwa im "Mahomet": aller Glaube beruht auf Machtgier und ist Priesterbetrug) so ins allgemeine Bewußtsein übergegangen sind, daß sie schon wieder angezweifelt werden mußten. Seine wissenschaftlich-theoretische Tätigkeit, die ihn zum richtunggebenden Denker für die Zeitgenossen des achtzehnten Jahrhunderts gemacht hat, erscheint unsern Augen als ein großartiger Allerweltsfeuilletonismus. Seine Geschichtswerke sind romanhaft. Seine Pamphlete, in denen die Empörung Anklage gegen die Ungerechtigkeit erhebt, sind so eng an die historisch-juristischen Fälle, von denen sie ausgehen, gebunden, daß sie, die ihren Verfasser zum menschlich wirkendsten Tagesschriftsteller Europas gemacht haben, mehr Sache einer Geschichte der Humanitätsidee im achtzehnten Jahrhundert, mehr noch große Lebensakzente in der persönlichen Biographie eines mächtig mitfühlenden Menschenherzen sind, als lebend in der Teilnahme der Nachwelt. Gerade weil im Rechtsbewußtsein und in der Ideengeschichte die meisten Forderungen der Streitschriften Voltaires wenigstens formal verwirklicht wurden, sind sie für unsere Vorstellungen selbstverständlich geworden. Sein kirchenmachtfeindlicher, dogmenkritischer Enzyklopädismus, der einst Voltaires Gestalt in Schwefeldampf hüllte, ist als Unabhängigkeitsdrang der Überzeugung längst ins volkstümliche Bewußtseinsgut Europas gedrungen, und seine Grundlagen sind auch von der vorsichtigsten Seite der heutigen Glaubensforschung an Schärfe, Richtigkeit und Umfang weit übertroffen. Aber dies alles deutet auf eins: Auf das ungeheure Opfer, das Voltaire sein Leben lang mit seinem geistigen Wesen gebracht hat. Der große Schriftsteller, der seine Fähigkeit hingibt, um den vergänglichen Moment zu retten und zu vermenschlichen; der Gelehrte, der sich dem Haß der Fachkreise aussetzt, um ihre Wissenschaft durch seine Kunst allen Menschen zugänglich zu machen; dieser Geistige, der unter "Geist" kein schützendes Reservat seiner Person versteht, sondern die Verpflichtung, seine Erekenntnis der Empfindung und der Vernunft aller verständlich zu machen: Das ist die Gestalt der höchsten Güte!
Uns blieben Voltaires Romane. Man schlägt eine Romanseite Voltaires auf, und was heute in seinen Dramen uns steif und absichtlich, in seinen Verserzählungen mit Pointen belastet, in seinen Traktaten mit zweifelhaftem theoretischen Apparat beladen dünkt, das springt in jeder Romanzeile mit dem eilenden, warmen Puls natürlicher Menschlichkeit. Die Sprache dieser Romane, ihr Fluß, ihre Erzählungsluft sind von der größten Natürlichkeit - innerhalb der Konvention des achzehnten Jahrhunderts. Ihr Inhalt ist: Aufbäumen gegen diese Konvention und von einer phantastisch-unsinnigen Unnatürlichkeit. Der Bau der Romane hat die wunderbare, dichte Geschlossenheit der großen französischen Erzählungswerke des siebzehnten Jahrhunderts. Ihr Dialog bewegt sich schon in der neuen realistischen Natürlichkeit jenes Niveaus, das die ungeheure Neuerung des englischen Romans im achzehnten Jahrhundert war. Ihr Stil: die anspielungsreiche Sprache der Gesellschaft. Die Schilderung der Personen und der realen Ortsbedingung der Situationen, der Landschaften, Städte, Gebäude, bleibt in der uncharakteristischen und sogar kaum typisierenden Erzählerkonvention des Rokoko-Salonromans, der alle Einzelheiten an Menschen wie an Dingen in vager Allgemeinheit ereldigt und mit Begriffen beschreibt, die er bereits selbst wieder aus vorangehender, schon zu Konvention erstarrter Literatur übernimmt. Aber die Situationen Voltaires sind im Verhältnis zur Romanliteratur seiner Zeit gerade so weit konventionell zu nennen, wie es die im "Don Quijote" des Cervantes zu den Ritterbüchern waren: Mit höchster Zusammendrängung, äußerster Übertreibung der Konvention machen sie, daß die Konvention endlich umschlägt und auf den tiefsten Punkt herabstürzt. Der Erzähler Voltaire arbeitet also ganz anders als ein Diderot, in dessen Stil eine Mischung vom Bohèmehaftigkeit und knapper Strenge in fast demokratischer Bürgerlichkeit aufs kommende Jahrhundert leitet; ganz anders als ein Rousseau, dessen Empörersprache mit neuer Liebe zur persönlichen Schilderung eine neue Konvention schafft.
Voltaire hätte den Platz als Schöpfer einer neuen Literatur, die ganz in die Zukunft weist, abgelehnt. Er bedarf der alten, verbrauchten, unwerten Produktion seiner Zeit, um sich in ihr einzugraben, tief über ihre Wurzeln hinauszukommen und überrraschend zu Gründen des Menschentums vorzudringen. Voltaire bietet das hinreißende Schauspiel, wie ein politischer Polemiker zum Dichter wird.
Der Blick auf irgendeinen der begabten Romanschriftsteller jener Epoche, die im Zeitstile schrieben, den Voltaire annahm, macht die ungeheure Höhe Voltaires deutlich. Der Roman des Zeitgenossen ist unterhaltend. Der Roman Voltaires - in derselben Sprache, im gleichen Rosalichte, und in ähnlichen Situationen - ist aufwühlend. Dieser Unterschied liegt auf ethischem Gebiet.
Die Romane Voltaires hat ein Rebell geschrieben. Ein Rebell, kein Revolutionär. Einer, der nie eine Gemeinschaft sah, mit der er sich zum Sturze des Gehaßten und zu einem Neubau der Zukunft hätte verbinden können; der stets auf das Vertrauen zu sich allein gewiesen wurde. Ein Rebell, der nie das Ziel seiner Rebellion verwirklicht sah, der in aller Geselligkeit mit seinem Empörertum ganz einsam bleib - so einsam, daß er von den Zeitgenossen als geistreichster, boshafter Unterhalter genommen wurde - während er das Bewußtsein der Zukunft vorbereitete: ein Auflockerer der Gesellschaft. Inmitten der Mißverständnisse um ihn (mit denen sich die Gesellschaft instinktiv gegen den Angreifer verteidigte, der sie am gefährlichsten, von innen her, bedrohte) war dieser Rebell Voltaire so einsam, daß er nicht einmal entmutigt werden konnte: Er hat sogar die Resignation zur Atmosphäre und zum innern Thema seiner Erzählungen gemacht, um schnell und strömend über sie hinwegzueilen, weil er nie sein Ziel vergaß. Und dies ist die größte Kunst Voltaires, nie das Ziel seines Erzählens und Erfindens, auch bei den kühnsten Phantasiebögen, den geschnörkeltesten Abschweifungen, zu verlassen. Dieses Ziel ist stets ideenhaft: Aufruhr gegen die Dummheit der Gesellschaft, Empörung gegen die Ungerechtigkeit, Kampf gegen den Zwang, die Gewalt, die Sklaverei, die Bedrückung der Autorität. Zwei Willensströme fließen in seiner Person zusammen: Unaufhörliches, unruhiges Drängen dieses kleinen, dürren, trockenknochigen Leibes nach aufrüttelnder Berührung mit Menschen, und die Begierde nach Durchsetzung seines geistigen Ziels unter den Menschen.
Das gibt die Gestalt des Rebellen. Und als Grundhebel zur Rebellion der Welt, als letzter Sprengstoff des Geistes, den ihm seine Zeit bietet, dient ihm eine Formel, die tatsächlich in jenen Generationen an der Zerstörung einer alten Gesellschaft und am Anwurzeln eines neuen Menschenstammes arbeitete, die Formel: Verstand. Der Verstand ist die Entedeckung jenes Jahrhunderts; Voltaire ist der Kopernikus dieses neuen Weltsystems vom Denken. Ein solcher Mann würde in einem andern Jahrhundert der Rebellionsheld einer anderen geistigen Zeitentdeckung geworden sein: Er hätte zur Zeit des Athens der Perserkriege sokratische Erkenntnis gelehrt; im Römertum eines Nero wäre er ein Sprecher der urchristlichen Idee gewesen, in unseren Tagen hätte er das einfache Leben und den staatenlosen Antimilitarismus Tolstois verteidigt. Dabei stand er zwischen zwei Zeitaltern, und das spricht aus allen Zügen seines Lebens: Es war eine Rebellion im höchsten Luxus. Wenn er die Gesellschaft seiner Zeit auflockern will, braucht er sie. Wenn er die Autorität vernichten will, muß er von ihr anerkannt sein. Wenn er von Herrschern, die er bekämpft, und von der Gesellschaft, die er verachtet, als Gegner ihresgleichen behandelt sein will, wenn er frei sein will, muß er bewegungsfrei sein, reich sein. Wie ein Abenteurer nimmt er sein adeliges Pseudonym an; wie ein Wucherer treibt er Börsenspekulationen und scharrt ein Vermögen zusammen: Ein Mensch, der sein Leben ein Jahrzehnt vor dem großen gesellschaftlichen Umsturz seines Jahrhunderts beschloß, der die französische Revolution als Tatsache nicht mehr erlebte, und der mit einem ungeheuerlichen Optimismus und mit einem ungeheuerlichen Glauben an seine Kraft alle Umwälzung menschlicher Verhältnisse auf seine eigene Wucht und auf seine eigene Person gestellt sehen mußte!
Diese Person des Rebellen Voltaire verfügt über ein unerschöpferliches, unvergängliches und zeitloses Rebellionsmittel: eine unermeßliche, ewig neue Unbefangenheit. Der Verstand ist die zeitliche Form, mit der Voltaire sein Sprengmittel in die Spalten der Gesellschaft legt. Die Verstandesphilosophie des achtzehnten Jahrhunderts gab Voltaire ein ganzes Arsenal von Argumenten gegen seine Gesellschaft; Argumente, die gerade jener Gesellschaft neu und überzeugend waren, oft überzeugend durch ihre scheinbare Neuheit: da ist die "Tugend" als Ideal, diese "vertu", die zwischen der "virtù", der universellen Persönlichkeitskraft der Renaissance, und der "respectability" des englischen Puritanismus die Mitte hält.
Dann die neue Überzeugung von der nur relativen Wahrheit des menschlichen Glaubens und von der absoluten Wahrheit des Denkens. Ein neuer Horizont der Welt wird entdeckt, mit der Einstellung zum Menschen als einem kleinen und unwichtigen Wesen gegenüber den erhabenen und ewigen Vorgängen im Kosmos - dennoch wiederum groß und wichtig genug, daß dieses geringe Wesen Mensch jene erhabenen Wege des Universums nicht durch die neuen Erkenntnisse seiner Astronomie berechnen könnte. Und zuletzt ist da der halb verheimlichte, halb resigniert verzweifelt zugestandene Gottesglauben des Dixhuitième-Rationalismus, der Deismus, der einen Gottschöpfer annimmt, weil er, halb gefühlsmäßig, halb mechanistisch das Universum als gewaltiges Uhrwerk ansieht, das eines ersten Antoßes bedurfte, weil er nach einem "Zweck" des Geschenhens fragt - und die Antwort auf diese Frage weiß oder die Verzweiflung antworten läßt; zuletzt wieder die große, kraftvolle Naivität: Wenn man mit dieser ungewissen Annahme Gottes die Menschen zur Freiheit bringen könne, dann sei sie richtig, wenn sie zur Unterdrückung diene, falsch! -
Auch dieses Hin und Her der Überzeugungen, die stete Skepsis, ist für Voltaire noch eine neue, gewaltige Hilfe zur Rebellion. Skepsis, verstärkt von seiner mächtigen persönlichen Vitalität, die ihn gelegentlich auch an der Realität von feierlichsten Begriffen der Verstandeslehre selbst zweifeln läßt. In Voltaire wird die Skepsis nicht zur Müdigkeit - in ihm setzt die Bewegung des Blutes neu um; selbst die Skepsis verwandelt sich in ihm zu neuer, rebellierender Unbefangenheit.
Voltaires Prosaerzählungen spielen sich in den Lieblingsformen seines Zeitgeschmackes ab: Der orientalischen Erzählung, der Robinsonade und der phantastischen Abenteuergeschichte im Stile des Gulliver. Sein eigenes literarisches Bekenntnis über fremde Werke gibt zwar ein Bild vom Geschmacksniveau des Schriftstellers, aber nicht von der ethischen Hochglut, aus der sich die Idee über seine riesenhafte Produktivität stürzte, um sie vorwärts zu treiben. Er entdeckt Shakespeare für Frankreich, wirkt weit für seine Anerkennung, übersetzt ihn sogar und findet ihn barbarisch. Er beschützt Rousseau und macht sich etwas bekümmert über dessen Apotheose von ungezügeltem Naturkindtum lustig. Einmal erklärte er: "Man muß einfach schreiben." Ein anderes Mal: "Es genügt nicht, ein paar Situationen herbeizuführen, wie man sie in allen Romanen findet, und den Zuschauern hinzureißen. Sondern es kommt darauf an, stets neu ohne Sonderlingstum, zuweilen erhaben und stets natürlich zu sein; das Menschenherz zu kennen und es sprechen zu lassen; selber ein großer Poet zu sein, ohne daß seine Person poetisch auftrete."
Nichts davon spricht vom eigentlichen Sinn seines Schaffens, und dieser Sinn wurde auch von der Kritik seiner Zeit nicht berührt. Voltaire, der sein Werk so selbstverständlich als Arbeit leistete, daß er sich selber niemals dieses Sinnes ganz bewußt wurde, empfand daum immer, daß die Kritik einen wichtigen Zug seines Lebens, der in ihm als etwas Elementares waltete, nicht zu beachten verstand. (Und dieser beizendste Kritiker Europas schlug sich bis an sein Lebensende mit seinen Kritikern herum; einigen von ihnen, beispielsweise Fréron, die man ohne Voltaire längst vergessen hätte, räumte er sogar wiederholt einen Racheplatz in seinen Romanen ein).
Denn eine Idee wirkt in seinen Werken, eine einzige Idee, eine Idee, deretwegen er Hunderte von Szenerien, Begebnissen, merkwürdigen Verknotungen und sonderbaren Schicksalen erfunden hat. Jene Idee, deren unvergessener und gewaltiger Vorkämpfer Voltaire heißt: die Idee der Toleranz. Die "Toleranz" ist für das achtzehnte Jahrhundert eine geradezu neue Weltkugel des Gefühls, eine Welt, die Verständnis des Fremden, Mitgefühl mit dem Unterdrückten, und weit mehr als nur Duldsamkeit einschloß; wir müßten, um in unserer Sprache von ihr zu reden, sie einen menschengütigen Internationalismus nennen. - Der Kampf gegen die Intoleranz macht jede Zeile Voltaires muskulös. Das Ziel der Toleranz-Idee beherrscht die Führung jedes seiner Werke: Zum Ruhme der Toleranz ist er bereit, in dem einen Roman nachzuweisen, daß die Welt ein elendes, wirres Chaos ist, aus dem man sich nur in vergessenbringende Arbeit retten kann; in einem anderen Roman zu zeigen, daß die Welt, wie sie ist, ganz erträglich ist, wenn man nur jeden an seinem Platz läßt. Und dieser seltsame Standpunkt eines Kämpfers auf beiden Seiten ist nicht, wie er unter Gebrauch der wörtlich selben Begriffe es heute wäre, die Äußerung einer platten Vorteilssucht, sondern Zeichen leidenschaftlicher Güte. Weit von aller günstigen Bequemlichkeit spürt Voltaires Leidenschaft noch in seinen Widersprüchen seine umwühlende Idee auf.
Er ist unermüdlich im Erfinden ungeheuerlicher Situationen, die zeigen, mit welcher Grausamkeit Menschen einander vernichten, nur um verschiedener theoretischer Meinungen willen. Im achtzehnten Jahrhundert ist er der europäische Ankläger und Kämpfer gegen alle Ideologien des Staates, der Kirche, der Schulen, der Parteien, welche die Kriegsstacheln der Menschheit bilden. Er ist der erste herzensgroße Gegner des Krieges, den die neue Zeit hervorstieß; unendlich mutig: Der redet nicht im augenzwinkernd unverbindlichen Rotwelsch des Gelehrtenfachs oder der Schreibtischaristokratie, sondern er springt auf wie Welttribüne, die er selbst sich bauen mußte, und schreit zu allen Ohren, allen Köpfen, allen Seelen. Er sieht jede Brutalität, jede Grausamkeit, jede Ausbeutung, die die Gesellschaft gegen die Wehrlosen organisiert. Er deckt sie auf mit dem Gelächter seiner fürchterlichen, verwunderten Unbefangenheit, die niemals begreifen wird, daß Glaubenskriege, Meinungskriege, Wirtschaftskriege und ihre Folge, die Sklaverei, überhaupt möglich sind; mit einem Gelächter des Unverständnisses über Ideale, denen die Gesellschaft scheinbar folgt, um unter ihren Fahnen um so ungestörter sich zerfleischen zu können, Kirchenlehre, Vornehmheit, Besitz, Familienlehre - und die er alle als schnell preisgegebene Fiktionen erweist für den Fall, daß das wirkliche Gut des Menschen bedroht ist, das Leben Voltaires umfassendste, unmittelbarste und am persönlichsten durchlebte Idee, die Toleranz, wird zuletzt selbst auch nur ein Mittel zu seinem größten, nicht mehr im Begriffsworten ausgesprochenen, aber überall gestaltet durchgeführten Ziel: der Verteidigung des Lebens, der Rettung des Lebens, dem Preis des Lebens. Und das Leben, das einfache, wirkliche, kleine doch so wundersame Weiterleben auf dieser Erde erscheint schließlich als der eigentliche Sinn seiner Werke, ihm selbst unermeßlich viel wertvoller als sogar sein eigenes Recht - oder Unrechbehalten: Das Gut, zu dessen kämpferisch milden Verteidiger ihn das Schicksal hinanwachsen ließ.
Da ist die Tendenz Voltaires. Seine Werke sind Tendenzwerke. Er ist der erste und gütigste Tendenzdichter der neuen Zeit. Seine Tendenz, das Leben, drückt er in einer Mannigfaltigkeit aus, in einer Erfindungsfülle, in einer rapid eilenden Dichtigkeit der Spannung, wie jemand, der die Aufgabe vor sich sieht, in den Jahren eines einzelnen Menschenlebens das ungeheure und phantastische Bild des Schöpfers dieses Lebens (an der er glaubt!) den Menschen noch einmal im kleinen, ihnen verständlich und ganz aus der Nähe zu zeigen. Er hat, der große Tendenzdichter, gar keine Zeit, seine Figuren und deren Leben zu individualisieren. Glück, Liebe, Unglück, Rettung - alles spielt sich in den an sich irgendwie gleichgültigen Formen des Lebens ab, in ewiger Wiederholung der Grundzüge und neu nur durch den Wechsel von Sitte und Kleidung. Alle Frauen sehen sich gleich, alle Männer sehen sich gleich, und ihre Antriebe sind sich gleich. Überflüssig wäre es, aufhaltend im Strome der Ereignisse, auf dem einen Begebnis intensiver zu verweilen als auf einem anderen. Szenen, die durch elementare Ausbrüche etwa die besondere Bedeutung, die Merkwürdigkeit, die Stärke einer Beziehung darstellen könnten, fehlen in diesen großen Tendenzwerken vollständig. Die Musik fehlt. Aber eine höhere Fügung universeller Harmonien umschwebt dieses Werk: die neue Erdballpolitik der Menschlichkeit.
Das ganze Leben der Erdkugel wird von Voltaire stets als gemeinsam empfunden, immer zusammen gesehen. Nichts läge ihm ferner, als die große Gemeinsamkeit, die die Lebensform aller auf der Erde ausmacht, zu stören, sie durch Verweilen bei Individuen zu durchstoßen. Nichts läge seinem großen Ziele ferner, als in Durchstoßung der mächtigen, ihm stets gegenwärtigen Lebensform, Wirkungen zu erreichen, die wir, mit neuezeitlicher Literatursprache, "tief" nennen würden. Er hat keine Tiefe. Er braucht keine Tiefe. Seine Werke sind Oberfläche, gebildet von den unzähligen Spitzen einzelner Leben, die er aus der gewaltigen Lebensflut, die die Erde umströmt, uns erblicken läßt. Diese letzte Rettung des Lebens, diese äußerste Oberfläche, ist die Größe und die Heiligkeit Voltaires. Nur eines reißt ihn immer zum Einhalten hin, zum unmittelbaren Ausdruck seelischer Vorgänge und zum dichterisch-persönlichen Lyrismus: Das Geistigste alles uns wahrnehmbaren Weltgeschehens, das Kosmische.
Voltaires unmittelbares Aussprechen des Gefühls beginnt bei der Astronomie. In diesem Reich der Abstraktion und der Ewigkeit umschlingen sich die Wurzeln seiner erdverbundenen und seiner himmlischen Seele, und aus ihrer beiden Umschlingung kommt der neue, der ethische Mensch. Voltaire wird zur Gestalt des großen Menschenänderers, des universellen Politikers im hohen Menschensinne Platos. Der kosmisch fühlende Mensch ist an die ganze Welt gebunden, Mensch, der sich dieser Welt verantwortlich fühlt, der ethische Mensch.
Dieser kosmisch-politische Mensch, der das innere Bild der Person Voltaires ist, wurde in der geistigen Tat seiner Arbeit, in dem schöpferischen Wirken seines öffentlichen Lebens zum Repräsentanten des stärksten Lebensgefühl seines Jahrhunderts: zum Kosmopoliten. Und hier wird der Schriftsteller weiter und größer, als es sein Individuum und seine Person ist. Der Kosmopolit ging zur ganzen Menschheit. Es gab für ihn keine Sprachgrenzen mehr, keine Ideenschranken, keine Völkerbarrieren, keine Rassenscheidungen - nur noch den Menschen.
In dieser neuen und so leidenschaftlich erfühlten Erkenntnis lag seine neue Unbefangenheit. Nur einen Blick brauchte sie auf den alten Ablauf der wimmelnden Untertanen- und Sklavenblick des Rebellen. In diesem neuen Blick auf die Menschhheit schimmert schon ein Horizont, der in seinem Ausschwingen mit an der Gestaltung der folgenden Zeit zeichnete und dessen weitschweifender Bogen auch unsere Tage noch berührt. Voltaire, der Einsame, der Rebell, brachte der Menschheit als Tat seine Idee: Damit sie wieder Tat werde, Erhebung zu neuem Erddasein, Gemeinschaft. (1919/1920)